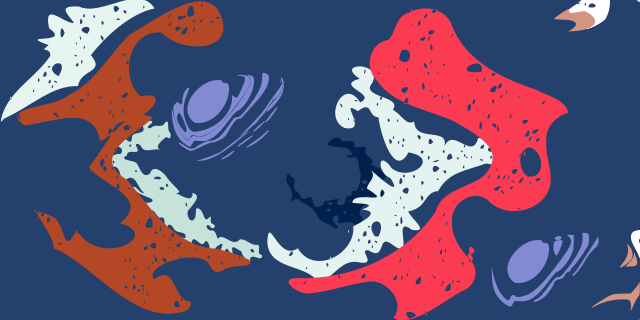Herbert Ammon
Rolf Stolz: Notwende Deutschland. Zur Rettung des Landes und vor sich selbst, Uhingen (Gerhard Hess Verlag) 2025, 268 Seiten.
Wenn Bundeskanzler Merz unlängst in sehr allgemeinen Worten über den desolaten, allenthalben augenfälligen Anblick deutscher Städte spricht, schlägt ihm links-grüne Empörung entgegen. Vereint im Kampf gegen die AfD, sperrt sich die classe politica samt der deutschen Medienöffentlichkeit gegen die Erkenntnis der Konsequenzen der evidenten, statistisch belegten Fakten: Der fortschreitende Wirtschaft und Wohlstand gefährdende Analphabetismus hat maßgeblich mit dem Zustrom von Migranten aus dem islamisch-orientalischen Kulturkreis zu tun. Einher mit dem Bildungsnotstand geht der demographische Prozess, id est der - als »rechts« begrifflich verpönte - Bevölkerungsaustausch.
- Details
- Geschrieben von: Ammon Herbert
- Rubrik: Geschichte
von Herbert Ammon
Jörg Baberowski: Der sterbliche Gott. Macht und Herrschaft im Zarenreich, München (Verlag C.H.Beck) 2024, 1370 Seiten
Hierzulande löst der Name Carl Schmitt – assoziiert mit der Negativfigur des ›Kronjuristen des Dritten Reiches‹ – gewöhnlich nur moralische Entrüstung aus. Grundlegend für Schmitts politische Theorie sind Begriffe aus dem Leviathan, dem Werk des Verteidigers des Stuart-Absolutismus Thomas Hobbes. Entgegen dem demokratischen Selbstbild – der im liberal-demokratischen Vertragsdenken kolportierten Vorstellung von der sich durch freie Übereinkunft und Wertbindung legitimierenden res publica– lautet einer der von Schmitt zitierten Kernsätze Hobbes’ Auctoritas, non veritas facit legem. Der große Leviathan ist der gemäß der Hobbesschen Theorie des Herrschaftsvertrags auf rationale Einsicht, de facto auf Unterwerfung gegründete Machtstaat. Dieser verfügt – wenngleich ›unter dem unsterblichen Gott‹ – als ›sterblicher Gott‹ über seine eigene Metaphysik: Er ist der Souverän. Er ist nicht den bürgerlichen Gesetzen unterworfen. Zugespitzt lautet der Satz bei Carl Schmitt: Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand verfügt. Zusammen mit dem als Freund/Feind-Verhältnis definierten Begriff des Politischen sind derlei Sätze in der politischen Bildung der Bundesrepublik tabu.
- Details
- Geschrieben von: Ammon Herbert
- Rubrik: Geschichte
von Ulrich Schödlbauer
Historische Darstellungen beruhen auf zwei Fragestellungen:
1. Was hätte passieren können, wenn…?
2. Was waren die auslösenden Faktoren für…?
Auf beide kann es, wie leicht einzusehen, nur hypothetische Antworten geben – im ersten Fall, weil die Frage selbst hypothetisch, im zweiten, weil der Gegenstand virtuell unendlich ist: historische Realität wird nur in Schichten zugänglich, Schichten verlangen Schnitte, Schnitte bedeuten Willkür – das heißt, spätestens an dieser Stelle fließen Interessen ein, irgendwann auch die Frage nach Schuld und Gerechtigkeit und damit das Problem der Monokausalität: Man will wissen, wer’s getan hat, und dieses Wissen ist bei komplexen historischen Vorgängen nicht zu erlangen. Das heißt, man setzt den Teil fürs Ganze und bleibt Gefangener einer Perspektive. Geschichte, so betrachtet, ist eine perspektivische Wissenschaft.
- Details
- Geschrieben von: Schödlbauer Ulrich
- Rubrik: Geschichte
- Michael Wolski: 1989 Mauerfall Berlin. Ein Rückblick nach 35 Jahren, Berlin (Selbstverlag) 2024, 145 Seiten (Ulrich Schödlbauer)
- Helmut Roewer: Nicht mein Krieg, Dresden (edition buchhaus loschwitz) 2024, 344 Seiten (Max Ludwig)
- Lee, Sabine/Glaesmer, Heide/Stelzl-Marx, Barbara (Hgg.): Children Born of War: Past, Present and Future, London (Routledge Studies in Modern History) 2021, 372 Seiten (Felicitas Söhner)
- Kurt Lehnstaedt: Gröbenzell in den Jahren 1933 bis 1945. Die fünfteilige Siedlung im Nationalsozialismus, München ( Volk Verlag) 2015, 296 Seiten (Herbert Ammon)
- Arp, Agnès; Goudin-Steinmann, Élisa: Die DDR nach der DDR. Ostdeutsche Lebenserzählungen, Gießen (Psychosozial Verlag) 2022, 316 Seiten (Felicitas Söhner)
- Peter Brandt / Gert Weisskirchen (Hgg.): Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Der Aufbruch in der Tschechoslowakei 1968 in seinem historischen Umfeld, Bonn (Verlag J.H.W. Dietz Nachf.) 2022, 287 Seiten (Herbert Ammon)
- Nils Hansson: Wie man keinen Nobelpreis gewinnt. Die verkannten Genies der Medizingeschichte, Gräfe und Unzer (München) 2023, 240 S. (Felicitas Söhner)
- Wilfried Lehrke: Die Weimarer Klassikerstaetten als Nationale Forschungs- und Gedenkstaetten der klassischen deutschen Literatur in Weimar. Ereignisse und Gestalten. Eine Chronik (Steffen Dietzsch)
- Michail Prischwin, Tagebücher, hrsg. v. Eveline Passet, 2 Bde., Berlin (Guggolz) 2022, 962 Seiten (Steffen Dietzsch)
- Deutschland von rechts und links – eine Rezension und eine Groteske (Helmut Roewer)
- Hans-Christoph Rauh: Personenverzeichnis zur DDR-Philosophie 1945-1995, Berlin (De Gruyter) 2021, 665 Seiten (Steffen Dietzsch)
- Verein Lila Winkel (Hg.): Ernestine Dohr-Reiter/Ingrid Partenschlager/Judith Ribic, Häftling Nr. 1935. Ich lebe noch! Die Geschichte unseres Vaters Ernst Reiter, o.O. 2021, 88 Seiten (Peter Brandt)
- Wolfgang Templin: Revolutionär und Staatsgründer. Józef Piɬsudski – eine Biographie. Berlin (Ch. Links Verlag) 2022, 448 Seiten (Steffen Dietzsch)
- Ulli Kulke: Erwin Wickert, Abenteurer zwischen den Welten – Ein Leben als Diplomat und Schriftsteller, München (LMV) 2021, 400 Seiten (Immo Sennewald)
- Kyle Harper: Fatum – Das Klima und der Untergang des römischen Reiches München (C. H. Beck) 2020, 567 Seiten (Gunter Weißgerber)
- Brendan Simms/Charlie Ladermann: Fünf Tage im Dezember, München (DVA) 2021, 658 Seiten (Gunter Weißgerber)
- Fritz Schmidt / Jürgen Reulecke: Hans Scholl: »Noch nie in meinem Leben war ich so Patriot...« Baunach (Spurbuchverlag) 2021, 93 Seiten (Herbert Ammon)
- Balázs Orbán, Zoltán Szalai (Hgg): Der ungarische Staat. Ein interdisziplinärer Überblick, Wiesbaden (Springer VS) 2021, 511 Seiten (Gunter Weißgerber)
- Wolfgang Huber: Dietrich Bonhoeffer. Auf dem Weg zur Freiheit. Ein Porträt, München (C.H. Beck ) 2019, 336 Seiten (Herbert Ammon)
- Manfred Gailus: Gläubige Zeiten. Religiosität im Dritten Reich. Freiburg im Breisgau (Herder) 2021, 223 Seiten. (Johannes R. Kandel)
- Michael Wolski: 1989 Mauerfall Berlin Auftakt zum Verfall der Sowjetunion, Berlin (Selbstverlag) 2021, 197 Seiten (Wolfgang Rauprich)
- Peter Ruben / Camilla Warnke: Aktenzeichen I/176/58, Strafsache gegen Langer u.a. Ein dunkles Kapitel aus der Geschichte der DDR-Philosophie, Leipzig (Akademische Verlagsanstalt) 2021, 415 Seiten (Steffen Dietzsch)
- Andreas Rödder: 21.0. Eine kurze Geschichte der Gegenwart, München (C.H.Beck) 2016[4], 496 Seiten (Herbert Ammon)
- Ulrich Schödlbauer: Die Grenzen der Welt, Essays – Band 2, Heidelberg (Manutius) 2021, 378 Seiten (Gunter Weißgerber)
- Eric H. Cline: 1177 v. Chr. – Der erste Untergang der Zivilisation, Stuttgart (Konrad Theiss) Stuttgart 2015 (Immo Sennewald)
- Dan Diner: Ein anderer Krieg, München (DVA) 2021, 346 Seiten (Gunter Weißgerber)
- Klaus-Jürgen Bremm: 70/71 – Preußens Triumph über Frankreich und die Folgen Darmstadt (wbg Theiss) 2019, 336 Seiten (Immo Sennewald)
- Jörg Baberowski: Der bedrohte Leviathan. Staat und Revolution in Russland, Berlin (Duncker & Humblot) 2021, 126 Seiten (Herbert Ammon)
- Michael von Cranach, Petra Schweizer-Martinschek, Petra Weber: Später wurde in der Familie darüber nicht gesprochen. Neustadt a.A. (Schmidt) 2020, 102 Seiten (Felicitas Söhner)
- Karl-Heinz Paqué / Richard Schröder, Gespaltene Nation? Einspruch! 30 Jahre Deutsche Einheit, Basel (NZZ Libro) 2020, 289 Seiten (Eckhard Jesse)
- Eckard Holler: Auf der Suche nach der Blauen Blume. Die großen Umwege des legendären Jugendführers Eberhard Koebel (tusk). Eine Biografie, Berlin (LIT Verlag) 2020, 320 Seiten (Herbert Ammon)
- Arbeit und Literatur. Arbeit – Bewegung – Geschichte. Zeitschrift für historische Studien, Heft 2020/II (Mai 2020). 214 Seiten (Holger Czitrich-Stahl)
- Brendan Simms: Hitler Eine globale Biographie, München (DVA) 2019, 1056 Seiten (Gunter Weißgerber)
- Klaus Schroeder/Monika Deutz-Schroeder: Der Kampf ist nicht zu Ende. Geschichte und Aktualität linker Gewalt. Freiburg i. Br. (Herder-Verlag), 2019, 299 Seiten (Johannes R. Kandel)
- Johannes Fried: Die Deutschen. Eine Autobiographie. Aufgezeichnet von Dichtern und Denkern, München (C. H. Beck) 2018, 400 Seiten (Johannes R. Kandel)
- Matthias Braun: Von Menschen und Mikroben. Malaria und Pest in Stalins Sowjetunion 1929–1941. Wiesbaden (Harrassowitz Verlag) 2019. 291 Seiten (Felicitas Söhner)
- Carsten Prien: Rätepartei. Zur Kritik des Sozialistischen Büros. Oskar Negt und Rudi Dutschke. Ein Beitrag zur Organisationsdebatte. Seedorf bei Bad Segeberg (Ousia Lesekreis Verlag) 2019, 190 Seiten (Michael Grewing)
- Tom Strohschneider (Hg.): Eduard Bernstein oder Die Freiheit des Andersdenkenden. Berlin (Karl Dietz Verlag) 2019, 224 Seiten (Holger Czitrich-Stahl)
- Mehr Debatte und Geschichtskultur. »Arbeit – Bewegung – Geschichte« 2019/II (Holger Czitrich-Stahl)
- Dresden 1919: Die Geburt einer neuen Epoche, Freya Klier, Freiburg (Herder) 2018, 483 Seiten (Gunter Weißgerber)
- Christoph Koch (Hg.): Das Potsdamer Abkommen 1945-2015. Rechtliche Bedeutung und historische Auswirkungen, Frankfurt (Peter Lang) 2017, 335 Seiten, (Holger Czitrich-Stahl)
- Rolf Stolz: Generation 1968 – Nachgeburt von 1933?, Marburg (Basilisken-Presse), 2019, 76 Seiten (Herbert Ammon)
- Die RAF hat euch lieb – Die Bundesrepublik im Rausch von 68 – Eine Familie im Zentrum der Bewegung, Bettina Röhl, München (Heyne) 2018, 639 Seiten (Gunter Weißgerber)
- Harry Waibel: Die braune Saat. Antisemitismus und Neonazismus in der DDR. Stuttgart (Schmetterling-Verlag ) 2017, 380 Seiten (Holger Czitrich-Stahl)
- »Alte und neue soziale Bewegungen« – Arbeit - Bewegung - Geschichte 2018/III (Holger Czitrich-Stahl)
- Gunter Weissgerber (Hg.), Rainer Fornahl, Manfred Kolbe, Selbstbewusst. Die Rettung der Leipziger Geodäsie und weitere Meilensteine. Leipzig (Osiris Druck) 2018, 98 Seiten (Ulrich Siebgeber)
- Totengräber der ostdeutschen Wirtschaft? Die Treuhandanstalt und die Folgen ihrer Politik. Kapitel 2 aus: Petra Köpping, »Integriert doch erst mal uns.« Eine Streitschrift für den Osten, Berlin (Ch. Links Verlag) 2018, 208 S. (Richard Schröder)
- Arbeit – Bewegung – Geschichte, Zeitschrift für historische Studien, Themenheft: Zauber der Theorie. Ideengeschichte der Neuen Linken in Westdeutschland Berlin (Metropol Verlag) 2018/II, 240 Seiten (Holger Czitrich-Stahl)
- Siegfried Prokop: »Die DDR hat’s nie gegeben«. Studien zur Geschichte der DDR 1945 bis 1990, Buskow (edition bodoni) 2017, 307 Seiten
- Anke Silomon: Pflugscharen zu Schwertern – Schwerter zu Pflugscharen. Die Potsdamer Garnisonkirche im 20. Jahrhundert, Berlin (Nicolaische Verlagsbuchhandlung) 2014, 201 Seiten
- Matthias Grünzig: Für Deutschtum und Vaterland. Die Potsdamer Garnisonkirche im 20. Jahrhundert, Berlin (Metropol Verlag) 2017, 383 Seiten
- Frank-Lothar Kroll, Totalitäre Profile – Zur Ideologie des Nationalsozialismus und zum Widerstandspotential seiner Gegner, Berlin (Be.Bra Wissenschaft Verlag) 2017, 459 Seiten
- Philipp Kufferath: Peter von Oertzen (1924-2008). Eine politische und intellektuelle Biographie. Göttingen (Wallstein) 2017, 797 Seiten
- Manfred Gailus: Friedrich Weißler. Ein Jurist und bekennender Christ im Widerstand gegen Hitler, Göttingen (Vandenhoeck und Ruprecht) 2017, 316 Seiten
- Günter Benser, Michael Schneider (Hg.): »Bewahren –Verbreiten – Aufklären«. Archivare, Bibliothekare und Sammler der Quellen zur Geschichte der deutschsprachigen Arbeiterbewegung, Bonn-Bad Godesberg 2009, 376 Seiten
- Arbeit – Bewegung - Geschichte. Zeitschrift für historische Studien. Berlin (Metropol Verlag) 2018/1
- Thilo Scholle: Paul Levi. Linkssozialist – Rechtsanwalt – Reichstagsmitglied. Jüdische Miniaturen, Band 206. Hentrich und Hentrich Verlag Berlin 2017
- Günter Benser: Die vertanen Chancen von Wende und Anschluss. Es bleibt eine offene Wunde oder: Warum tickt der Osten anders? Berlin (Verlag am Park in der Edition Ost Verlag ) 2018, 200 Seiten
- Jessica Reinisch: The Perils of Peace: The Public Health Crisis in Occupied Germany. Oxford (University Press) 2013. xii + 324-Seiten
- Stefan Bollinger, Oktoberrevolution. Aufstand gegen den Krieg 1917-1922 / Lenin. Theoretiker, Stratege, marxistischer Realpolitiker
- Martin Stallmann: Die Erfindung von ›1968‹. Der studentische Protest im bundesdeutschen Fernsehen. 1977 – 1998, Göttingen (Wallstein) 2017, 412 Seiten
- Axel Weipert/Salvador Oberhaus/Detlef Nakath/Bernd Hüttner (Hg.): »Maschine zur Brutalisierung der Welt«. Der Erste Weltkrieg – Deutungen und Haltungen 1914 bis heute, Münster 2017 (Verlag Westfälisches Dampfboot), 363 S.
- Arbeit - Bewegung - Geschichte. Zeitschrift für historische Studien, Heft 2017/III
- Hedwig Richter: Moderne Wahlen. Eine Geschichte der Demokratie in Preußen und den USA im 19. Jahrhundert, Hamburg (Hamburger Edition) 2017, 700 Seiten, 70 Abb.,
- Philipp Ammon: Georgien zwischen Eigenstaatlichkeit und russischer Okkupation. Die Wurzeln des russisch-georgischen Konflikts vom 18. Jahrhundert bis zum Ende der ersten georgischen Republik (1921), Frankfurt/M. (Klostermann) 2020, 238 Seiten
- Arbeit - Bewegung - Geschichte. Zeitschrift für historische Studien, 16. Jahrgang Heft 2017/II Berlin (Metropol Verlag) 2017
- Peter Wensierski: Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution: Wie eine Gruppe junger Leipziger die Rebellion in der DDR wagte, München (DVA) 2017, 464 Seiten
- Clara Zetkin – Die Kriegsbriefe, Band 1 (1914-1918), hrsg. von Marga Voigt, Berlin (Karl Dietz Verlag) 2016, 560 Seiten
- Arbeit-Bewegung-Geschichte. Zeitschrift für historische Studien. Heft I/2017, Metropol Verlag, 216 Seiten
- 1945 – Eine »Stunde Null« in den Köpfen? Zur geistigen Situation in Deutschland nach der Befreiung vom Faschismus, hrsg. von Rainer Holze und Marga Voigt, Buskow (edition bodoni) 2016
- Amanda West Lewis: The Pact, Markham, Ontario – Brighton, Mass. (Red Deer Press) 2016, 352 Seiten.
- Silja Behre: Bewegte Erinnerung. Deutungskämpfe um »1968« in deutsch-französischer Perspektive, Tübingen (Mohr Siebeck) 2016, 421 Seiten
- Sven Felix Kellerhoff: Der Reichstagsbrand : die Karriere eines Kriminalfalls, Augsburg (Weltbild Verlag) 2013
- Kerop Bedoukian: The Urchin. An Armenian’s Escape, London (John Murray) 1978, 192 Seiten
- Freya Klier: Wir letzten Kinder Ostpreußens: Zeugen einer vergessenen Generation, Freiburg im Breisgau (Herder) 2014, 458 Seiten
- Die Bündische Jugend
- Zur geschichtsphilosophischen Deutung der Neuzeit
- Zum Jubiläum des Mauerfalls: Drei Sozialdemokraten über die ungeraden Wege zur deutschen Einheit
- Vor und nach »1968«: Die nationalen Unterströmungen in der westdeutschen Neuen Linken
- Bemerkungen zu Bernd Faulenbachs »Das Sozialdemokratische Jahrzehnt«
- Tibet im Kalkül der NS-Außenpolitik und ›Innerasienforschung‹
- Chaim Zhitlowsky
- Weder Ost noch West
- Erhellendes aus dunklen Zeiten: Die Dodds in Berlin
- Der ersehnte dritte Weg
- Tagebuch des Umbruchs – Gorbatschow und die deutsche Frage
- Deutsch-polnische Kontroversen. Der polnische Historiker Tomasz Szarota über Ressentiments und Kernfragen
- Königgrätz, Koblenz, Kreisau: Orte der Moltkes
- Anne Nelson: Die Rote Kapelle
- Ein alter Tory als Mythenzertrümmerer
- Patriotische Dissidenten vor 1989
- »Weder rechts noch links«. Französische Geistesverwandte der Konservativen Revolution
- Sisyphus: Richard Müller
- Implacabilis: Karl Liebknecht