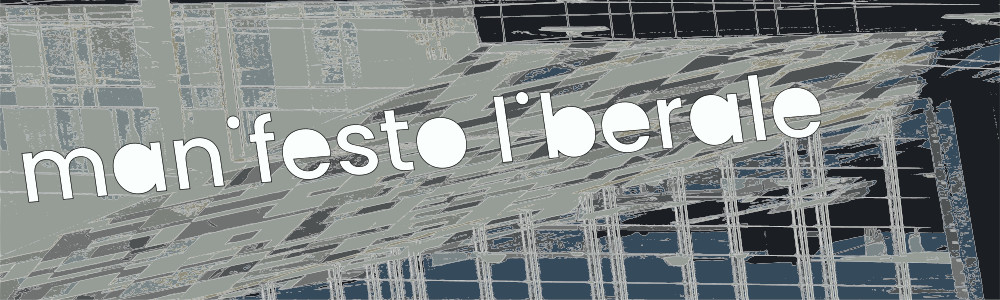von Peter Brandt
Die Geschichtswissenschaft (oder Historik) beschäftigt sich mit sämtlichen Aspekten der Geschichte von Menschen und Menschengruppen mit dem Ziel ständig erweiterter Erkenntnis. Selbstverständlich geht es dabei nicht nur um die Rekonstruktion des Faktischen, sondern auch um dessen Ursachen und Wirkungen, um Zusammenhänge, also um Strukturen und Prozesse. Den methodischen Kern mit dem Anspruch auf relative Objektivität bildet die Kritik (im Hinblick auf ihre Aussagefähigkeit) und Interpretation der zeitgenössischen Originalquellen nach den Regeln des Fachs. Quelle kann alles Überlieferte sein, vorwiegend aber nicht allein das Schriftgut jeder Art. Stets ist vom jeweiligen in der fachwissenschaftlichen Literatur abgebildeten Forschungsstand auszugehen, der durch die eigene Forschung erweitert, u.U. auch korrigiert wird. Welche Quellen herangezogen werden, hat natürlich maßgeblich mit der Themen- und Fragestellung zu tun.
Da die jeweilige Vergangenheit nie mehr total und zweifelsfrei zu rekonstruieren ist, die Quellen meist mehr als eine Deutung zulassen, kommt dem Abwägen und Argumentieren eine wesentliche Bedeutung zu. Die Historik ist somit auch, und u.U. vorrangig, eine Diskussionswissenschaft, die, entstanden als Geisteswissenschaft, sich heutzutage zugleich als historische Gesellschaftswissenschaft (übrigens auch als Bestandteil einer Anthropologie) begreift und auch von anderen Disziplinen analytische Konzepte und Begriffe übernimmt, die sie versucht, mit der historisch vorgegebenen Sprache und Begrifflichkeit in Einklang zu bringen. Mit den in der Öffentlichkeit eingeforderten „Lehren aus der Geschichte“ ist es nicht so einfach, denn welche „Lehren“ gezogen werden könnten, hängt auch vom weltanschaulich-politischen Standort ab; deshalb erwarten wir heute, dass der jeweilige Standort von den Autoren zumindest implizit mit reflektiert wird.
Weiterlesen …