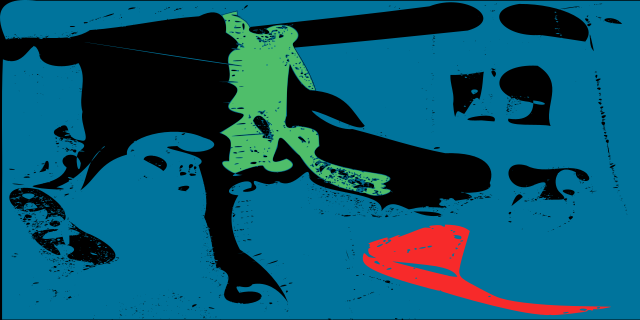von Johannes Eisleben
Die öffentlichen Äußerungen deutscher Politiker und Journalisten zur neuesten Eskalation im Nahostkonflikt sind nicht so recht befriedigend. Einerseits hören wir vom Bedauern über das grausame Massaker, das die Islamisten der Hamas Anfang des letzten Monats verübten und vom Recht des Staats Israel, sich zu verteidigen. Andererseits verurteilen viele Teilnehmer am öffentlichen Diskurs das Vorgehen Israels. Derweil demonstrieren Islamisten in den migrationsintensiven westeuropäischen Ländern überall, teilweise auch gewalttätig, gegen Israel und zweifeln dabei das Existenzrecht des Staates an. Die Kommentare dazu versäumen es, die Ursachen des Konflikts klar darzulegen, nahezu keiner der Texte ist richtig schlüssig, fast niemand äußert sich mit der notwendigen Klarheit zu diesem Konflikt. Auch die alternativen Medien, die sich eindeutig für Israel einsetzen wie achgut.com sind in ihrer Berichterstattung nicht ganz klar.
Woran liegt das?
von Rainer Paris
»Die gefährlichsten Unwahrheiten sind Wahrheiten, mäßig entstellt.« Der Aphorismus Lichtenbergs verweist auf ein aktuelles Problem: Nicht die direkte, gar dreiste Lüge, sondern eine unmittelbar einleuchtende ›einfache‹ Wahrheit vermag oftmals Mobilisierungen anzustoßen, die elementare Dummheiten befördern und verstetigen.
»Kein Mensch ist illegal.« Richtig: Menschen können nicht illegal sein. Illegal können nur Handlungen sein, die Menschen ausführen: Mord, Diebstahl, Hausfriedensbruch. Auch Aufenthalte und Einreisen können illegal sein, wenn sie den Gesetzen des Landes, in dem sie festgestellt werden, widersprechen. Dadurch, dass diese Handlungen als illegal eingestuft werden, werden die Menschen, die sie begehen oder begangen haben, keineswegs illegal. Auch verurteilte Straftäter behalten – von wenigen Ausnahmen abgesehen – die bürgerlichen Ehrenrechte und bleiben Teil des Staatsvolks.
von Max Ludwig
Im angelsächsischen Raum wird das klassische politische Spektrum bei den alternativen Medien von Neomarximus (Grayzone, New Left Review) über bürgerlichen Liberalismus (UKColumn) bis hin zu rechtsradikalen, rassistischen Ultrakonservativen (Unz Review) noch abgebildet, wenn auch nicht immer auf dem höchsten kulturellen Niveau. Dort gibt es spätestens seit der Pseudo-Pandemie in jedem Lager Dissidenten, die den Zustand des Westens alle ähnlich sehen: Wir leben in einer Oligarchie, das Naturrecht wird in Frage gestellt, demokratische Partizipation gibt es nur noch zum Schein, der Rechtsstaat ist schwer beschädigt, die Normensysteme zur Beschränkung staatlicher Gewalt sind erodiert, die Marktwirtschaft ist in weiten Teilen Oligopolen gewichen, die Migration wird als Instrument zur Zerstörung der Nationalstaaten eingesetzt. Großunternehmen des Finanz- und Digitalisierungssektors, aber auch anderer Branchen, bilden mit dem Staat korporative Strukturen aus, die an klassische faschistische Staaten erinnern, was Sheldon Wolin bereits 2010 ›Inverted Totalitarianism‹ genannt hat. Für alle sichtbar etabliere sich, wie schon im klassischen Zeitalter des Totalitarismus, ein Gesinnungsstaat, der Neonormen erlasse und deren Einhaltung mit äußerster Härte einfordere.