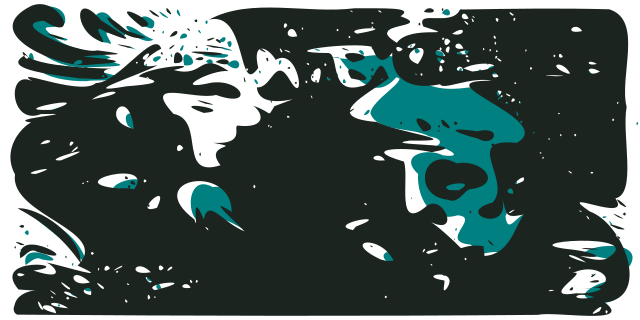von Jobst Landgrebe
Enlightenment (Lichtwerdung) und Siècle des Lumières (Jahrhundert der Lichter) nennen die Engländer und Franzosen das, was wir Deutschen scheinbar nüchterner als Aufklärung bezeichnen. Über diese Phase der Neuzeit ist viel Tinte vergossen und neuerdings Festplattenspeicher gefüllt worden. Was kann man nach Herder, Claudius, Hamann, Kant, Schiller, Hegel, Nietzsche oder Adorno/Horkheimer, Rawls, Habermas oder Koselleck noch dazu sagen, ohne zu langweilen? Angesicht der jüngsten Entwicklung zu einer neuen Phase des Totalitarismus im Abendland, in dem sich die Aufklärung ereignete, einiges.
- Details
- Geschrieben von: Landgrebe Jobst
- Rubrik: Geschichte
von Ulrich Schödlbauer
In einer jüngst gehaltenen Brüsseler Ansprache skizziert der Historiker und bekennende ›Hesperianer‹ David Engels seine Antwort auf die Frage, ob (und warum) ›wir‹ ›unsere Zivilisation‹ anderen vorziehen sollten. Die deutsche Fassung, nachzulesen im Sandwirt, ist insofern bedenkenswert, als sie an gewissen Stellen den Ausdruck ›western civilisation‹ durch den etwas anders konnotierten des ›Abendlandes‹ ersetzt. Das dürfte nicht ohne Absicht des Spenglerianers Engels geschehen sein. Es macht also Sinn – um dem Anglizismus an dieser Stelle die Ehre zu geben –, sich auf der Spur der deutschen Terminologie zu bewegen, und sei es nur deshalb, weil sonst die ganze Fragestellung (ob und warum wir alle nun Patrioten des Westens sein sollten) seltsam flach daherkommt. Western patriotism ist bekanntlich immer dann in Europa angesagt, wenn der amerikanische Freund sich der Loyalität – und Zahlungswilligkeit – seiner europäischen Verbündeten versichern möchte. Ansonsten genügt den USA der US-Patriotismus ebenso wie den Europafreunden in Großbritannien der britische.
- Details
- Geschrieben von: Schödlbauer Ulrich
- Rubrik: Geschichte
Geschichte zwischen Fakten, ›Schwarzen Legenden‹ und Mythen
von Johannes R. Kandel
›Religion‹: ›Gerechter Krieg‹ und ›heiliger Krieg‹?
Eine allgemeine Bemerkung vorweg: Zwar lässt sich die mittelalterliche Geschichte als eine fast ununterbrochene Folge von Krieg beschreiben, aber entgegen manchen Behauptungen war im Nahen Osten zwischen 1095 und 1291 nicht immer Krieg. Der französische Historiker Jean Richard hat errechnet, dass es von 1192 bis 1291 – in der unruhigsten Phase der Lateinischen Königreiche – immerhin 80 Friedensjahre gegeben hatte. Im Vergleich dazu gab es im französischen 17. Jahrhundert nur 21 Jahre ohne wichtige Kriegshandlungen und nur 7 Jahre völligen Friedens (Die Kreuzzüge in Augenzeugenberichten, 19722, S. 18.). Es gab längere Phasen von Waffenstillständen, allerdings keine dauerhaften ›Friedensverträge‹. Ein klassischer Fall für eine friedliche Übereinkunft war der Vertrag, den Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen am 18. Februar 1229 in Jaffa mit dem ägyptischen Sultan Al-Malik Al-Kamil schloss. Der Vertrag sah die Rückgabe von Jerusalem und dem unmittelbaren Umland an die Kreuzfahrer und einen zehnjährigen Waffenstillstand vor. Bei den Christen stießen diese Vereinbarungen auf nur verhaltene Freude, während die Muslime trauerten: »Die ganze islamische Welt war tief getroffen und trauerte um den Verlust Jerusalems«, schrieb der Chronist Ibn Wāsil (Die Kreuzzüge aus arabischer Sicht, 1973, S. 328ff.). Die ruhigen Phasen nutzten beide Seiten für Sicherungsmaßnahmen (Festungsbau, Verstärkung von Stadtmauern, etc.) und Aufrüstung für die nächsten Kämpfe (Kriegstechnik, Rekrutierung neuer Truppen). Al-Kamil war schon vorher mehrfach zu Zugeständnissen bereit gewesen, insbesondere als der Fünfte Kreuzzug 1218-1221 Ägypten bedrängte und er zu dieser Zeit mit innerislamischen Kämpfen zu tun hatte. Es war somit keineswegs sein generöser Friedenswille, der ihn veranlasste, Friedenstauben aufsteigen zu lassen. Die Kreuzfahrer hatten alle Angebote zurückgewiesen, weil sie ihren strategischen Zielen zuwiderliefen. (Tyerman, God’s War, 2007, S. 639).
- Details
- Geschrieben von: Kandel Johannes R.
- Rubrik: Geschichte
- Die Kreuzzüge
- Sozialismus am Ende? Metamorphosen der deutschen Linken nach 1989
- In die Wüste. Eine Wegbeschreibung
- Die frühe Neuzeit
- Die Nation – immer noch ein Gegenstand der Politik für die Linke in Deutschland?
- Was ist eigentlich das Volk?
- 100 Jahre »Hoher Meißner«
- »Aufbruch der Jugend« - aber wohin?
- Die Beziehungen der Bundesrepublik und der DDR mit Israel
- Die linke Neuformierung 1954/55 und ihr Scheitern 1957/58
- Geglückte Geschichtsschreibung?
- Judentum und Sozialdemokratie: Moses Hess – Karl Marx – Ferdinand Lassalle – Eduard Bernstein
- Grundlegung der Moderne
- Soziale Rechte im globalisierten Kapitalismus
- Vom Ursprung des Kapitalismus
- Neue Institutionen, alte Ideen: Der kurze Augenblick des Europäischen Sozialmodells
- Der Wandel der deutsch-polnischen Beziehungen im geschichtlichen Rückblick
- Die deutsch-polnischen Beziehungen bis 1990
- Die deutsche Revolution 1848/49
- Die Arbeiterbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts. Entwicklung – Wirkung – Perspektive
- Die Hauptstadtfrage in der deutschen Geschichte
- Der historische Ort der deutschen Revolution von 1918/19
- Die ›Globalisierung‹ in historischer Perspektive. Eine essayistische Deutung der Weltgeschichte der Neuzeit
- Vor 90 Jahren - Ex Oriente Lux?
- Die deutsche Einigung in historischer Perspektive