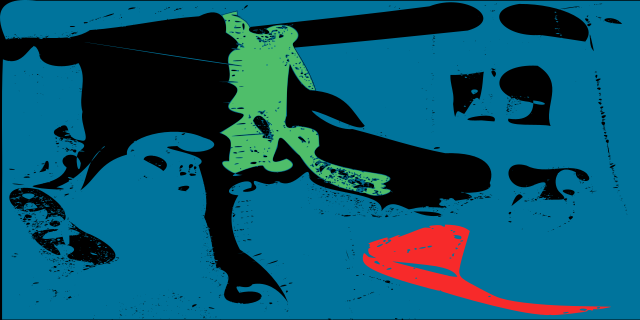von Peter Brandt
Soll die Linke – hier nicht als Parteinamen gemeint – mit der Nation Politik machen? So lautete die mir im Vorfeld der Konferenz gestellte Frage. Man könnte diese so missverstehen als stünde es im Belieben der politischen Subjekte, das Nationale zu thematisieren oder es bleiben zu lassen. Dem ist, wie im Folgenden argumentiert werden soll, eben nicht so. Überall, wo die wie immer definierte Linke Einfluss erlangte und – sei es auch in fundamentaler Opposition – politisch intervenierte, kam sie an dem Problem der Nation nicht vorbei. Auch heutzutage, in der Epoche marktkapitalistischer Globalisierung, einschließlich des Subprozesses der Europäisierung, weltweiter Migration und der durch beide Entwicklungen bewirkten Schwächung des Nationalstaats, so meine zentrale These, führt die abstrakte Gegenüberstellung einer internationalen und einer nationalen Orientierung, die abstrakte Negation der Nation aus dem Geist des Internationalismus nicht weiter.
Vielmehr geht es wie seit jeher darum, den gesellschaftspolitischen Status quo zu verteidigenden, dem tendenziell exklusiven und nationalantagonistischen Nationsverständnis der bürgerlichen Rechten ein demokratisches, sozial inklusives, weltbürgerlich offenes und kooperatives Nationsverständnis entgegenzusetzen und stetig darum zu ringen, welche Werte das jeweilige Nationalempfinden und Nationalbewusstsein (= Bewusstsein der Bedeutung des spezifisch Nationalen) dominieren sollen. Dass das gerade bei einem so komplexen Problemfeld wie dem der Nation nicht immer in einer ganz klaren Gefechtsordnung geschieht, liegt auf der Hand, doch macht das keinen grundsätzlichen Unterschied zu anderen politisch relevanten Dimensionen der Wirklichkeit aus.
Die erste wichtige Feststellung muss somit lauten: Der Begriff der Nation bildet einen Teil der Realität ab, und zwar handelt es sich dabei um eine Gemeinschaft, die unter Weltmarktbedingungen zwischen Gesellschaft, Staat und Ethnie angesiedelt ist - mit Überschneidungen zu allen diesen sozialen Phänomenen, ohne mit einem davon identisch zu sein. Auch das ethnische "Volkstum" ist nicht ursprünglich biologisch, sondern hauptsächlich sozial und kulturell zu verstehen. Die überzeitliche Abstammungsgemeinschaft als "Volkssubstanz" wurde von den frühen nationalen Ideologen und den Romantikern in das Mittelalter und die Vorzeit zurückimaginiert. Die Nation ist also nichts Ewiges, sondern ein Ergebnis der Geschichte, zumal der letzten zweieinhalb Jahrhunderte, und mag in ferner Zukunft tatsächlich irgendwann verschwinden.
Die modernen Nationen, die sich zuerst in Westeuropa auf dem Territorium der frühneuzeitlichen protonationalen Monarchien herauszubilden begannen, gehörten zur neuen, nachständischen Gesellschaft bürgerlich-kapitalistischen Charakters. Obwohl ökonomische Ungleichheit, jetzt als Klassenantagonismus und Schichtendifferenzierung, fortbestand, resultierte die soziale Transformation von der feudal-ständischen zur bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft in einer relativen Homogenisierung der Lebensverhältnisse. Dies geschah durch rechtliche Befreiung der Agrarbevölkerung, Gewerbefreiheit, Industrialisierung und Urbanisierung, die Ausweitung des Binnenhandels mittels Aufhebung von Zollschranken, also Schaffung eines Binnenmarkts, sowie die Erleichterung des Reisens wie des Güteraustauschs mittels besserer Straßen und Kanäle, dann besonders mittels der Eisenbahn, durch die Telegraphie, durch Alphabetisierung, Schul- und Wehrpflicht, nicht zuletzt auch durch ein in zähem Kampf sukzessive erweitertes Wahlrecht im Rahmen der Konstitutionalisierung der politischen Ordnung, ferner durch die Schaffung einer über bestimmte Symbole, Bildende Kunst, Literatur und Musik, namentlich den Gesang, vermittelten neuen nationalen Kultur. Dabei spielten nicht allein, aber besonders hierzulande die "Leserevolution", die Universitäten und Gymnasien sowie das seit dem 18. Jahrhundert immer breiter gefächerte Vereinswesen eine herausragende Rolle.
Es war zu Beginn des Formierungsprozesses der Nationen vor allem dem Interesse kleiner Zirkel Gebildeter - einer kulturellen Gegenelite gegen die höfisch-aristokratische Welt - an Sprache, Geschichte, Literatur, Musik und Volkskunde geschuldet, dass die Elemente der neuen, gleichsam synthetischen, doch nicht willkürlich konstruierten kulturellen Identität den neuen Nationen in statu nascendi zur Verfügung standen. Dabei kam der "Muttersprache" eine herausragende Rolle zu. Wo die Nationsbildung im Gehäuse bereits etablierter Staaten stattfand, konnte die Zentralgewalt, zumal dann, wenn sie sich als eine nationale verstand, die sprachliche Unifizierung, vor allem über Volksschule und Armee, von oben vorantreiben. In Frankreich stellten die Revolutionäre 1794 in einer Untersuchung fest, dass nicht viel mehr als ein Zehntel der "Franzosen" die um Paris und in den zentralstaatlichen Institutionen benutzte Sprache beherrschte. Das Parlament des 1860/61 aus diversen Klein- und Mittelstaaten gebildeten Königreichs Italien konnte sich anfangs sogar nur auf Französisch verständigen. In Deutschland, wo der einheitliche Nationalstaat ein Jahrzehnt später entstand, hatte die bürgerliche Intelligenz schon seit dem 18. Jahrhundert an der deutschen Hochsprache gearbeitet: in doppelter Stoßrichtung gegen die französischsprachige Kultur der Höfe und die dialektsprachige bäuerlich-plebejische Kultur.
Damit die soziale und kulturelle Nationsbildung durch eine Nationalstaatsbildung ergänzt werden konnte, waren kollektive politische Akte vonnöten wie Unabhängigkeits- bzw. Bürgerkriege und/oder Verfassungsrevolutionen. Klassische Beispiele für beides sind - nach frühneuzeitlichen Vorläufern wie den Niederlanden - die USA seit den 1770er Jahren und, näher liegend, Frankreich ab 1789. Gern stellt man den "westlichen" Begriff der Staatsbürgernation der deutschen und osteuropäischen Ethno-Nation (oder, nicht ganz identisch, "Kulturnation") gegenüber. In der historischen Wirklichkeit des 19. Jahrhunderts waren weder die westlichen Nationalstaaten in ihrem Selbstverständnis frei von der kulturellen und historischen Anbindung, noch beschränkte sich umgekehrt das deutsche, polnische usw. Nationsverständnis auf die Abgrenzung nach außen und eine ethnisch-kulturelle Herleitung. Vielmehr war namentlich die deutsche Nationalbewegung, die nach der Befreiung von der napoleonischen Hegemonie 1813/14 vor allem als Einigungsbewegung in Erscheinung trat, eng mit den zeitgleichen liberal-demokratischen Emanzipationsbestrebungen verbunden. Es waren im Wesentlichen dieselben Ideen und dieselben Menschen, die man, je nach Perspektive, der Nationalbewegung oder der liberalen bzw. demokratischen "Bewegungspartei" zurechnen konnte. Nicht zuletzt deshalb führt es in die Irre, das Kaiserreich von 1871 einseitig als reaktionären Fürstenbund darzustellen, denn die Bismarck'sche "Revolution von oben" war nur möglich auf der Basis eines vorangegangenen, Jahrzehnte langen gesellschaftlichen Nationsbildungsprozess und der Vorarbeit der liberal-nationalen und national-demokratischen politischen Kräfte. Auch die frühe Arbeiterbewegung beider Richtungen, die die nationale Einigung von unten auf ihre Fahnen geschrieben hatte, war Teil dieses Prozesses, der im Ergebnis auch Manches mit sich brachte, das die junkerlichen und monarchisch-bürokratischen Kräfte lange bekämpft hatten, so ein im internationalen Vergleich ungewöhnlich fortschrittliches Wahlrecht, zumindest auf Reichsebene (allgemein und gleich für Männer ab 25).
Während die Nationsbildung im 18. und 19. Jahrhundert Teil der Entstehung eines bürgerlichen Hegemoniesystems war, enthielt sie - wie die sukzessive Durchsetzung von Verfassungsstaatlichkeit, mit der sie eng verbunden war - eine universelle, über die Klassengesellschaft hinausweisende Botschaft: nämlich die proklamierte Gleichheit der Staatsbürger nicht auf die Rechtssphäre zu begrenzen und die von der nationalen Kulturgemeinschaft faktisch ausgeschlossenen Massen der Arbeiter und Bauern in diese einzubeziehen. Nimmt man hinzu, dass sich die europäischen Nationalbewegungen der 20er bis 40er Jahre des 19. Jahrhunderts in einer gemeinsamen Frontstellung gegen die restaurative Staatenordnung des Wiener Kongresses, des Systems der monarchischen "Legitimität" und der "Solidarität der Mächte", sahen, wie sie sich in der Unterstützung des Befreiungskampfes der Griechen und Polen gerade in Deutschland ausdrückte, dann werden die Umrisse eines popular-demokratischen und gewissermaßen internationalistischen Nationsverständnisses sichtbar, dessen Erbe die sozialistische Arbeiterbewegung werden sollte. (Wahr ist allerdings auch, dass die nationalen Probleme von Anfang an viel konfliktträchtiger waren als die zugleich patriotischen und weltbürgerlichen Demokraten der 1830er- und 1840er Jahre angenommen hatten. Das zeigte sich schon 1848 in den europäischen Revolutionen als teilweise die liberalen Nationalbewegungen aneinandergerieten, so etwa in Schleswig die dänische und die deutsche.) Die Übernahme der 1848er Tradition durch die deutsche Sozialdemokratie des Kaiserreichs war ein Ausdruck davon. Die Feier des 18. März diente der Erinnerung sowohl an die Berliner Barrikadenkämpfe von 1848 als auch an die Pariser Commune von 1871.
Inzwischen nahm der Nationalgedanke - in der Phase des Übergangs zum Imperialismus - im bürgerlichen Spektrum mehr und mehr chauvinistische, expansionistische und militaristische Züge an, nicht nur in Deutschland. Die großagrarischen Konservativen Preußens, die ursprünglich gesamtdeutsch-nationalen Zielen ablehnend gegenüber gestanden hatten, versuchten seit den 1870er Jahren nicht ohne Erfolg, die Idee der Nation zu adoptieren und gewissermaßen antidemokratisch neu zu artikulieren. Die Hauptformation des etablierten Nationalismus blieb die großbürgerlich-rechtsliberale Partei der Nationalliberalen. Der affirmative liberal-konservative Reichsnationalismus blieb insgesamt vorherrschend, geriet aber zunehmend unter Druck seitens einer aggressiven, auch von schwerindustriellen und junkerlichen Interessen gespeisten "nationalen" (sprich: alldeutschen) Opposition. Dazu traten als Ferment der Radikalisierung des rechten Nationalismus ein - zunächst meist noch spirituell gedeutetes - "völkisches", betont antisemitisches Denken, an das später die Nationalsozialisten anknüpfen konnten; im rassistischen Blutsmaterialismus der SS wurden letztlich die historisch entstandenen Nationen (implizit einschließlich der deutschen) infrage gestellt. Das gilt nicht nur für die politische Selbstbestimmung, sondern auch für die kulturelle Spezifik und deren Eigenwert.
Die Sozialdemokratie akzeptierte das Bismarckreich notgedrungen als relativen Fortschritt und Kampfboden. Das Verhältnis zur Nation und zum deutschen Nationalstaat - ich meine nicht die bestehende Staats- und Gesellschaftsordnung, gegen die fundamental opponiert wurde - war zwiespältig. Einerseits tendierte die SPD dazu, auf einen formellen Internationalismus auszuweichen, dessen Kehrseite die Bagatellisierung konkreter nationaler Fragen war, etwa der der polnischen Minderheit. Andererseits gab es diverse Stimmen aus unterschiedlichen Parteiflügeln, die vor einer Vernachlässigung des nationalen Faktors warnten. Zu ihnen gehörte Eduard Bernstein, der Vater des Revisionismus, aber auch ein Mann wie der Parteilinke Georg Ledebour, der in der SPD wegen seines Eintretens für die Rechte der Polen, den Spitznamen "Ledeburski" erhielt. Ledebour attackierte anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der antinapoleonischen Erhebung von 1813 im Reichstag die Herrschenden, aber auch deswegen, weil sie die freiheitlichen Traditionen der antinapoleonischen Patrioten missbrauchen würden.
Jedenfalls wäre es unzutreffend, von einem allgemeinen nationalen Nihilismus oder einer nationalen Indifferenz der klassischen Sozialdemokratie auszugehen. Bei allem menschenrechtsorientierten Universalismus und dem Bekenntnis zum proletarischen Internationalismus war die SPD doch auch bewusst eine deutsche Partei, gemessen an den Wertbezügen und den politisch-kulturellen Grundmustern, die sie geprägt hatten. Mehr noch: Parallel zu dem, was ich formellen Internationalismus nenne, bildete sich in den 1880er Jahren (der Zeit des Sozialistengesetzes) unter dem maßgeblichen Einfluss von Friedrich Engels ein sozialdemokratischer Vaterlandsbegriff endgültig heraus. Das geschah unter dem Eindruck der zunehmenden außenpolitischen Gefährdung des Reiches. Zwei Faktoren waren für seine Entstehung entscheidend: das Konzept eines Verteidigungskrieges sowie revolutionsstrategische Erwägungen im internationalen Rahmen.
Der sozialdemokratische Vaterlands- oder Nationsbegriff antizipierte einerseits das angestrebte sozial, ökonomisch und politisch ideal verfasste Gemeinwesen, den "Zukunftsstaat". Andererseits stellte er den Anspruch der herrschenden Eliten und des Bürgertums infrage, sich unter Ausschließung der sozialdemokratischen Arbeiterschaft als alleinige Vertreter des 1871 gegründeten Nationalstaats zu begreifen. Die Nation, das Vaterland, verkörperte in den Augen der Führer der deutschen Sozialdemokratie die geographische und gesellschaftspolitische Basis der Revolution (die längst nicht mehr als bewaffneter Aufstand gedacht wurde). Aus dieser Perspektive musste das Vaterland gegen jeden Angriff von außen verteidigt werden. Eine solche Auffassung konnte sich auch dann noch halten, als seit der zweiten Hälfte der 1890er Jahre die revolutionäre Naherwartung allmählich verblasste und meist durch eine Art revolutionären Vorbehalts ersetzt wurde. Die SPD würde das Deutsche Reich auch als ihr Vaterland beschützen, so August Bebel wiederholt, doch nicht den Herrschenden zuliebe, sondern Ihnen "zum Trotz"!
Angesichts alles dessen ist es nicht ganz so erstaunlich, dass die deutsche Sozialdemokratie und mit ihr die große Mehrheit der Arbeiterparteien und Gewerkschaften der kriegführenden Länder, darunter etliche dezidierte Internationalisten, im August 1914 auf die Seite der den Krieg eröffnenden Regierungen trat und die Kriegsanstrengungen lange unterstützte. Hingegen gehörte der erwähnte Georg Ledebour zusammen mit Eduard Bernstein, Karl Kautsky, dem einflussreichsten Parteitheoretiker, und Hugo Haase, dem SPD-Fraktionsvorsitzenden im Reichstag und Mitvorsitzenden der Partei, zu denen, die sich in Deutschland schon bald gegen die "Politik des 4. August" stellten - zeitversetzt gegenüber Karl Liebknecht und der äußersten Linken und weniger radikal als diese. Es wird häufig übersehen, dass nicht das Prinzip der Landesverteidigung als solches oder gar die pauschale Gegenüberstellung einer nationalen und einer internationalen Einstellung war, die die deutschen Sozialdemokraten nach 1914 auseinander trieben und schließlich zur organisatorischen Spaltung führten, sondern die mit der Entscheidung über die Kriegskredite faktisch (wenn auch nicht logisch zwingend) verbundene Politik des "Burgfriedens", des Verzichts auf Opposition gegen das herrschende System im Krieg. Auch gab es gerade am Anfang nicht nur Befürworter und Gegner der mehrheitssozialdemokratischen Kriegspolitik, sondern diverse Zwischen- und Unterpositionen.
Offensichtlich ist, dass die von Friedrich Ebert personifizierte Politik der Revolutionsbegrenzung und -bekämpfung 1918/19 im "Burgfrieden" der Kriegsjahre ihre ideologischen und psychologischen Wurzeln hatte. Herausgefordert von einer seit 1920 starken, wenn auch minoritären Kommunistischen Partei mit ihrer Orientierung auf die unmittelbare proletarisch-sozialistische Revolution und bedrängt von einer gleichzeitig an Gewicht zunehmenden gegenrevolutionär-"deutschnationalen" Rechten, sowie angesichts einer krisenhaften Ökonomie und des inhaltlich von allen deutschen Parteien abgelehnten Friedensvertrags von Versailles, gelang es den Sozialdemokraten und Linksliberalen, den vorrangigen Verteidigern der Weimarer Demokratie nicht, ihre Vorstellung von einem republikanischen, die freiheitlichen Traditionen der deutschen Geschichte anrufenden Patriotismus gegen den nicht nur in den Spitzen des Bürgertums dominierenden antidemokratischen, teils latent, teils explizit völkischen Nationalismus durchzusetzen.
Wenn es auch - vom Generalstreik gegen den Kapp-Putsch über die Protestaktionen gegen die Morde an Erzberger und Rathenau bis zum Volksentscheid über die Fürstenenteignung eindrückliche Beispiele einer noch über die geeinte Arbeiterbewegung hinausreichenden linksrepublikanischen Massenmobilisierung gab, so bestand das Problem darin, dass auch viele entschiedene Republikaner, namentlich Sozialdemokraten, sich schwer damit taten, den Weimarer Staat ohne Wenn und Aber als den ihren anzuerkennen: wegen der sozialen Herrschaftsverhältnisse aufgrund der Fortdauer der kapitalistischen Produktionsverhältnisse und speziell wegen des andauernden, wenn auch verringerten Einflusses der alten agrarischen, schwerindustriellen, militärischen und bürokratischen Eliten. Dabei betonte etwa der Staatsrechtler Hermann Heller, der die Nation als eine über die bürgerlich-kapitalistische Ordnung hinausweisende Werte - und Kulturgemeinschaft betrachtete, zu recht die gesellschaftspolitische Offenheit der Weimarer Reichsverfassung. Die Vertreter des sozialdemokratischen Patriotismus wie Heller benannten den entscheidenden Unterschied eines demokratischen Nations- und Volksbegriffs zu allen organologischen Konzepten, wenn sie klarstellten, dass die relative natürliche oder kulturelle Einheitlichkeit der Gebietsbewohner an sich niemals schon die Einheit des nationalen Staates ausmachten. Diese sei letztlich immer nur als das Ergebnis bewusster menschlicher Einheitsbildung zu begreifen.
In der Außenpolitik trat die SPD, anders als die an der Sowjetunion orientierte KPD, im Sinne eines verantwortungsbewussten, gegen das vorherrschende nationalistische Klima gerichteten Patriotismus für eine längerfristige angelegte Verständigungspolitik mit den Siegern des Ersten Weltkriegs ein. Es ging ihr darum, die internationalen Beziehungen auf qualitativ neue Grundlagen zu stellen, wirtschaftlich und politisch feste Zusammenarbeitsstrukturen, eine internationale Schiedsgerichtsbarkeit, internationale Abrüstung usw. durchzusetzen. Kein im eigentlichen Sinn sozialistische Programm, aber faktisch konsequent nur von sozialistischen Parteien vertreten, teilweise in Zusammenarbeit mit Kräften des bürgerlichen Spektrums, so - in Deutschland - mit exportorientierten Industriegruppen, den liberalen Parteien und dem katholischen Zentrum sowie mit Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes.
Der, anfangs in seiner epochalen Bedeutung noch nicht voll erfasste, Sieg der NSDAP 1933 führte vor allem im sozialdemokratischen (im Zuge der Volksfrontpolitik dann auch im kommunistischen) Exil zu einer intensiven Beschäftigung mit der nationalen Frage Deutschlands. Dem völkischen Konzept stellte man die kollektive Selbstbestimmung nach außen und innen als Kern eines demokratischen Begriffs von Nation gegenüber, womit man an Positionen der Sozialdemokratie vor 1914 und nach 1918 anknüpfte. Wie keine andere soziale und politische Kraft hat sich die sozialistische Linke beider Hauptrichtungen im antifaschistischen Kampf und im Leiden als Vertreterin des "anderen Deutschland" legitimiert. Wenngleich der konservative Widerstand für das NS-Regime wegen seiner Verankerung in den gesellschaftlichen Eliten - für die Kriegssituation letztlich entscheidend in Teilen des Offizierskorps - kurzfristig gefährlicher war, so repräsentierte die Linke die Kontinuität des Widerstands.
Moralisch mochte die Gesamtlinke trotz des Scheiterns der Selbstbefreiung gestärkt dastehen, nachdem der Hitlerfaschismus besiegt war; aber Zehntausende ihrer Kader waren ermordet, umgekommen oder gesundheitlich ruiniert. Zudem war die Aufklärungs- und Organisationsarbeit von Jahrzehnten zunichtegemacht worden. Tatsächlich gelang es den Arbeiterorganisationen nicht wieder, erneut die Wurzeln zu schlagen, die ihr gekappt worden waren, auch wenn sie beachtlichen Zulauf von Mitgliedern und Wählern verbuchen konnten.
Wenn die Linke, die gemeinschaftsstiftende Kraft schlechthin in der Zusammenbruchsgesellschaft des Jahres 1945, die selbst gestellte Aufgabe nicht lösen konnte, die deutsche Nation auf antifaschistischer Grundlage neu zu konstituieren, dann lag das - neben den sozial äußerst komplizierten, nicht allein auf das materielle Elend zu reduzierenden Handlungsbedingungen der ersten Nachkriegsjahre und der Viermächte-Kontrolle, sprich: Besatzungsherrschaft über das deutsche Territorium - auch an dem schon deutlich vor dem offenen Konflikt zwischen den Hauptsiegermächten sich reproduzierenden sozialdemokratisch-kommunistischen Schisma, das mit der unter massivem Druck erfolgenden SED-Gründung in der Sowjetzone gewissermaßen geographisch verfestigt wurde.
So war der Vertrauenskredit, mit dem die Linke 1945 ins politische Leben des besetzten Deutschland zurückkehrte, mit Hypotheken belastet, die in dem Maße anwuchsen, in welchem im Bewusstsein der Bevölkerung das Erschrecken über das Ausmaß der NS-Verbrechen vor der alltäglichen Empfindung neu erfahrenen Unrechts und von außen auferlegter Not zurückwich. Im Westen wählten die neuen politischen Akteure zudem überwiegend den Weg in einen entschiedenen Antikommunismus, den ihnen der aufbrechende Kalte Krieg nahe legte. Der mörderische Vernichtungsfeldzug gegen die Sowjetunion wurde weitgehend verdrängt, ebenso die Mitverantwortung der Westmächte für die die Gebietsverluste im Osten besiegelnden Vertreibungen. Hinzu kamen die Erfahrung namentlich anfangs brutaler Besatzungsrealität in der sowjetischen Zone.
Die staatliche Teilung Deutschlands wäre zwar ohne den Aggressionskrieg des Großdeutschen Reiches nicht möglich gewesen, aber sie war keineswegs, wie heute vielfach angenommen,eine nach einem gemeinsamen Plan von den vier Besatzungsmächten verhängte Strafe. (Straf- und Sicherheitsmaßnahmen bezogen sich auf die neue Grenzziehung und die Aussiedlung im Osten, die "Entnazifizierung" und Reparationen.) Die Teilung ergab sich vielmehr daraus, dass die Hauptsiegermächte nicht bzw. nicht mehr imstande waren, eine gemeinsame Politik in und gegenüber Deutschland zu formulieren und durchzuführen. Erst sehr viel später ist es in manchen Kreisen der deutschen Linken üblich geworden, in der Teilung Deutschlands die verdiente Quittung für "Auschwitz" zu sehen.
Von der Frage der Oder-Neiße-Grenze abgesehen, hielten die relevanten Kräfte ganz Deutschlands bis in die zweite Hälfte der 1960er Jahre zumindest deklamatorisch am Ziel der deutschen Einheit fest, wenn sich auch die Vorstellungen über den politisch-sozialen Charakter des einheitlichen Deutschland und über den Weg dorthin wesentlich unterschieden. Die großen westdeutschen Kampagnen der 1950er Jahre gegen die Remilitarisierung und die Atombewaffnung im Rahmen der Westintegration wurden nicht zuletzt mit nationalen Argumenten geführt. Die gänzliche Abwendung vieler Progressiver von der nationalen Thematik ist erst die Tat einer späteren, "bundesrepublikanisch"-westeuropäisch sozialisierten Generation.
Es war nicht vorwiegend Sentimentalität oder "Deutschtümelei", die in der Nachkriegszeit besonders die Sozialdemokratie die Einheit Deutschlands ins Zentrum rücken ließ. Die Teilung Deutschlands hatte gesellschaftspolitisch ja vor allem die Folge, in beiden Staaten die Kräfte der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung auszuschalten. Das ist von der SPD etwa im Zusammenhang mit dem Aufstand des 17. Juni 1953 schmerzhaft empfunden und mehr oder weniger deutlich artikuliert worden. Die Ost-SPD war in der SED aufgegangen, deren Führung sozialdemokratische und oppositionell-kommunistische Ansätze mit Rückendeckung der sowjetischen Besatzungsmacht niederhalten konnte, und die Anschauung des Experiments DDR stabilisierte im Westen Deutschlands den Bürgerblock, während die SPD ihrer alten Hochburgen im ostelbischen Deutschland beraubt war. Die Vorherrschaft der CDU/CSU in den Westzonen bzw. der Bundesrepublik seit 1947/48 ist ohne die nationale Spaltung so wenig zu erklären wie die besondere Ausformung des Herrschaftssystems in der SBZ/DDR. Dort hofften viele SED-Mitglieder bis in die oberste Führung auf die Befreiung aus der offenkundigen Abhängigkeit von der Sowjetarmee durch eine Aufhebung der deutschen Teilung, sofern sie nicht einfach auf eine Kapitulation der östlichen Seite hinausgelaufen wäre.
Jede größere politische Aktion in einem der beiden Staaten hatte fast automatisch eine gesamtdeutsche Dimension; das war lange so selbstverständlich, dass man sich kaum die Mühe machte, diesen Zusammenhang systematisch zu begründen. Sozialdemokraten wie Einheitssozialisten betrachteten die Teilung als provisorisch und propagierten - in Verbindung mit unterschiedlichen, ja gegensätzlichen verfassungspolitischen Zielen - deren Aufhebung als ein zentrales Ziel, auch nachdem mit der zweiten Spaltung Deutschlands durch den Mauerbau und das Einschwenken der SPD auf die (auch militärische) Westintegration der Bundesrepublik der Spielraum für alternative Entwicklungen, etwa durch ein Auseinanderrücken der Militärblöcke in Mitteleuropa, kleiner geworden war.
Logischerweise wurde die theoretisch-konzeptionelle Auseinandersetzung mit der nationalen Frage in der DDR als dem nicht nur materiell, sondern auch in seiner nationalen Legitimität schwächeren Staat intensiver betrieben als in der Bundesrepublik, einschließlich der westdeutschen Sozialdemokratie. Das änderte sich auch nicht grundlegend mit dem Übergang zur sozial-liberalen Entspannungspolitik, die die langjährige Position der DDR von zwei Staaten in einer Nation aufgriff und ihren Vorstellungen einer europäischen Friedensordnung zugrunde legte, wobei eine langfristige Neuvereinigung Deutschlands weiterhin angestrebt, aber nicht mehr als Voraussetzung von zwischenstaatlicher Verständigung und immer engerer Kooperation gefordert wurde. In Abwehr dieser vermeintlichen "Aggression auf Filzlatschen" (Otto Winzer) entdeckte die SED-Führung die DDR als eigene sozialistische Nation, die sich von der bürgerlichen Rest-Nation in Westdeutschland losgelöst hätte.
Auch die Zwei-Nationen-Doktrin - und besonders diese - verlangte nach gedanklicher und kultureller Fundierung. Paradoxerweise ermöglichte sie es - nach einer Phase besonders penetranter Betonung der Verbundenheit mit der Sowjetunion - den Historikern und Kulturwissenschaftlern der DDR, mit der Unterscheidung von "Tradition" und "Erbe" sowie dem Konzept der Erbeaneignung einen stärker ganzheitlichen Bezug zur nationalen Geschichte herzustellen. Auch dieser Umweg eröffnete letztlich wieder eine gesamtdeutsche kulturelle Perspektive - und das in einer Phase, da die beiden Staaten sich anschickten, durch eine Art doppeldeutscher Dämpfungspolitik der in den frühen 1980er Jahren drohenden Wiederbelebung des Kalten Krieges entgegenzuwirken, und gleichzeitig die DDR von der Bundesrepublik ökonomisch immer abhängiger wurde.
Alles das heißt nicht, dass es nicht Tendenzen zur Erweiterung der Zweistaatlichkeit zur Bi-Nationalisierung gegeben hätte - bewusstseinsmäßig wohl sogar stärker in West- als in Ostdeutschland -, doch standen dem andere Tendenzen entgegen, so etwa die durch die Vertragspolitik ermöglichte erneute Intensivierung deutsch-deutscher Kommunikation über die Staatsgrenze hinweg, zumindest seitens einer für die Meinungsbildung wichtigen Minderheit. Auch war es irreführend, in bundesdeutschen Meinungsumfragen ermittelte, auf weitere Auseinanderentwicklung deutende Trends einfach fortzuschreiben. Sie unterlagen durchaus der politischen Konjunktur - abgesehen davon, dass die Zustimmung zur Wiederherstellung der deutschen Einheit im Grundsatz langfristig ziemlich stabil blieb, wobei die diesbezügliche Erwartung schon im Verlauf der 60er Jahre deutlich abnahm.
Während der bundesdeutschen Debatte über die Stationierung neuer atomarer Mittelstreckenraketen zu Beginn der 1980er Jahre hatte es zeitweilig so ausgesehen, als würde es gelingen, die in der sozialdemokratischen Deutschlandpolitik seit jeher angelegten Verbindung von Friedenssehnsucht und deutscher Frage zu erneuern. Im Unterschied zu den 1950er Jahren war jetzt nicht mehr der Wunsch nach Vereinigung Deutschlands ein herausragendes Motiv für das Engagement gegen die Aufrüstung, sondern das Engagement in der Friedensbewegung ließ eine große Zahl Menschen erstmals wieder die prekäre geostrategische Lage Deutschlands in der Ost-West-Konfrontation und die auch im Westen lange tabuisierten Statusfragen (alliierte Stationierungs- und Vorgehaltsrechte) erkennen. Die teils beabsichtigte, teils indirekte Wechselwirkung mit den im Osten Deutschlands entstehenden unabhängigen Friedensgruppen, die Sicherheitsdebatte, die auch auf die DDR (bis in die Führung hinein) ausstrahlte, und die "patriotischen" Äußerungen mancher Integrationsfiguren der Friedensbewegung schufen im linken Spektrum für einige Zeit ein - politisch allerdings ganz diffuses - gesamtdeutsches Zusammengehörigkeitsgefühl.
Mein eigenes, vielfach als Wiedervereinigungsbesessenheit missgedeutetes publizistisches Engagement in dieser Periode sollte eine Rückbesinnung auf die gesamtdeutsche Dimension des Denkens und Handelns aller linken Formationen fördern. Eine solche hätte diese immerhin weniger hilflos erscheinen lassen, als die weltpolitischen Veränderungen sowie die Existenzkrise der DDR im Gefolge der Massenflucht des Sommers und des zur Volksbewegung angewachsenen Massenprotests des Herbstes 1989 die deutsche Frage wieder auf die Tagesordnung setzten. Als vorwiegend defensives Widerstreben konnten weder die im letzten Moment wiedererweckten, alten Konföderationsvorschläge der DDR noch die sachlich vielfach berechtigten Einwände Oskar Lafontaines gegen die Einigung nach Bonner Rezept ausreichend Resonanz finden.
Selbst in den letzten Jahren vor der"Wende" vermieden es die etablierten Kräfte der Linken, die vorhersehbare Aktualisierung der deutschen Frage in ihre konzeptionellen Überlegungen ernsthaft einzubeziehen und die eigenen Anhänger darauf vorzubereiten. Stattdessen wurden Versuche, das zu tun, bestenfalls ignoriert, häufig aber auch diffamiert. Nachdem die deutsche Linke von den in ihr bestimmenden Gruppierungen lange auf die bestehende Nachkriegsordnung eingeschworen worden war, erwiesen sich in den ersten Stadien des Umbruchs in der DDR, als die Dinge noch im Fluss waren und die Liberal-Konservativen ihrerseits noch unsicher operierten, nur die wenigsten west- wie ostdeutschen Linken imstande, diese Blockade zu überwinden und eigene deutschlandpolitische Alternativen ins Spiel zu bringen.
Seit 1990 ist die nationale Frage Deutschlands dadurch charakterisiert, dass die objektiv alternativlose und als solche trotz aller berechtigten Beschwerden von der großen Mehrzahl auch im Osten subjektiv unangefochtene staatliche Einheit zwei Teilgesellschaften umfasst, deren Besonderheiten bis heute eine andere Qualität besitzen als die interregionalen innerhalb der früheren beiden Separatstaaten. Auch wenn auf lange Sicht die Ausgleichungstendenz dominierend sein wird, die Differenzierung zwischen den unterschiedlichen Regionen Ostdeutschlands sich stärker ausprägen wird als die ehemalige Staatsgrenze,so bleibt die Asymmetrie des Einigungsvorgangs in der absehbaren Zeit charakteristisch für Ostdeutschland: von der Wirtschaftsstruktur (nach der Deindustrialisierung der frühen Jahre) über die Elitenrekrutierung und das Vorhandensein von Eigentum bis zu ganz spezifischen Einstellungsmustern und dem Parteiensystem. Wenn man das Nationale nicht für ein rein ideologisches Phänomen, eine Art Sinnestäuschung, hält, handelt es sich bei dem, was gern die Verwirklichung der "inneren Einheit" Deutschlands genannt wird, um eine genuin nationalpolitische Aufgabe, und diejenigen, die - meist links der Mitte stehend - darin die besonderen Anliegen der Ostdeutschen vertreten, erfüllen, wenn sie es mit Blick auf das gesamtdeutsche Gemeinwesen tun, eine konstruktive, unverzichtbare nationale Funktion.
Nun wird die deutsche Frage, wie sie die beiden Fragmente als Frage der Teilung und Neuvereinigung Deutschlands in den Grenzen von 1945 mehr als ein halbes Jahrhundert maßgeblich beschäftigte, gegenüber den eingangs angesprochenen, alle europäischen Staaten betreffenden (inneren und äußeren) Entnationalisierungstendenzen an Relevanz verlieren. Weil die Verfassungsstaatlichkeit, die Demokratie und der seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa untrennbar damit verbundene Sozialstaat sich nicht zufällig im sozial und kulturell relativ (im Vergleich zu vormodernen multinationalen Reichen) homogenen Nationalstaat, dieser typisch europäischen Hervorbringung, entwickelt haben, schlägt sich dessen Bedeutungsverlust zugleich als Gefährdung der Demokratie nieder und wird so empfunden.
Eine Kommunikations-, Kultur- und Bewusstseinsgemeinschaft "Nation Europa" ist so wenig in Sicht wie ein voll ausgebauter europäischer Bundesstaat nach dem konstitutionellen Muster der USA, auch wenn starke Elemente einer "europäischen Gesellschaft" im Westen und zunehmend in der Mitte des Kontinents diagnostiziert werden können und die Integrationsdichte die eines klassischen Staatenbundes, also einer Konföderation unabhängiger Staaten, längst übersteigt. Für die Ausbildung eines europäischen Demos, eines übernationalen politischen Volkes, neben dem und unter dessen Dach die einzelstaatlichen, meist sprachlich-kulturell konnotierten nationalen Völker lange weiterexistieren werden, bedarf es neben der Parlamentarisierung und Demokratisierung der EU-Institutionen einer noch kaum existierenden europäischen Öffentlichkeit. Doch wenn zwischen den Nationen und den souveränen Nationalstaaten alten Typs unterschieden wird, steht die Entfaltung des Nationalen der weiteren europäischen Integration grundsätzlich nicht im Wege. Und auch die nationalen Einzelstaaten werden zumindest als Bausteine eines Vereinten Europa auf absehbare Zeit bestehen bleiben; sie werden noch benötigt. Meine These der Vereinbarkeit wie des wechselseitigen Aufeinanderangewiesenseins der Nationen und der Union findet eine Stütze in den seit Jahrzehnten durchgeführten demoskopischen Befragungen des "Euro-Barometer". Die eigentliche Bruchstelle wurde nicht zwischen der (meist vorrangigen) nationalen und der mehrheitlich damit kombinierten europäischen Identifikation, sondern zwischen diesen beiden oberen Wahrnehmungs- und Zuordnungsebenen einerseits und einer lokalen Fixierung andererseits festgestellt.
Nur im Zusammenschluss werden die Nationalstaaten Europas weiterhin ihrer demokratischen und ihrer Schutzfunktion gerecht werden können. Das setzt aber voraus, dass die Europäische Union von einem Transmissionsriemen und einem Katalysator der neoliberalen Globalisierung umdefiniert und umgewandelt wird in einen Schutz- und Gestaltungsraum für das europäische Zivilisationsmodell. (Und allein so würde die nächste, den Kapitalismus überwindende Große Transformation erneut vorstellbar.) Diese Perspektive eines demokratischen und sozialen Europa setzt realistischer Weise hinsichtlich der politisch-rechtlichen und der kulturellen Verfasstheit relativ stabile nationale Einheiten voraus. Alle Einzelvölker Europas sind anthropologisch und ethnologisch mehr oder weniger Mischvölker. Kultur wird durch Sozialisation und Erziehung, nicht über die Gene vermittelt. Eine moderne, lebendige Nationalkultur respektiert das überlieferte nationale Erbe und die nationalen Traditionen, nimmt aber unentwegt Impulse von außen teils bewusst, teils unbewusst auf und unterliegt so einer ständigen Erneuerung, ohne in der Verflüssigung einfach zu verschwinden. Die soziale Integration von Zuwanderern lief in der europäischen Geschichte letztlich stets auf Assimilation hinaus. Die kommenden Jahrzehnte werden zeigen, ob die kooperierenden und in der Union verbundenen Nationalstaaten Europas die innere Integrationsaufgabe auf diesem Weg bewältigen oder ob sie neue politische und kulturelle Formen finden werden, die das für das demokratische Funktionieren des Gemeinwesens unabdingbare Mindestmaß an sozialer und kultureller Homogenität gewährleisten.