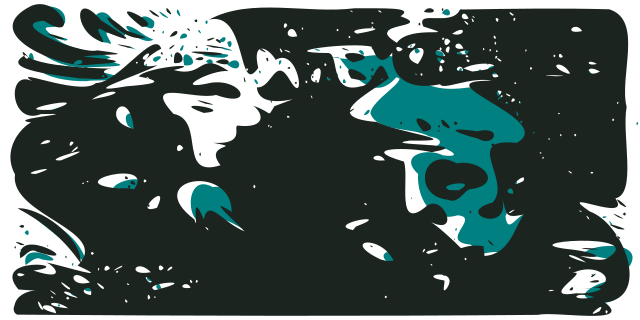von Ulrich Siebgeber
Als der alte Clown
sich ein vielleicht letztes Mal schminkte, sich
die rote Knollennase übers Gesicht
stülpte, die längst zu groß war,
da geschah’s, dass ihm etwas einfiel,
was er beinahe vergessen hatte, etwas, an dem er klebte,
so wie andere daran kleben, die
wie er das Sprechen vergessen hatten
oder vom Sprechen vergessen
wurden, denn auch das Sprechen
kennt seine Leute und nimmt nicht jeden.
von Wolf Biermann
Beichten will ich Ihnen hier, warum ich frommes Kind – einst konfirmiert in der Kirche des Kommunismus - die Demokratie in meiner Jugend verkannte und verachtete. Berichten will ich Ihnen, wie ich dann als junger Mann in der DDR das viel zitierte Bonmot von Winston Churchill über das Dilemma der Demokratie immerhin schon halb verstand. Erst in den lehrreichen Jahren nach meiner Ausbürgerung 1976, erst im Westen, eigentlich erst seitdem der tapfere Renegat Manés Sperber mir dann in Paris den faulen kommunistischen Zahn gezogen hatte, begriff ich den Glanz, aber auch das Elend der Demokratie schon etwas besser. »Demokratie ist eine schreckliche, eine miserable Staatsform, aber von allen, die es in der Welt gibt, die allerbeste.«
von Josef Ludin
Es waren offenbar deutsche Denker des 18. und 19. Jahrhunderts, die Kultur und Zivilisation voneinander getrennt betrachten wollten. In der englischen und französischen Tradition war diese Unterscheidung ungewöhnlicher, und man bevorzugte den Begriff der Zivilisation, meinte damit aber alles, was zu kulturellen Phänomenen gehörte. Zuletzt war Freud einer, der sich in seiner berühmten Schrift, »Das Unbehagen in der Kultur«, von der Unterscheidung lossagen wollte und forderte, man solle die Begriffe synonym benutzen. Tatsache war, dass er von einem anthropologisch geprägten Kulturbegriff ausging, von der Frage nach der Menschwerdung des Menschen in der Abgrenzung vom Tierreich, und davon dass die menschliche Kultur eben Triebverzicht benötige.