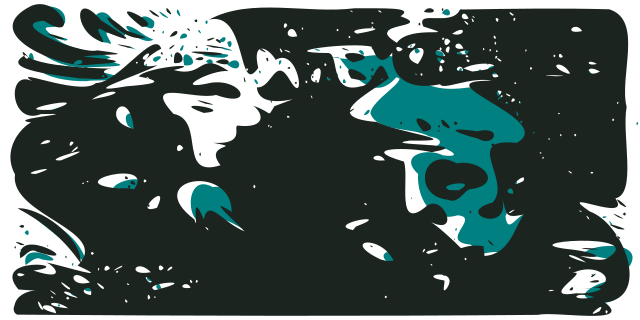von Helmut Roewer
Warum es mir auf der Leipziger Buchmesse gut gefallen hat – nebst einigen Buchempfehlungen
Eins
Herr Kästner, wo bleibt denn das Positive, ließ der Erfolgsautor einen angeblichen Leser bei ihm selbst anfragen. – Hier ist es. Ich schicke voraus, dass ich nicht weiß, was Mainstream über die Veranstaltung der Frühjahrs-Buchmesse 2024 in Leipzig berichtete, doch was die sogenannten Alternativen zu sagen wussten, das streifte ich schon. Es war das Übliche: Stimmungsbilder in Moll. Der Untergang des Abendlandes, nur weil einige Kulturschreckschrauben beiderlei Geschlechts Zettel zum gemeinsamen Hochhalten haben verteilen lassen. Nein, nicht mit Von-der-Sowjetunion-lernen-heißt-siegen-lernen, sondern irgend ein Stuss vom Kampf gegen dies und das.
An den staatsmonopol-kapitalistischen Vielfaltsproduzenten und deren finster blickenden Funktionären eile ich vorüber. Auch an den grellen Gestalten (Manga irgendwas), die ich schon vom letzten Jahr her kenne. Als ich vor Jahresfrist Fotos dieses Treibens veröffentlichte, erhielt ich schneidende Kommentare. Ich wüsste wohl nicht... Nein, wusste ich wirklich nicht, so dass ich es naheliegend fand, den Zusammenhang zwischen Lesen-können und der Flucht ins Absurde zu beschreiben.
Mein Ziel steht diesmal fest. Es ist der Stand des Buchhauses Loschwitz, der sich bei all dem Krach, der in der Messehalle herrscht, durch Gelächter ankündigt, lange bevor ich ihn zu Gesicht kriege. Dort herrscht ein unsystematisch erscheinendes Hin und Her, verursacht durch die wie Schwalben an- und abfliegende Kunden. Mittendrin die Chefin des Hauses, Susanne Dagen, die unablässig den Espresso-Automaten beschäftigt. Jeder scheint sie zu kennen. Fast jeden kennt sie irgendwie. Ich setzte mich erst mal vor eines der beiden Regale und sehe sprachlos zu. Werde aber alsbald entdeckt und mit Marzipan versorgt.
Zwei
Das Buchhaus Loschwitz ist ein Solitär in Form eines Triptychons – eine Buchhandlung in Dresden-Loschwitz in Sichtweite des Blauen Wunders, ein Veranstaltungsort daselbst und ein Verlag. Seine Reihe EXIL hat für einige Aufregung gesorgt. Schon die Namenswahl schien Mainstream anstößig (›Darf die das überhaupt?‹). Hier erscheinen 100- bis 200-Seiten Paperbacks von Autoren, die bereits unangenehm aufgefallen sind, unter diesen so bekannte Namen wie Maron, Hermenau, Tellkamp und Bernig. Manches hat sächsischen Bezug, aber eben nur manches.
Daneben gibt die Verlegerin eine Buchreihe mit festem Einband unter der Sammelbezeichnung edition buchhaus loschwitz heraus. Aus dieser besprach ich vor einigen Monaten den famosen Roman Eschenhaus von Bernig, der nunmehr bereits in dritter Auflage in einer Paperback-Ausgabe vorliegt. Im folgenden geht es um zwei weitere Bücher aus der Edition, den Biografien-Band Die letzten Europäer von Wagner und einen weiteren Roman von Bernig mit dem Titel Der Wehrläufer.
Drei
Das 470-Seiten Buch Die letzten Europäer von Bernd Wagner verlangt nach einem schärferen Blick. Es ist, wie der Untertitel sagt, eine Sammlung von Sieben Studien. Diese haben neben dem einleitenden Essay sechs Biografien zum Gegenstand. Mit dem ›Letzten‹ von was-immer-auch-und-wovon habe ich stets meine Schwierigkeiten gehabt. Ich überwinde diese Schwelle und beginne ganz schlicht mit der Lektüre, nämlich den im Buche dargebotenen Lebensbeschreibungen. Sie beziehen sich auf Personen, die, Ende des 19. Jahrhunderts geboren, in der ersten Hälfte des Zwanzigsten mit den Gegebenheiten auffällig aneinandergeraten sind. Das ist per se ein interessanter Stoff. Ich ertappe mich dabei, wie ich unwillkürlich Parallelen zu Personen ziehe, die, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geboren, mit der Jetztzeit aneinander gerieten.
Die beiden ersten Biografien betreffen den aus Ostpreußen gebürtigen Freiherrn Jürgen von der Wense und den Niederrheiner Albert Thelen. Beide verbindet – man vergebe mir den Hochmut –, dass ich von ihnen vorher nie hörte. Beide verbindet zudem, dass sie krasse Außenseiter waren und mit einem überreichen schriftlichen Nachlass den Einstieg in ihr Tun und Lassen erst ermöglicht haben. Wir wüssten sonst nichts von ihnen. Buchstäblich nichts.
Im Fall von Wense bewegen wir uns im Zwielicht von Wandervogel, Jugendbewegung und Homoerotik, Kränklichkeit des Offizierssohnes, der dem Kriegsdienst im eigentlichen Sinne dank Namen, Verbindungen und Attesten auf Druckposten zu entkommen vermag. Was folgt, ist das Eintauchen in den revolutionären Klamauk des untergehenden Kaiserreichs und republikanischer Frühzeit, sodann Gelegenheitsarbeiten in einem unsteten Leben nebst Flucht in exotische Sprachen und kaum verständliche Musik. Das alles gepaart mit der bescheidenen Überzeugung, ein Exorbitanter zu sein.
Bei Albert Thelen laufen die Dinge etwas anders. Aber auch er im bürgerlichen Sinne ein Taugenichts, Schulabbrecher, Gelegenheitsarbeiter, Flüchtling nach Mallorca, als dies noch Fluchtburg der Aussteiger noblerer Art (wozu Thelen nicht gehört) war. Das hatte mit Weltschmerz zu tun, aber nichts mit dem Nationalsozialismus, denn der war noch lange nicht an der Macht. Ebenso wie Wense hielt sich Thelen dank Sprachbegabung und daraus folgender Mehrsprachigkeit über Wasser. Ebenso wie dieser hatte er wohlhabende Förderer, ohne die er irgendwo im Elend verschollen wäre.
Was bleibt von diesen beiden Biografien hängen? Bereits während des Lesevorgangs unternimmt mein Kopf ausgiebige Ausflüge ins eigene Erleben. Ich mustere wie auf Stichwort ein gutes Dutzend Personen durch, die mir einfallen, weil sie mir deswegen auffielen (fast hätte ich geschrieben: auffällig wurden), da sie nach eigenem Anspruch großartig waren, aber bei näherem Hinsehen eher kleinformatig. Waren auch solche Extreme wie Wense und Thelen darunter? Ich kann es nicht genau sagen, denn meist verlor ich die Geduld mit ihnen, nachdem ich festgestellt hatte, dass die Pfauenfedern zwar prächtig, aber der Gesang eher dürftig war. Man kann halt nicht alles haben.
Die vier weiteren durch Wagner Portraitierten sind mir mehr oder weniger bekannt. Meinen Interessen folgend, habe ich mir zwei herausgegriffen, Ernst von Salomon („Der Preuße“) und Margret Bovari („Die streitbare Frau“). Bei Ernst von Salomon begegnen wir dem Außenseiter der krassesten Art. Der jugendliche Kadettenhaus-Zögling kam aus Altersgründen zum Ersten Weltkrieg zu spät, tobte sich in Freikorps im Baltikum und in Oberschlesien aus, beteiligte sich am Rathenau-Mord, rückte ins Zuchthaus ein, wurde Erfolgsautor bei Rowohlt, Drehbuchschreiber bei der Ufa, wieder Erfolgsautor und verschwand dann nach so viel Beachtung in der Bedeutungslosigkeit eines Neutralitäts-Verfechters in der Adenauer-Zeit. Salomons Autobiographien (Die Geächteten, Die Kadetten, Der Fragebogen) enthalten noch heute mehr Wissenswertes über jene Jahre als alle gelehrigen und gelehrten Handreichungen der Bundeszentrale für politische Bildung.
Und schließlich Margret Boveri. Die Journalistin des Berliner Tageblatts ist die einzige Frau im Biografien-Reigen von Wagner. Eine Außenseiterin war sie bereits aufgrund ihrer Berufswahl und der dortigen Spezialisierung auf die Außenpolitik. In Hitler-Biographien wird kolportiert, dass selbst der Führer sich erkundigte, wer denn dieser M. Boveri sei. Er war eine Frau. Doch mit dem Schreiben während der NS-Zeit war das so eine Sache. Sie lief bald auf Grund. Nur ein Ausstieg aus der Redaktion und eine Pause nebst anschließendem Wechsel in die Rolle einer Auslands-Korrespondentin konnten sie vor dem Berufsverbot schützen.
Im Deutschen gibt es die hässliche Vokabel vom Mitläufer. Ich muss sie nicht erläutern. Zu oft und zu pauschal ist sie auf die verschiedenen politischen Regime angewandt worden. Mit anfänglichem Argwohn habe ich deswegen gelesen, wie Wagner den Seiltanz von Boveri zwischen Anpassung und dem Suchen nach Freiraum beschrieben und bewertet hat. Er hat den Test bestanden, denn zu oft hat es den Versuch gegeben, einem jeden, der unter dem untergegangenen NS-Regime gelebt hat, eine Rolle pro oder contra anzudichten, um so aus jedermann einen Mitläufer oder einen Widerständler zu destillieren. Mit gutem Grund hat Wagner aufgegriffen, dass die Portraitierte selbst auf diese fatale Lage hingewiesen hat. Wir lügen doch alle. So hat sie diesen Teil ihrer Autobiografie bezeichnet. Viele haben sich hierdurch bloßgestellt gefühlt – und übelgenommen.
Dass ausgerechnet der als Suhrkamp-Held hochgejubelte schwere Trinker Uwe Johnson dann an der Journalistin publizistisch Maß nehmen durfte, habe ich nie begriffen. Wagner erwähnt den Konflikt, ohne ihn in der Tiefe auszuloten, was aber sein Verdienst nicht schmälern kann, diese Frau der Vergessenheit zu entreißen. Allein ihr vierbändiger Verrat im XX. Jahrhundert steht wie ein Fels im Geplätscher der europäisch-deutschen Geschichte über Staatsstreich, Geheimdienste und Attentate.
Die Lektüre der beiden übrigen biografischen Skizzen über Albrecht Paris Gütersloh und Friedrich Torberg hebe ich mir für ein anderes Mal auf, wenn ich dieses gelungen-eigenwillige Buch wieder zur Hand nehme. Ein Gran der Kritik sei indessen erlaubt. Ich hätte mir gewünscht, dass die Hauptquellen des Autors, die man bei der Lektüre eher zwischen den Zeilen erahnt, etwas pointierter zum Ausdruck gebracht worden wären, zumal wenn man wie ich das Buch als Einstieg in eine der interessanten Figuren nutzen will. Und zum Beleg, dass der Rezensent das Buch akribisch gelesen hat, sei erwähnt, dass Ludendorff nicht Feldmarschall war, sondern General der Infanterie, und die Sowjetagentin im Chefbüro des Berliner Tageblatts Ilse Stöbe hieß, die ihren Chef Theodor Wolff und seine Besucher durch ihr Blondsein entzückte.
Vier
Das 190-Seiten Buch Der Wehrläufer von Jörg Bernig trägt den Untertitel Eine Geschichte aus Prag. Letzteres ist – gelinde gesagt – eine etwas in die Irre führende Untertreibung. Zwar ist der primäre Schauplatz die Stadt an der Moldau. Eines ihrer Wehre liegt durch das Fenster seiner Wohnung im Blickfeld des Erzählers. Er sieht einem Mann bei der Arbeit zu, dessen Aufgabe es ist, dass Wehr vom Treibgut des Flusses zu befreien.
Ich habe ein Weilchen gebraucht, bis mir schwante, dass dies letztlich nur eine Metapher dafür ist, dass der Held im Laufe der Handlung Schicht um Schicht bis in seine Kindertage zurück das Verschüttete des eigenen Lebens dem Vergessen, nein: dem Verdrängen entreißt. Das, was es da zu betrachten gibt, ist unangenehm, um das Mindeste zu sagen. Dem Leser entfährt alle zwanzig bis dreißig Seiten ein Ach-so.
Daneben ist das Buch eine Liebeserklärung an die Stadt, an das Leben und an die Liebe. Alles in allem ein tolles Buch. Ich habe es in einem Zuge gelesen, ohne einen einzigen Moment das Bedürfnis zum Blättern empfunden zu haben. Habe mich lediglich gefragt: Wie will der Autor aus der Nummer wieder rauskommen? Er ist es, verlassen Sie sich drauf.