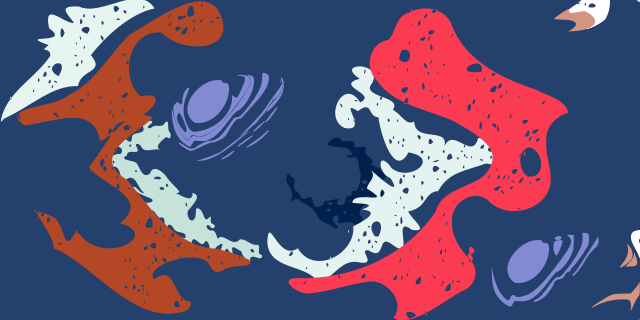III. Kooperation – die Zukunft der Globalisierung
Der Fürst von Schä fragte nach dem Wesen der Regierung.
Der Meister sprach: »Wenn die Nahen erfreut werden
und die Fernen herankommen.«
Konfuzius, Gespräche XIII 16.
1. Der schiefe Blick
Die uneingestandene Angst vor dem Bedeutungsverlust hat die in die Jahre gekommene Europa sehr mitgenommen. Ihre Gesichtszüge sind von Überheblichkeit und Argwohn verzerrt, ihr mürrisches Lächeln gleicht einem Zähnefletschen (besonders gegenüber Menschen aus anderen Kulturkreisen) und ihren schielenden Blick verbirgt sie hinter einer dicken Brille mit verschiedenfarbigen Gläsern, einem rosaroten und einem tiefschwarzen. Durch das eine starrt sie beständig auf ihren Bauchnabel, während das andere ihr ein schemenhaftes Abbild von der Welt zeigt. Was sie dort sieht, vergrößert ihre Angst, und ihre Miene wird noch hässlicher und härter. – Ob Zeus sich heute noch in sie verlieben würde?
Der eurozentrische Blick hat in der Vergangenheit verheerende Folgen gezeitigt, von denen einige, wie im letzten Abschnitt dargelegt, bis in die Gegenwart hineinwirken. Die Verzerrungen, die er heute erzeugt, kann man u. a. an dem schiefen, widersprüchlichen Bild erkennen, das sich einem von China bietet, wenn man in unsere aktuelle Tagespresse schaut: Da ist auf der einen Seite das Milliardenvolk mit seiner prosperierenden Wirtschaft, die uns billige Produkte des täglichen Bedarfs beschert (auf diese Weise die schwindende Kaufkraft des hiesigen Mittelstands wenigstens teilweise kompensierend) und zunehmend auch als Absatzmarkt für unsere teuren High-tech-Produkte in die Bresche springt, da die darniederliegende Ökonomie der USA als Zugpferd der Weltwirtschaft bis auf weiteres ausfällt; auf der anderen Seite nehmen wir die »kommunistische Diktatur« mit ihren Polizeistaatsmethoden und ihrer politischen Justiz als eine Art Doppelgänger des verblichenen Sowjetsystems wahr. Ihre Dissidenten verwandeln wir, ob sie es wollen oder nicht, in traurige Ikonen eines ›westlichen‹ Bürgersinns, der uns daheim weitgehend abhanden gekommen ist oder, wo nicht, sehr schnell, wie Ende September in Stuttgart geschehen, als lästig und fortschrittsfeindlich gebrandmarkt und bei erster sich bietender Gelegenheit niedergeknüppelt wird. Und dann ist da noch das China, das ›unser‹ geistiges Eigentum stiehlt, ›unsere‹ Rohstoffe aufbraucht, ›unsere‹ Umwelt verschmutzt, ›unsere‹ Milch trinkt … Die Reihe der Vorwürfe ist endlos, während die Dankbarkeit für den raschen Aufschwung nach der großen Krise schon ein Ende findet, sobald Chinesen einmal nicht als Käufer ›unserer‹ Produkte, sondern als Investoren auftreten.
Derselbe Blick trifft auch Menschen aus islamischen und anderen fremden Kulturen. Allenfalls als Fachkräfte sind sie uns noch willkommen. Doch auch in dieser Rolle schlägt ihnen, bevor sie überhaupt Fuß gefasst haben, schon der Argwohn entgegen. Mit allerlei Regeln und Tests soll ihre Kompatibilität mit ›unserem‹ wirtschaftlichen und gesellschaftlichen System sichergestellt werden, bevor man ihnen die Erlaubnis erteilt, die Konkurrenzfähigkeit ›unserer‹ Industrie zu erhalten (wozu wir aus eigener Kraft anscheinend nicht mehr in der Lage sind). Die beinahe ein halbes Jahrhundert alte Mahnung von Max Frisch, »man hat Arbeitskräfte gerufen, und es kommen Menschen«, ist offenbar längst in Vergessenheit geraten. – Indem ich dies niederschreibe, höre ich bereits das Echo jenes hasskeuchenden »Gutmensch!«-Geheuls aus den finsteren Höhlen deutscher Leitkulturwölfe hallen. Indessen, was will man denn damit zum Ausdruck bringen: dass Menschen am ›Standort Deutschland‹ nicht geduldet werden?
Fast könnte es so scheinen. Das angestrebte »System für eine zielgerichtete Zuwanderung« (http://www.tagesschau.de/inland/zuwanderung138.html, abgerufen: 25. Oktober 2010), das der Bundesarbeitsministerin offensichtlich vorschwebt, reduziert Menschen auf ihre für die deutsche Wirtschaft nützlichen Qualitäten. Der von ihnen mitgebrachte kulturelle Hintergrund interessiert nur insoweit, als er »zu uns passen« soll. Es liegt auf der Hand, dass hier nicht die vielbeschworene »christlich-jüdische Leitkultur« die Feder führt, sondern eine ganz und gar technokratische Auffassung von »policy making« und »governance«. Die »Leistungsträger« dieser obskuren (Un-)Kultur hat Samuel P. Huntington völlig zu Recht mit dem despektierlichen Ausdruck »Davos man« belegt.
Derselbe Reduktionismus liegt auch der vom Westen verfolgten Politik des gewaltsamen »regime change« zugrunde. Man geht einfach davon aus, dass alle Menschen im Prinzip über den gleichen minimalistischen Fundus moralischer Überzeugungen verfügen, der sie die liberale Demokratie westlichen Zuschnitts als erstrebenswerte Regierungsform und den auf seine »Kernkompetenzen« sich beschränkenden »Nachtwächterstaat« als geeignetes Instrument zur Gewährleistung ihrer individuellen Freiheit ansehen. Erst nach einem Jahrzehnt des »Krieges gegen den Terror« mit Hunderttausenden Toten beginnt einigen unserer verantwortlichen Politiker langsam zu dämmern, dass die Dinge wohl doch nicht so einfach liegen.
Auf eine selbstkritische Reflexion wartet man indessen vergebens. Lieber wird das atemlose Reformtempo noch einmal angezogen. Sie denken über »Effizienzsteigerung«, »Ressourcenallokation« und eben »Systeme für eine zielgerichtete Zuwanderung« nach. Danach, was die Menschen, »nahe« und »ferne«, wollen, fragt niemand. Wissen sie es? – Nein. Glauben sie es zu wissen? – Zweifellos. Aber solange der Gedanke, dass man sich darüber auch irren kann, keinen Raum erhält, wird es schwerlich einen Ausweg aus der Sackgasse geben, in die wir uns manövriert haben.
2. Negative Freiheit
Ein Teil der kulturellen Mißverständnisse, denen Martin Jacques mit seinem Buch entgegenzutreten versucht, lassen sich auf das heute in den meisten westlichen Ländern vorherrschende Freiheitsverständnis zurückführen, das der kanadische Philosoph Charles Taylor in Anlehnung an Isaiah Berlin als »negative Freiheit« bezeichnet (vgl. Negative Freiheit? Frankfurt am Main 1999. Darin: Der Irrtum der negativen Freiheit, S. 118-144). In seiner krudesten Form gehe dieser Freiheitsbegriff auf Jeremy Bentham bzw. Thomas Hobbes zurück, die Freiheit lediglich als »Abwesenheit von externen physischen oder gesetzlichen Hindernissen begreift.« (S. 119.) Die utilitaristischen Vordenker des Liberalismus interpretieren ihn »ausschließlich im Sinne der Unabhängigkeit des Individuums von der Einmischung anderer […], sei es in Gestalt der Regierung, von Körperschaften oder von Privatpersonen; […]« (S. 118). In seiner unreflektierten Form ist er die Grundlage des in den westlichen Demokratien mit jeweils leicht unterschiedlichen Präferenzen praktizierten Pluralismus der Lebensstile, der prinzipiell alles als Privatangelegenheit behandelt, solange es nicht gegen bestehende Gesetze verstößt.
In seinem Aufsatz weist Taylor auf die inneren Widersprüche dieses Freiheitsbegriffs hin. Letztendlich läuft seine Argumentation darauf hinaus, durch Analyse sogenannter »starker Wertungen« (vgl. Taylor 1999, S. 11 u. ö.), die gegen die »schwachen Wertungen« einfacher, aus konkurrierenden Wünschen resultierender Handlungsalternativen abgegrenzt werden, eine durch die krude Freiheitsdefinition verschüttete Dimension kulturellen Handelns freizulegen, die nicht ohne Verlust auf ein individuelles Interessenkalkül reduziert werden kann. Auf diese Weise soll Terrain, das in der zweiten Hälfte des 19. und mehr noch im 20. Jahrhundert an materialistische und positivistische Positionen verloren gegangen ist, wieder zurückgewonnen werden.
Wie oben dargelegt, gehört es bislang zum westlichen Selbstverständnis, solche »starken Wertungen« – gemeint sind damit Urteile über wünschenswertes bzw. verächtliches Handeln, also solche, die auf internalisierten ethischen Normen basieren – bei fremden Kulturen als Zeichen der Rückständigkeit zu deuten, d. h. unser Freiheitsbegriff führt direkt zur Abwertung solcher Kulturen. Da die Idee des Pluralismus einen derartigen Schritt eigentlich nicht zulässt, geht man bei uns dazu über, dem positiven Recht eine symbolische Dimension zuzuschanzen, die dieses von sich aus nicht hat. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist das jüngst von der ›bürgerlichen‹ Koalition beschlossene Verbot der sogenannten »Zwangsheirat«. Eine kulturelle Praxis, die bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein auch in Deutschland durchaus noch ihre – bürgerlichen – Anhänger hatte (zumindest in der negativen Form des Verbots »nicht standesgemäßer« Eheschließungen durch die Eltern) und deren gewaltsame Durchsetzung bereits durch das bislang bestehende Recht unter Strafe gestellt ist (»schwere Nötigung«, »Freiheitsberaubung« usw.) wird durch explizite Aufnahme in das deutsche Strafrecht stigmatisiert, ohne dass dadurch die rechtliche Position der betroffenen Personen verbesssert würde (ungeachtet der Tatsache, dass von einer arrangierten Ehe ja immer zwei Menschen unterschiedlichen Geschlechts betroffen sind, werden a priori nur die Frauen als ›Opfer‹ angesehen; beim Bräutigam wird offenbar generell unterstellt, dass er mit der Brautwahl seiner Eltern einverstanden ist). Lediglich neue Ansprüche auf staatliche Unterstützung sind durch die mit dem Gesetz verbundenen Änderungen im Rückkehrrecht geschaffen worden. Damit hat die schwarz-gelbe Koalition nichts weniger getan als den »Kampf der Kulturen« in verbindliche Rechtsform zu gießen – und Deutschland qua Rechtsprechung auf eine bestimmte politische Linie festzulegen (diese Neigung zum ›Kreuzzug‹ aus Gründen, die dem Liberalismus inhärent sind, analysiert Ulrich Schödlbauer eingehend in seinem Aufsatz Croces Türken. Kreuzzüge im liberalen System. Vgl. Iablis 4. Jahrgang: Übersprungene Identität. Von Proto-Nationen und Post-Existenzen. Heidelberg 2005, S. 92-107).
Der Fall kann durchaus als paradigmatisch dafür angesehen werden, dass die auf einen negativen Freiheitsbegriff gegründete Kultur sich letztendlich selbst ad absurdum führt. Da starke Wertungen genauso wie schwache behandelt werden, also keinerlei allgemeine Verbindlichkeit mehr besitzen dürfen, muss der Staat nicht nur mit seinem Gewaltmonopol dafür sorgen, dass kodifizierte Normen auch tatsächlich eingehalten werden, sondern er muss vermehrt dazu übergehen, solche Normen selbst zu definieren: War am Ausgangspunkt des liberalen Systems alles Privatangelegenheit, so ist es am Ende nichts mehr, d. h. um die Freiheit zu retten, ist der Staat gezwungen, sie zu zerstören. Im Grunde verhalten wir uns wie der Paranoiker, der aus Angst vor dem nur in seiner Einbildung existierenden Mörder Selbstmord begeht.
Im Falle der fremden Kulturen rettet uns vorderhand die Abgrenzung vor der Einsicht in diese Konsequenz. Jedoch können wir nicht dabei stehenbleiben, denn letztendlich ist jede Norm, die das Funktionieren der Gesellschaft sicherstellen soll, davon betroffen. Das fängt bei Vorschriften zur Mediennutzung (Zensur) an und geht über ›Präzisierungen‹ bei der Ausgestaltung von Vertragsverhältnissen, der Finanzberatung, Lebensmittelqualität usw. bis hin zu den Grundrechten. Die stete Verengung des Netzes von Vorschriften führt zusammen mit der symbolischen Überfrachtung des Rechts bei den betroffenen Bürgern zu einer ambivalenten Haltung gegenüber dem Staat. Einerseits erscheint er als die Freiheit verschlingender Moloch, während andererseits von ihm die Lösung all jener Probleme und Konflikte erwartet wird, zu der der Einzelne sich selbst nicht mehr in der Lage sieht, weil damit womöglich die Aufgabe eines und sei es auch noch so kontingenten Stückchens der verbliebenen Möglichkeiten zur ›Selbstverwirklichung‹ verbunden wäre. Solch ein Dilemma hält keine Gesellschaft lange aus, ohne auf kompensierende Maßnahmen zurückzugreifen, mit denen das vermeintlich nicht Fassbare ›rationalisiert‹ wird. Wenn die Wertentscheidungen ganz und gar dem Inneren des Individuums angehören sollen, also weder artikuliert noch durch Argumente beeinflusst werden können, dann verschiebt sich die Auseinandersetzung um richtiges beziehungweise falsches Handeln zwangsläufig auf jene gesellschaftlichen Institutionen, die aufgrund ihrer systemischen Funktionalität noch nicht ihre Legitimität als ›objektive‹ Machtzentren eingebüßt haben – oder eben auf die Sprache selbst als gewissermaßen ›systemübergreifende‹ Instanz.
3. Das Ringen um Deutungshoheit – strategische Präferenzen
Der in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts von den Sozial- und Geisteswissenschaften vollzogene Cultural Turn führte, wie oben angedeutet, zu einem erweiterten Verständnis kultureller Differenz und zu einer gewissen Relativierung der westlichen Perspektive (der sogenannten Zivilisationstheorien »toter, weißer Männer«, wie sie später in denunziatorischer Absicht genannt wurden). Diese Einsichten beeinflussten auch den Kampf der Bürgerrechts- und Emanzipationsbewegungen. In den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts entwickelte sich die Praxis der Political Correctness (PC), die einen erzieherischen Anspruch verfolgt, indem sie bestimmte Begriffe und Themen zu tabuisieren versucht, weil sie in diesen eine sprachliche Diskriminierung sieht.
Die in den heutigen politischen Auseinandersetzungen verbreitete Form der PC tendiert dazu, absichtsvoll gedankenlose oder polemische Verwendungen stigmatisierter Begriffe misszuverstehen und sie zum Anlass zu nehmen, Personen, die darauf zurückgreifen, zu diskreditieren, um so unliebsame Diskussionen zu unterbinden. Auf der anderen Seite wird aber auch das Wissen um die Neigung zur PC beim politischen Gegner gezielt ausgenutzt, um durch provokativen Gebrauch solcher Tabubegriffe oder maßlose, an den Haaren herbeigezogene Vergleiche mit Tabuthemen entsprechende Reaktionen hervorzurufen und damit berechtigte Kritik von vornherein zu desavouieren. Darüber hinaus hat der gezielte Tabubruch natürlich seit jeher den Zweck, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. In der heutigen Mediengesellschaft genügt er in der Regel sogar schon, dem Provokateur das Image eines kühnen ›Freigeists‹ zu verschaffen.
Es liegt auf der Hand, dass die mit dem Begriff der Political Correctness verbundenen rhetorischen Strategien und Gegenstrategien für sich genommen schon den Prozess der demokratischen Meinungsbildung ernsthaft stören und sogar zum Erliegen bringen können. Was in Deutschland die Bedingungen der politischen Debatte zusätzlich erschwert, ist, dass das stärkste historische Tabu eng mit der Frage der nationalen Identität zusammenhängt: die Verbrechen der Nazizeit. Die Hintergründe dieser Tabuisierung sind allerdings sehr viel komplexer und ernster, als dass man ihnen mit einer Diskussion um Für und Wider der PC Rechnung tragen könnte (so wäre es beispielsweise unsinnig und schlichtweg historisch falsch, die kulturellen Bemühungen der Gruppe 47 nach dem Krieg, die deutsche Sprache vom Ballast des Nazijargons zu befreien, als PC zu bezeichnen). Dem Versuch der ›Enttabuisierung‹ des Themas haftet automatisch der Ruch des Geschichtsrevisionismus an, folglich kann der Verweis auf die zensierende Wirkung der PC in diesem Feld nur schwer dem Verdacht der Verschleierung der wahren Absichten des Sprechers entgehen, und Kritik an einem solchen Versuch ist nicht per se Ausdruck von Political Correctness. Wer es auf diesem Gebiet an der gebotenen Sensibilität missen lässt, kann sich kaum glaubhaft als Opfer von ›Gesinnungsterror‹ oder Zensur darstellen. Versucht er es dennoch, braucht er sich jedenfalls über Beifall von der falschen Seite nicht zu beschweren.
Aber auch jenseits dieser Problematik führt die Auseinandersetzung auf der Ebene der Political Correctness zu einer Verschärfung der Konflikte, denn schon die ursprüngliche erzieherische Absicht muss bei Verfechtern der negativen Freiheit auf pauschale Ablehnung stoßen, weil sie prinzipiell als unstatthafter Zwang angesehen wird. Dabei muss derjenige, der an solchen Praktiken Anstoß nimmt, nicht einmal Anhänger der »harten Version« (Taylor 1999, S. 119) der negativen Freiheit sein, geht doch schon die Kantsche Ethik davon aus, dass das aufgeklärte Individuum sich seine Normen selber gibt.
Aufgeklärtes Denken ist wissenschaftsförmiges Denken. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass ausschließlich methodisch gesicherte Erkenntnisse Geltung beanspruchen können. Die Schwierigkeit, die wissenschaftliche Methode auf dem ureigensten Gebiet des Geistes, dem der reinen Vernunftbegriffe, anzuwenden, hat bereits Immanuel Kant in seiner Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft ausführlich diskutiert; die gesellschaftlichen Dimensionen wissenschaftlicher Arbeit leuchtet Max Weber in seinem Vortrag Wissenschaft als Beruf aus. Die heutige Praxis ist allerdings weniger von solcherart Problembewusstsein als vielmehr von gedankenlosem Hang zur ›Objektivierung‹ geprägt, der bei nicht wenigen sogar vor dem eigenen Selbst nicht halt macht. In seiner Untersuchung über die Quellen des Selbst nennt Charles Taylor diese scheinbare Versöhnung von Instrumentalismus und Selbstverwirklichung »Triumph des Therapeutischen« (Frankfurt/M. 1996, S. 875) und warnt zur Recht davor, dass dies letztendlich ein »Abdanken der Autonomie« (ebd. S. 878) bedeuten könne.
Im Wettstreit um die Zustimmung der Menschen in den westlichen Gesellschaften hat derjenige es leichter, der, statt sich auf irgendwelche übergeordneten Normen zu berufen, denen, und sei es auch aus eigener Einsicht, unbedingt zu folgen sei, ihnen ein Angebot unterbreitet, das sie annehmen oder ablehnen können. Kann der Anbieter Vor- und Nachteile der gewünschten Entscheidung mit ›objektiven Erkenntnissen‹ untermauern, dann hat er meistens gewonnen. Diese Karikatur einer aufgeklärten Haltung hat zur Herausbildung einer Meinungsindustrie geführt, der man sich heute kaum noch zu entziehen vermag, will man nicht ganz auf die Benutzung von Massenmedien verzichten. Das wohl wichtigste Instrument zur Herstellung ›objektiver Erkenntnisse‹ ist die Statistik. Der Eindruck der Objektivität entsteht dabei in erster Linie durch die mathematische Methode selbst. Für die öffentliche Wirkung entscheidend ist aber, dass in der Regel nur die Ergebnisse als Infohäppchen bekanntgegeben werden, etwa in der Form: »Das renommierte Institut XYZ hat in einer großangelegten Studie herausgefunden, dass A häufig zu B führt.« In dieser ›Information‹ wird durch bloße Berufung auf die Wissenschaftlichkeit des Ergebnisses insinuiert, eine statistische Korrelation sei als solche signifikant – geradeso als handele es sich um einen Kausalzusammenhang. Die Entscheidung darüber bleibt jedoch dem Empfänger der Information überlassen. Es schlichtweg zu behaupten, würde die Produzenten der zugrunde liegenden Studie sehr schnell als unseriös entlarven. Durch Auswahl passender Grundannahmen lässt sich nämlich zwischen völlig beliebigen Daten eine Korrelation herstellen, mit der erwünschtes Handeln ausgelöst bzw. unerwünschtes verhindert werden kann. So könnte man beispielsweise in einer ›wissenschaftlichen‹ Studie zu dem Ergebnis kommen, dass der Anteil graumelierter Bartträger unter den Porschefahrern höher ist als unter den Kunden irgendeiner anderen Automarke. Daraus zu folgern, dass ein gesetztes Alter im Verein mit gepflegter Gesichtsbehaarung einen für das Produkt aus Zuffenhausen prädestiniert, bleibt in das Belieben des stolzen Besitzers eines solchen Symbols der Manneswürde gestellt. (In gewissen arabischen und vorderasiatischen Kulturen könnte man vielleicht eine – ebenso aussagefähige – Verbindung zwischen Bart und Kalaschnikov herstellen.) Dass diese Verknüpfung von kontingenten Tatsachen keineswegs nur ein lustiges Spiel ist, das allenfalls Marketingargumente oder kuriose Nachrichten für die Rubrik »Vermischtes« erzeugt, davon können zahlreiche unschuldige Menschen, die schon einmal aufgrund ihres Aussehens oder eines bestimmten »Verhaltensprofils« im Netz internationaler Terrorfahnder hängengeblieben sind, ebenso ein trauriges Lied singen, wie jene, die aufgrund eines ungünstigen »Scorings« keinen Kredit mehr von ihrer Bank erhalten, keinen Ratenkauf mehr tätigen oder keine Versicherung mehr abschließen können.
Das ist, wohlgemerkt, kein Argument gegen die Statistik als solche, wohl aber gegen die absichtsvolle Manipulation der Öffentlichkeit unter dem Deckmantel der Objektivität. Mit Wissenschaftlichkeit hat das im Grunde wenig zu tun, denn diese wird, wie gesagt, in erster Linie von einem ausgeprägten Problembewusstsein getragen. Wenn hingegen Politik sich wissenschaftlicher Erkenntnisse und Techniken bedient, um die »Alternativlosigkeit« ihrer Entscheidungen zu behaupten, beschädigt sie nicht nur die Wissenschaft, sondern auch ihr eigenes demokratisches Fundament. Und Wissenschaftler, die sich für Machtinteressen in Dienst nehmen lassen, sind, darüber braucht eigentlich gar nicht diskutiert zu werden, keine Wissenschaftler mehr, sondern bestenfalls opportunistische Technokraten.
4. Offenheit oder Angst
Die heutigen Möglichkeiten interkultureller Kommunikation übertreffen die aller vergangenen Zeitalter bei weitem. Dank des Internet können Menschen aus allen Teilen der Welt leicht, schnell und kostengünstig miteinander in Kontakt treten, Meinungen und Erfahrungen austauschen, einander in Text, Bild und Ton die eigene Alltagswelt zeigen und so wenigstens mittelbar am Leben des Anderen teilhaben. Dadurch wird eine neue Wirklichkeit geschaffen, in der die überkommenen Vorstellungen von Universalität (der je eigenen nationalen oder zivilisatorischen Normen) unweigerlich einer täglichen Überprüfung durch divergierende Lebenswirklichkeiten unterzogen werden. Insbesondere relativiert sich (dies eine eigene Erfahrung mit sozialen Netzwerken wie Facebook und deviantArt) die landläufige Auffassung über den zivilisatorischen, technologischen und kulturellen Abstand zu den Menschen in den sogenannten »Entwicklungsländern«, wie sie auch durch die hiesigen traditionellen Massenmedien leider immer noch allzu oft transportiert wird (hier denke ich vor allem an die Dominanz von Elends- und Katastrophenbildern aus Südostasien, die gelegentlich von Tropenidyllen kontrastiert werden, so als ob es die ganze Bandbreite dazwischen – eben das gewöhnliche Leben der Menschen – überhaupt nicht gäbe).
Diese Erweiterung des eigenen Blicks ist keinesfalls mit der Haltung eines prinzipiellen Kulturrelativismus zu verwechseln. Die eigene kulturelle Prägung kann man nicht einfach ablegen wie ein altes Kleidungsstück. Es gehört Mutwille dazu, sie zu ignorieren. Solch mutwillige Ignoranz ist weder Zeichen besonderer Aufgeklärtheit noch ihres Gegenteils, vielmehr Zeugnis eines politisch-ideologisch motivierten Willens, die von dieser ermöglichte Offenheit zu negieren. Im Kern handelt es sich um einen Fundamentalismus, wie er im oben (Abschnitt I.2) angegebenen Zitat von Wolfgang Schluchter umrissen wurde: »eine moderne Bewegung gegen die Moderne.«
Solch eine Haltung kann sich aus religiösen, aber auch säkularen Quellen speisen, wie gegenwärtig in zahlreichen europäischen Ländern zu beobachten ist (in den USA scheint es sich um eine seltsame Mixtur aus beidem zu handeln). Ihr geht ein Gefühl von Verunsicherung bezüglich der moralischen Grundlagen der eigenen Gesellschaft voraus. Der Fundamentalist will diese durch einen gewaltsamen Akt ›reinigen‹, um die seiner Meinung nach ›vom rechten Weg‹ abgewichene Gesellschaft wieder dorthin zurückzuführen, wohin sie nach der je vorherrschenden Religion, Kultur oder Ideologie gehört. Ein Beispiel für die amerikanische Variante zitiert Robert Reich in seinem neuen Buch Aftershock (New York 2010): »Liquidate labor, liquidate stocks, liquidate the farmer, liquidate real estate. It will purge the rottenness out of the system … People will work harder, lead a more moral life.« (S. 30.) Dies die Empfehlung des Finanzministers von Herbert Hoover, Andrew Mellon, nach dem großen Crash von 1929.
Ausgelöst wird solche Verunsicherung durch Veränderungen, die als zivilisatorischer Niedergang gedeutet werden. Im Allgemeinen handelt es sich dabei um Vorgänge, die über einen längeren Zeitraum hinweg allmählich Platz greifen. Krisenhafte Zuspitzungen können die Abläufe zwar beschleunigen, sind aber selten als alleinige Ursache auszumachen (so war der oben erwähnte Opiumkrieg sicher nicht der einzige und womöglich noch nicht einmal der entscheidende Grund für den Niedergang des chinesischen Kaiserreichs im 19. Jahrhundert). Deshalb sucht der Fundamentalist nach schädlichen Einflüssen und Sündenböcken, die für den Niedergang verantwortlich gemacht werden können. Um diese plausibel erscheinen zu lassen, müssen Geschichten erfunden werden, die in das jeweilige Weltbild passen. Im Falle des modernen Europa, das um seinen Status quo in der heutigen globalisierten Welt fürchtet, bieten sich dafür Geschichten an, die in irgendeiner Weise auf Wissenschaft rekurrieren. Gegenwärtig zeichnen sich zwei große Leitmotive ab, die in unterschiedliche Richtungen wirken. Das eine handelt von der genetisch bedingten Minderwertigkeit der Zuwanderer, die sich in einem angeblich statistisch ›belegbaren‹ Niedergang von Bildung, Leistungsfähigkeit, öffentlicher Moral usw. äußert, d. h. dieses Motiv grenzt die eigene Kultur von der fremden ab; das andere fasst die Ungleichheit noch weiter, indem es das für die modernen, aufgeklärten Gesellschaften konstitutive Gleichheitsprinzip komplett durchstreicht und die Aufklärung kurzerhand für gescheitert erklärt. Ausgehend von den politischen Philosophien Leo Strauss’ und Carl Schmitts vertreten die Protagonisten der letztgenannten Richtung einen elitären Freiheitsbegriff, der große Teile der eigenen Bevölkerung ausschließt, bzw. der politischen Täuschung zum Zwecke der persönlichen Machtsteigerung anheimgibt.
Obwohl zwischen den beiden Leitmotiven scheinbar ein Widerspruch besteht (wie kann man auf ›wissenschaftliche‹ Erklärungen bauen und gleichzeitig vom Scheitern der Aufklärung ausgehen?), finden beide besonders in konservativen bis rechtspopulistischen Kreisen Anklang – wobei der Begriff »konservativ«, wie ein Blick auf die US-amerikanischen »Neocons« zeigt, eher irreführend ist, denn es geht den zu diesen Kreisen zählenden bzw. ihnen nahestehenden Politikern und Publizisten nicht um die Bewahrung der klassischen bürgerlichen Normen und Lebensweise, sondern darum, alle staatlichen Restriktionen, die den Besitzindividualismus zugunsten einer prosperierenden Massendemokratie beschränken, zu beseitigen, um so den akkumulierten Besitz als Grundlage der Machtsteigerung einsetzen zu können – oder wie es George W. Bush als Präsidentschaftskandidat der Republikaner im Jahre 2000 in einer Rede vor reichen Gästen eines New Yorker Galadinners ausdrückte: »Some people call you the elite; I call you my base.«
Am Beginn dieses Essays standen der Fortschrittsbegriff der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ein seit der Jahrhundertwende sich ausbreitender Stimmungswechsel: die Angst, dass die Erwartungen, die an ihn geknüpft wurden, sich womöglich nicht erfüllen könnten. Das Paradoxe der gegenwärtigen Situation besteht darin, dass diese Angst ausgerechnet in dem Moment um sich greift, da sich die ökonomische und technische Produktivität in einem Maß entfaltet, wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Ein Grund für die Ambivalenz des Lebensgefühls in so vielen »entwickelten« Ländern dürfte darin liegen, dass in der heutigen Welt der globalisierten Konzerne und offenen Märkte das befreiende Moment von Wissenschaft und Technik seinen Charakter vollständig geändert hat: Dienten diese kulturellen Errungenschaften ursprünglich dazu, die Menschen von beschränkenden Vorurteilen wie von beschwerlicher Arbeit zu befreien, so ist ihre Aufgabe heute, den Wettbewerb um die noch verbliebene Arbeit potentiell auf die gesamte Menschheit auszudehnen und all jene, die dabei nicht mithalten können, auszusondern. Die so verstandene Globalisierung zeigt also zwei Tendenzen, eine vereinheitlichende und eine spaltende; beide haben der kulturellen Vielfalt den Krieg erklärt. Die Forderung nach Integration in der Form, wie sie heute bei uns erhoben wird, entspringt einem kapitalistischen Fundamentalismus, der die verlorenen Wettbewerbsvorteile durch forcierte Anpassung der Menschen an die effizienzgesteigerten Produktions- und Distributionsprozesse wieder wettmachen zu können glaubt. Warum sonst sollten einem der radebrechende türkische Gemüsehändler, der libanesische Kioskbetreiber oder der jordanisch-palästinensische Autoschrauber in der Vorstadt plötzlich ein Dorn im Auge sein? – Die spaltende Tendenz zielt nur vordergründig auf die fremde Kultur ab. In Wahrheit hat sie alle im Visier, die durch das Raster des Wettbewerbs fallen und so der Vereinheitlichung der Gesellschaft nach dem technokratischen Muster der Produktions- und Verwertungsmaschinerie im Wege stehen. So entpuppt sich der »Kampf der Kulturen« am Ende als der bereits aus der Kolonialzeit bekannte Kampf der kapitalistischen Zentren gegen die sogenannte »Peripherie«. Heute indes befindet sich die Peripherie nicht mehr an irgendwelchen gottverlassenen Orten im fernen Dschungel, sondern mitten unter uns, und die Zahl der Zentren hat sich vermehrt, so dass sich ihr gemeinsamer Schwerpunkt nach dorthin verlagert, wo die Mehrheit der Menschen lebt: nach Asien.
Diese trostlose Form der Globalisierung ist aber nicht so »alternativlos«, dass die einzige probate Antwort darauf eine Abkehr von ihr wäre. Die digitale Kommunikationstechnik hat ein gewaltiges Fenster zur Welt geöffnet, doch statt hinauszuschauen und die Vielfalt, die sich zeigt, zu rühmen, sperren wir uns ängstlich in unsere dunkle Kammer ein und halten an unserem engen Horizont als Maß aller Dinge fest. Damit lassen wir zu, dass die Profiteure freie Hand haben, dieses Fenster wieder zu schließen, die Informationsströme zu kanalisieren, um sie ihren Machtinteressen dienstbar zu machen, denn was sie am wenigsten gebrauchen können, ist Vielfalt. Sie brauchen die Uniformität der Machtzentren, das Monolithische der wetteifernden Kulturblöcke, die Normprodukte der Großkonzerne. Die Vielfalt lebt demgegegenüber in den Regionen – aber sie ist nicht mehr dort gebunden. Dank des Internet kann sie weltweit von sich reden machen. Das einzige, was dazu nötig ist, ist die ursprünglich menschliche Fähigkeit zum Zuhören: Offenheit statt Angst.