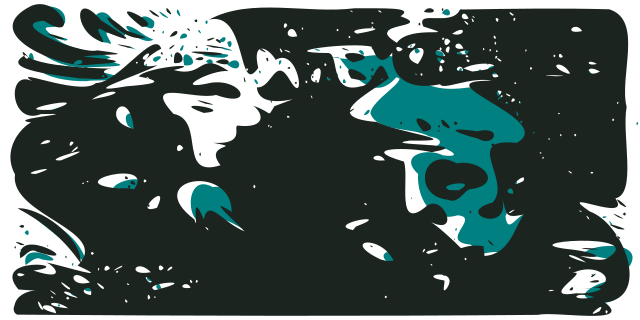17. Vom Danachkommen
Nach 1989 geriet die Erinnerungskultur von zwei Seiten unter Druck. Das doppelte Erbe der DDR und das historische Deutungsbegehren, das aus den Biographien der nach 1989 aus den Ländern Osteuropas und der ehemaligen Sowjetunion zugewanderten Deutschen sprach, mündeten in eine verdeckte Konfrontation der Interpretationen, die sich in der Alltagssprache einen festen Platz erobert hat und in Entgleisungen der Politik wie der Ausweisung von ›no-go-areas‹ für Ausländer nach irakischem Vorbild in den neuen Bundesländern für Befremden sorgt. Angesichts der legitimierenden Funktion der Erinnerungskultur für das Gemeinwesen sind das ernste Prozesse, in deren Verlauf einerseits der Richtungssinn, andererseits die integrative Kraft der Institution ins Gerede gekommen ist. Negativ gesprochen hieße das: die neue Erinnerungskultur präsentiert sich gleichermaßen richtungslos und autoritär im Zulassen und Verwerfen von Erinnerungen. Ob man darin neue legitimierende Kämpfe oder die Anfänge eines unaufhaltsamen Delegitimisierungsprozesses sieht, an dessen Ende die notgedrungene Restituierung der Nation steht, ist gegenwärtig eine Frage der politischen Optik.
Der rasch zunehmende Anteil von Personen mit fremd- oder gemischtkulturellem Hintergrund an der Gesamtbevölkerung wirft weitergehende Fragen auf. Das nationale Erinnerungsmodell macht dieser Personenguppe kein besonders attraktives Identifikations- und Integrationsangebot. Das ist, aufs gesellschaftliche Ganze gesehen, vielleicht nicht besonders wichtig, solange Migration vor allem als Fluktuation (mit Anpassungen an die konjunkturelle Arbeitsmarktsituation) oder als Elendsmigration verstanden wird: in beiden Fällen steht das gefestigte Selbstverständnis des reichen Landes im Zentrum, das den ›Fremden‹ seine Arbeitsplätze und sozialen Sicherungssysteme zur partiellen Nutzung überlässt und ihnen freistellt, ob sie sich integrieren möchten oder nicht. Die Überprüfung des Schulsystems hat gezeigt, dass diese Deutung bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt beträchtliche Wahrnehmungslücken enthält. Und die vom amerikanischen Kampf gegen den Terror produzierten Schlagzeilen haben dem Begriff des ›inneren Friedens‹ eine religiös-kulturelle Note wiedergegeben, die Historikern vertraut ist, eine laizistische Politik aber gern dauerhaft von ihm ferngehalten hätte. Vor allem belehrt die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung darüber, dass diese saturierte Sicht der Dinge obsolet ist.
Einer gängigen Auffassung nach wäre es ›jetzt‹ an der Zeit, von Fluktuation auf Integration ›umzuschalten‹. Was daran politisch machbar ist, sollte die Wahrnehmung limitierender Faktoren und die Reflexion auf kulturelle Gegebenheiten, die dem Machen leicht eine andere als die vorgedachte Richtung geben, nicht beeinträchtigen. Wenn Integration zu den Aufgaben eines jeden Gemeinwesens zählt, die es unter anderem durch Statuszuweisungen (darunter die des Gastes, Flüchtlings etc.) löst – oder zu lösen versucht –, dann scheint diese Rede wenig ergiebig zu sein, wenn es darum geht, die besondere Problemlage eines Landes zu beschreiben, das sich aus Mangel an Nachkommenschaft am Weltmarkt für Migrationswillige zu bedienen wünscht. Ein Stück näher kommt man ihr, wenn man zwei limitierende Faktoren in die Überlegungen einbezieht.
– Es ist keine politische Definitions- oder Willensfrage, ob ein Land mit nationalstaatlichen Institutionen, zu denen die Organe und Mechanismen der politischen Willensbildung, das nationale ›Gedächtnis‹, die Selbst- und Fremdwahrnehmung des ›Landes‹ und seiner Grenzen, die Funktion der Landessprache, der religiöse, literarische und kulturelle Fundus und schließlich der sich in einer Fülle kleiner und kleinster Alltagshandlungen und -reden bezeugende Wille der ›überwältigenden‹ Bevölkerungsmehrheit zählen, als Einwanderungsland gilt. Soll das Wort nicht als weitgehend leerer Problemlöser durchgehen, so setzt es einen Mix von Herkunftsgeschichten seiner Bewohner voraus, in dem das Motiv der Einwanderung dominiert. Länder wie Deutschland sind Zuzugs-, nicht Einwanderungsländer: im Geschichtenmix ihrer Bewohner überwiegt das – regional, genealogisch oder kulturell interpretierte – sesshafte Motiv, das durch Sondergeschichten mit eigenkulturellem Hintergrund ergänzt und angereichert wird. Insofern nimmt es nicht Wunder, dass Journalisten auf Wörter wie ›Völkerwanderung‹ und ›Landnahme‹ verfallen, wenn sie die kommenden Umwälzungen bildhaft zu benennen versuchen – Vokabeln, die im europäischen Kontext Auflösungs- und Untergangsphantasien, aber keine realistischen Optionen bezeichnen.
– ›Einwanderung‹ ist unter den heute herrschenden kommunikations- und verkehrstechnischen Bedingungen ein in staatsmännischer Absicht gepflegter Euphemismus. Der Vorgang, für den das Wort steht, ist charakterisiert durch räumliche und zeitliche Trennung, Irreversibilität, partielle oder totale Kommunikationsabbrüche, soziale und kulturelle Entfremdung und – im Fall des Gelingens – erneute ›Akkulturation‹. Diese Faktoren sind zwar nicht vollständig aus dem Migrationsfeld verschwunden, aber ihr Wandel hat das spezifische Gewicht des Vorgangs so weit verändert, dass es erlaubt ist zu sagen: tendenziell findet Einwanderung, jedenfalls in den entwickelten Ländern, nicht mehr statt. Die zeit- und raumlose globale Kommunikation, die massenmediale Präsenz der Herkunfts- in den Aufnahmeländern, die Entwicklung des Flugzeugs zum planetarischen Massentransportmittel und der sozioökomische Wandel, der eine weitgehend berührungsfreie Koexistenz mit der ›einheimischen‹ Bevölkerung über Generationen hinweg erlaubt, lassen das Gemeinte – und Erhoffte – zu wenig mehr als einer historischen Reminiszenz schrumpfen.
Mit der gegründeten Aussicht darauf, dass die Bevölkerungsanteile in den Aufnahmeländern sich durch Zuzüge signifikant verschieben, bis hier und da Mehrheiten sich in Minderheiten verkehren, verwandelt sich das Bevölkerungsproblem in ein Definitionsproblem der besonderen Art: wer die Macht besitzt, den zu erhaltenden Kernbestand des Ausgangssystems zu definieren, entscheidet indirekt darüber, welches Volk man ein paar Jahrzehnte später in den jeweiligen Landesgrenzen antreffen wird. Das existierende Volk, sofern es in diesem Prozess eher kommentierend in Erscheinung tritt, reagiert gespalten: einerseits ist ihm elementar an der Aufrechterhaltung der Prosperität gelegen, die es für einen Ausfluss des gegenwärtigen Systems hält, andererseits möchte es seine Position im zu erwartenden Verteilungspotpourri gewahrt wissen, gleichgültig ob es um sozialen Status, Straßenbilder, Wohngewohnheiten oder den informellen Zusammenhalt der Gesellschaft geht. Nüchtern formuliert: es wird zum Befürworter von Zuwanderungen, die es ablehnt, sobald sie mit realen Verschiebungen im Lebensstil und in den Machtverhältnissen einhergehen.
Das Dilemma schmeckt ein wenig nach Brechts bekanntem Ratschlag an die Regierenden: »Wäre es da / Nicht doch einfacher, die Regierung / Löste das Volk auf und / Wählte ein anderes?« Immerhin erscheint er unter den gegebenen Bedingungen im Kern realistischer als der Versuch, Ausländer über das Erinnerungsparadigma in die Gesellschaft zu integrieren, indem man ihnen den potentiellen Opferstatus vor dem Hintergrund der Aktivitäten neonazistischer Schlägertrupps anbietet. Die Europäisierung der Erinnerungskultur, darunter ihre Anreicherung um den Kolonialdiskurs, die die Relationen von Erinnern und Erforschen, Vergessen und Gedenken neu sortiert, stellt Integrationsmuster bereit, deren Annahme bereits die Ablehnung inhärent ist. In den Ländern der ehemaligen Kolonialherren füttert die kritische Konservierung der rassistischen Topoi das bekannte System, ein bereits vorhandenes, angesichts seiner abweichenden Geburtenraten argwöhnisch beäugtes Bevölkerungspotential mit individuellen Aufstiegschancen auszustatten und zugleich am unteren Ende der sozialen Skala zu fixieren. Europa wird die Probleme der Deutschen nicht lösen, es wird aber erwarten, dass die Deutschen sie lösen, statt es ein weiteres Mal in die drohenden Schatten der incertitudes allemandes zu tauchen. Den Deutschen wäre eine etwas freiere Sicht darauf zu gönnen, dass keine alternativlos fordernde Moderne, eher schon das unvollendete Verständnis einer als Zukunft maskierten Vergangenheit für gewisse generationsspezifische, aber mit der Tendenz zur Fortschreibung behaftete Blockaden verantwortlich ist. Die vergleichbare Lage von Ländern wie Italien, Japan, Südkorea oder Russland erscheint in dieser Perspektive als vergleichbar spezifische, die ein analoges, die jeweils gültige historisch-kulturelle Konstellation zu Rate ziehendes Verstehen der wirksamen Parameter verlangt.
– Ende –
Teil 1: Demographischer Wandel: Der große Übergang (1)
Teil 2: Demographischer Wandel: Der große Übergang (2)
Teil 3: Demographischer Wandel: Der große Übergang (3)
Teil 4: Demographischer Wandel: Der große Übergang (4)