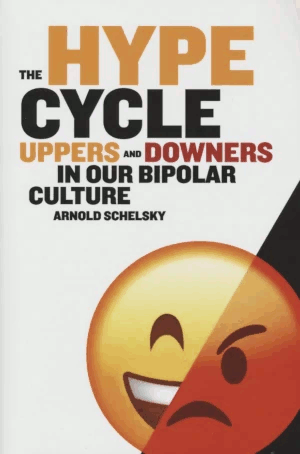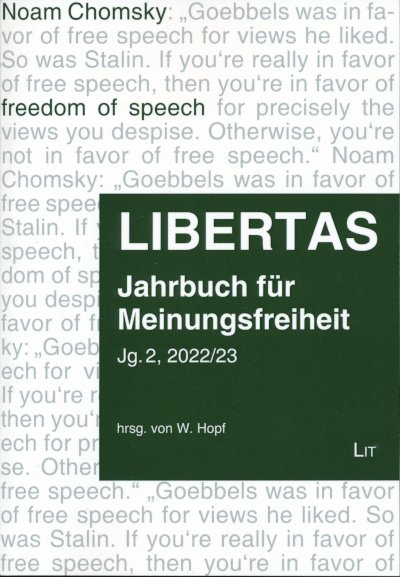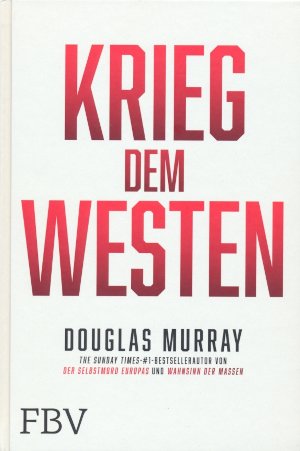von Ulrich Siebgeber
Wenn, woran die Direktorin des Kölner Stadtarchivs aus gegebenem Anlass erinnerte, jede Epoche unmittelbar zu Gott ist, und wenn daraus folgt – wie die Bemerkung anzudeuten scheint –, dass ihre Dokumente per se als sakrosankt anzusehen sind, dann hat die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gerade ein paar heilige Textchen mehr unters Volk gebracht, ohne dass es der hochverehrten Leserschaft sonderlich aufgefallen sein dürfte.
Gute Bücher, die wir hassen – unter diesem Rubrum haben sich einige bewährte Routiniers pünktlich zur Leipziger Buchmesse und 76 Jahre nach den Bücherverbrennungen unter Ablassung der üblichen Sprechblasen des ›kanonischen Bestandes‹ angenommen – kritisch, wie es sich gehört, vor allem aber mit jener vornehmen Unbedarftheit, die das Vorrecht des journalistischen Schreibers ist, sobald er sich Regionen nähert, in denen ›schriftstellerische Professionalität‹ nicht als das höchste Gut angesehen zu sein pflegt, sondern als ein problematisches Ding, gelegentlich auch als Lachnummer. Nun konnte keiner der an dem rituellen Bubenstück Beteiligten ahnen, dass just zur gleichen Zeit sich die in eine Baugrube der örtlichen Verkehrsbetriebe geplumpsten Bestände des genannten Archivs symbolträchtig in nichts oder ein wenig mehr auflösen würden:pünktlich, wie es sich gehört. Was der Natur ihr Dauerregen, das ist dem Journalismus das feuilletonistische Geriesel, das auch nur zerstören kann, was bereits in die Grube gefallen ist.
Business as usual? Nicht ganz. Dazu sind die Gesandten des öffentlichen und heimlichen Wir einen Schritt zu weit gegangen. Als Leser ist man gewohnt, verhöhnt zu sehen, was dem schreibenden Durchschnittsgehirn ›zu hoch‹ vorkommt, also einen Musil, einen Proust, einen Saint-John Perse, einen Mallarmé, lauter Autoren, die hierzulande ohnehin nicht durchkämen, falls das Land einen wie sie einmal hervorbrächte. Diesmal hängt die Latte niedriger: Camus – ein Dummschwätzer (Nils Minkmar), Eichendorff – ein fader Eskapist (Dirk Schümer), Lessing – ein rührender Gutmensch (Hans Ulrich Gumbrecht), Huxley – ein ›Möchtegernschamane‹ (Dietmar Dath), Joyce – ein irgendwie postmoderner Erwartungsenttäuscher (Anne Zielke): das sind richtige Erleuchtungen, highlights geradezu, dergleichen verdient es, täglich unters Lesevolk gebracht zu werden, das sich das alles schon länger gedacht hat. Natürlich sind es stets einzelne Bücher, die hier ›verrissen‹ werden, keine Autoren, die Klassiker bleiben mögen, bis sie schwarz werden. Auch Thomas Manns Wälsungenblut ist nur ein Buch, ein Büchlein, ein Heftchen geradezu, ein antisemitisches obendrein, wie der ganze Mann: »Wenn ich an Thomas Mann denke, fallen mir jedenfalls nur neunmalkluge Jesuiten, liebe Lübecker, wirre Zwölftonmusik-Komponisten, strenge Bibel-Juden, depressive Closet-Schwule, liebenswürdige Hochstapler und böse Nazis ein – die auch noch alle so geschwollen daherreden, wie sich der Kleinbürger mit Bildungskomplex Literatur vorstellt... Vielleicht geht es hier doch um Antisemitismus und nicht nur um ein bisschen Literatur.« Um solch unverklemmte Prosa abzusondern, braucht es den ganzen Mann und auch er trägt einen Namen: Maxim Biller. Das alles ist komisch, nicht gerade zum Schreien, auch nicht zum Lachen, schon gar nicht zum Weinen, es ist nur komisch, und das vielleicht nur ein bisschen.
Aber stimmt es denn nicht, dass Heinrich Manns Henri Quatre Schwächen und Längen hat (die immer bemerkt wurden), dass Borcherts Zweitauflage der expressionistischen Dramensprache den Leuten irgendwann zu den Ohren heraushing, dass Nabokovs Lolita eine brillante Spekulation auf einen sensationalistischen Publikumsgeschmack darstellt, der den faulen Zauber liebt, dass Hesses Steppenwolf eine innere Beziehung zur Jugendkultur unterhält? Natürlich stimmt es. Dergleichen zu wissen und mehr oder lebhaft zu empfinden gehört wie die Lektüre der Bücher selbst zur ›Bildung‹. So gehört auch zum ›gebildeten Umgang‹ die sogenannte Verunsicherung der Konsumenten, in der an die Stelle von Geist die Gaudi tritt, die ohnehin überall Vorfahrt genießt.
Man verunsichert aber niemanden, der das alles schon weiß, man verunsichert auch niemanden, der es nicht bereits weiß und nun sicher ist, seine Zeit mit derlei Lektüren nur zu verschwenden, wo sich doch so viel Besseres und Klügeres, vor allem Zeitgemäßeres mit ihr anstellen lässt. Denn hier liegt der Hase im Pfeffer: Verunsichern lässt sich nur, wer die Kenntnis des Kanons für unabdinglich hält, wer überhaupt von einem solchen Kanon Kenntnis besitzt und ihn, wie immer rudimentär, für sich realisiert. Nicht verunsichern lässt sich, wer bereits die Verfilmung für die Essenz des Buches hält und das Buch für die mehr oder minder langweilige, mehr oder minder überflüssige Zweitverwertung desselben Stoffs. Nicht verunsichern lässt sich infolgedessen, wer das Verunsichern ohnehin für eine Bildungsattitüde hält, die ihn langweilt: der Kulturkonsument selbst, der fernsehende, kinogehende, im Internet surfende Zeitgenosse, der gelegentlich, weil es diesen Merkposten auch noch gibt, ein wenig Zeit für die Tätigkeit opfert, die hier großspurig ›Lesen‹ genannt wird.
Dieser Zeitgenosse weiß sich ›bildungsmäßig‹ sehr wohl auf der Höhe, er hätte das eine oder andere nachzuholen, aber die Zeit, die dafür zur Verfügung steht, ist knapp. Er ist daher dankbar für jeden Tipp: Was lohnt, was lohnt nicht, was kann man von der Liste streichen, die man ›irgendwo im Hinterkopf‹ hat, welche Information erleichtert, welche beschwert, mit welchen Lücken kann man leben? Dass Bildung, wie immer man zu ihr steht, heute nicht literarisch ist, pfeifen nicht nur die Spatzen von den Dächern, man liest es in den Büchern, die ›dafür plädieren‹, auf Literatur besser nicht ganz zu verzichten. Wer also die genannten ›Verrisse‹ verstehen will, der muss sie als Entrümpelungsaktionen verstehen: Weg mit dem Plunder, wir haben uns lange damit herumgeplagt, wir wollen das niemandem mehr zumuten. In manchen Beiträgen wird das recht drastisch zum Ausdruck gebracht: »Tut mir leid, aber ich habe mit postmoderner ›Demontage der Erwartungen‹ und anderen Entschuldigungen für Unvollständiges oder Schlechtgemachtes nie besonders viel anfangen können. Da es mit den ›Dubliner‹-Geschichten immer so weiter ging, hörte ich irgendwann bei der Hälfte des Buches auf.« Da weiß man schon, was die Dame liest, falls sie gerade liest.
Der Verriss, das kennt man seit Reich-Ranickis durchkalkulierten Vermarktungsaktionen, ist die Form, mittels derer das informierte Publikum über das hinweggeht, von dem es ohnehin annimmt, dass es sie nichts angeht. Seit das Bedürfnis, sich literarisch zu informieren, drastisch zurückgegangen ist (nachdem es, nicht zu vergessen, von Bildungsplanern und ähnlich angenehmen Zeitgenossen zurückgefahren wurde), kämpft auch diese Form der Entsorgung ums Überleben, genauer gesagt, um den knappen Platz, den sie in den Augen der Allgemeinheit belegt. Gute Bücher, die wir hassen ist als Titel insofern schlagend, als er sowohl die Gesinnung als auch das Verfahren anzeigt und darüber hinaus ein Stück Wirklichkeit hinter den Fassaden erkennen lässt. Das Rudel spricht und es spricht als Rudel.
Mit dem Hass wird es im einzelnen nicht weit her sein, soviel literarische Leidenschaft verraten die versammelten Beiträge nicht. Doch in einem anderen, weiter gefassten Sinn ist er tatsächlich gegeben. Die Damen und Herren Kritiker, sie hassen die Falle, in die sie geraten sind, als sie sich der Literatur als Beruf verschrieben. Sie hassen das zusammengeschmolzene Prestige, sie hassen sich dafür, dass ›das alles‹ irgendwie keine Zukunft mehr zu haben scheint, dass sie aussehen wie Leute, die sich nicht rechtzeitig nach einem ihrer Bedeutung angemessenen Tätigkeitsfeld umgeschaut haben, sie hassen die Lektüren ihrer Jugend, weil sie sie auf diesen Abweg geführt haben, sie hassen die Verführungskräfte der Literatur, die einmal stark genug gewesen sind, um sie zu betören, und sich anschließend als zu gering erwiesen, um der Gesellschaft, der Öffentlichkeit, dem Publikum, das sie sich erträumten, zu imponieren. Vor allem aber hassen sie es, aus einer, wie sie glauben, anderen Zeit zu stammen, aus einer Zeit, in der das Lesen noch etwas galt: »Einst waren wir mächtig.« Denn sie wollen Heutige sein, nichts als Heutige, und das gelingt ihnen dann auch.
Dieses gelebte Ressentiment gegen etwas, das niemals im Heute aufging oder aufgehen kann, gegen eine mit der Zukunft im Bunde stehende Vergangenheit, die eher zufällig die Bezeichnung Literatur trägt, weil die Lettern sie durch die Zeit transportieren, ist sicherlich etwas anderes als die kindische Attitüde, die behauptet, mit dem einen oder anderen Titel durch zu sein. Eher ähnelt es dem Hass auf die Kultur, der zu einer anderen Zeit den Nazi-Dramatiker Hanns Johst zu dem Satz animierte: »Wenn ich Kultur höre... entsichere ich meinen Browning.« Er hätte auch schreiben können: »Wo bitte, geht's hier zum Fressschalter?« Aber das war nicht nötig, seine Mitstreiter hatten ihn längst gefunden. Daran mag sich gelegentlich erinnern, wer wissen will, woher die periodischen Kulturbrüche Deutschlands, vielleicht Europas, ihre rätselhaften Energien beziehen. Insofern sollte man sich bei der Gelegenheit ein paar Namen merken, zumindest sie.