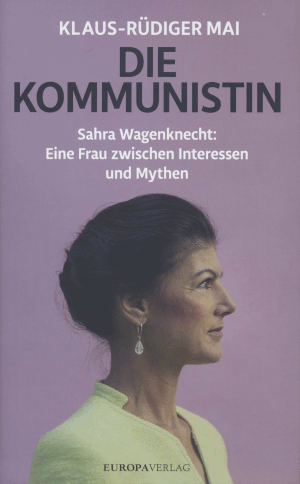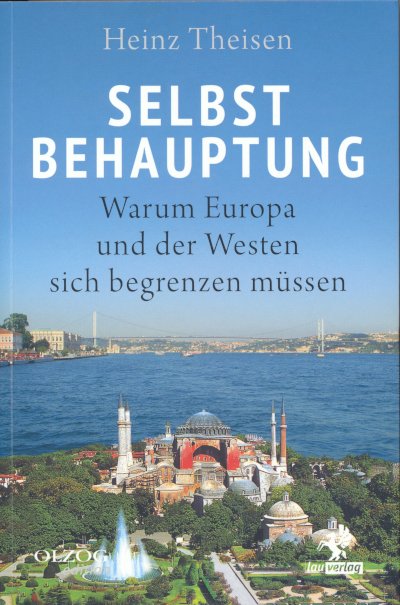von Christoph Jünke
Noch vor einem Jahr veröffentlichte er sein jüngstes Werk, die beeindruckenden Geschichten von Marx und dem Marxismus im englischen Original (die deutsche Übersetzung ist erst vor wenigen Wochen bei Hanser erschienen), und fast bis zum Schluss vertrieb sich der britische Universalhistoriker Eric Hobsbawm seine Zeit mit kleinen, aber feinen Beiträgen für die London Review of Books. Nun (am 1. Oktober) ist er, im stolzen Alter von 95 Jahren, aus dem Leben und Arbeiten herausgerissen worden und von uns gegangen. Und es fällt schwer, nicht auch bei Hobsbawm an die Zeilen des russischen Dichters Jewgeni Jewtuschenko zu denken:
»Ich möcht ein wenig unmodern und altmodisch sein, / damit die Zeit nicht wegwischt, was ich bin und war, / damit die Toten meiner sich nicht schämen müssen, / die Toten, die, wozu das Leben nützte, wissen. / Ich möcht ein wenig von der alten Schule sein, / korrekt und höflich, manchmal geradzu, / doch ohne viel und indiskret zu fragen, / und möchte zur Gemeinheit stets Gemeinheit sagen. / Ich möcht belesen, voller Witz und Scharfsinn sein, / mich nicht vom Glanz geschliffner Phrasen täuschen lassen, / der Stimme des Gewissens stets vertraun, / auf sie, die ohne Falschheit, baun. / Ich möchte ewig jung und unverbildet sein, / doch achten auf die Lehren frührer Zeiten, / ich möchte den Burschen, die da wild nach kühnen Taten, / erfahren und gemessen wie ein Alter raten.«
Ein wenig unmodern und altmodisch, das war auch Hobsbawm – von jener alten Schule, die belesen und gewissenhaft, aber ohne jede Überheblichkeit, scharfsinnig und witzig, aber ohne jede falsche Komik, höflich und korrekt, aber nicht beliebig oder desinteressiert. Der 1917 in Alexandria geborene jüdische Junge, der seine Kindheit im »roten Wien« der Zwischenkriegszeit und seine Pubertät im vorrevolutionären Berlin der Jahre 1932/33 erlebte, formte, als Flüchtling in London, seinen Intellekt in jenen dreißiger und vierziger Jahren, die als die tiefschwarze Nacht des 20. Jahrhunderts noch heute ihre Schatten auf die Nachgeborenen werfen. Es war ein leidenschaftlicher, nicht selten verzweifelter Kampf zwischen Irrationalismus und Rationalismus, der damals ausgefochten wurde, ein Kampf, der viele Opfer zählte und dessen Überlebende nachhaltig prägte.
Dies gilt auch für die Geschichtswissenschaft. Mit dem ebenso physischen wie psychischen Zusammenbruch Europas begann, der Eule der Minerva gleich, der Aufstieg einer neuen Generation von europäischen Historikern. Sei es die französische Schule der Annales (um Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel u.a.), sei es die Schule der britischen marxistischen Historiker (neben Maurice Dobb nicht nur, aber vor allem Christopher Hill, Rodney Hilton, E.P. Thompson und Eric Hobsbawm), sie alle mischten fortan die Historiographie mit Soziologie und begründeten damit eine ausgesprochen fruchtbare Tradition der Sozialgeschichte und historischen Sozialwissenschaft. Marc Bloch brachte ihren geschichtswissenschaftlichen Ansatz damals, in seiner posthum veröffentlichten Apologie der Geschichte, auf den umstrittenen Begriff des Verstehens. Es sei dieses Verstehen, »dass all unsere Studien leitet und erhellt«, und die einzig echten Wissenschaften seien jene, »die erklärende Beziehungen zwischen den Phänomenen herzustellen vermögen«. Schlössen die Naturwissenschaften Begriffe wie Erfolg oder Misserfolg, Gewandtheit oder Ungeschicklichkeit aus, so gehören diese Begriffe »zum gängigen Wortschaft der Geschichtswissenschaft. Denn sie hat es mit Wesen zu tun, die von Natur aus befähigt sind, Ziele bewusst zu verfolgen.« Die Gegenwart durch die Vergangenheit verstehen und die Vergangenheit durch die Gegenwart, das war Marc Bloch zufolge der Beruf des Historikers, und die »Solidarität der Zeitalter« war ihm damals noch »so stark, dass die zwischen ihnen bestehenden Bande Verstehbarkeit in beiden Richtungen ermöglichen. Das Unverständnis der Gegenwart gegenüber entsteht zwangsläufig aus der Unkenntnis der Vergangenheit. Doch bemüht man sich vielleicht nicht minder vergeblich um das Verständnis der Vergangenheit, wenn man von der Gegenwart nichts weiß.« Es ist deswegen kein Zufall, dass wir es bei diesen Historikern nicht selten auch mit engagierten politischen Intellektuellen zu tun haben. Und was der aktive Resistance-Kämpfer Bloch und seine Kollegen in Frankreich, waren die jungen kommunistischen Historiker in Großbritannien.
Richteten die Franzosen ihren Blick vor allem auf die langen strukturellen Trends von Ökonomie, Geografie und Ethnologie, setzten die Briten stärker auf die Sozialstrukturen, -prozesse und -konflikte, und aktualisierten dabei fast zwangsläufig jenen alten Marx, der die Geschichte bekanntlich vor allem als eine Geschichte der Klassenkämpfe betrachtete. Auf fruchtbare Art ging dieser neue Zugang jedoch nur, wenn sie dazu den alten, im damaligen Marxismus vorherrschenden, ökonomischen Determinismus und sein letztlich unfruchtbares Basis-Überbau-Schema überwanden. So packten sie den Stier bei den Hörnern und widmeten sich nicht zuletzt der neuen Untersuchung vom Ursprung und der Entwicklung des kapitalistischen Gesellschaftssystems. Als »Geschichte von unten« schrieben sie die Geschichte der britischen Klassenkämpfe neu und inspirierten damit nicht nur spätere Generationen von britischen, europäischen und nichteuropäischen Historikern, sondern fanden auch ein durch die weltweite Revolte von 1968 sprunghaft gestiegenes Lesepublikum.
Je nach Temperament schrieben diese neuen Historiker ihre Geschichtsschreibung mit politisch-moralischem Pathos wie E.P. Thompson oder mit jener nüchternen Sachlichkeit, die Eric Hobsbawm auszeichnete. Die Leidenschaft fehlte jedoch auch diesem nicht. Die Welt, schrieb er einmal, ist nicht zu unserem persönlichen Vorteil gemacht »und wir sind nicht zu unserem persönlichen Vorteil auf der Welt. Eine Welt, die dies zu ihrem Zweck erklärt, ist keine gute Welt und sollte keine Welt von Dauer sein.« Das ließ ihn bis zum Schluss unversöhnt bleiben mit dieser Welt und darauf beharren, dass es darauf ankomme, sie nicht nur zu interpretieren, sondern auch zu verändern. Doch das eine geht eben nicht ohne das andere, und seine Aufgabe fand Hobsbawm vor allem in der historischen Interpretation.
So suchte er also nach den Mustern und Mechanismen des historischen Wandels, richtete seinen Blick vor allem auf die langen historischen Trends und die Gesamtzusammenhänge und blieb dabei doch immer ganz konkret. In seinen frühen Arbeiten zur Arbeitergeschichtsschreibung (Labouring Men, 1964; The Worlds of Labour, 1984; Ungewöhnliche Menschen, 1998) erinnert er uns daran, die Geschichte der Klassen und ihrer Kämpfe nicht auf die Geschichte ihrer organisierten Bewegungen zu reduzieren, lässt vielmehr gerade die sogenannten >kleinen Leute< in ihrer ganzen Gewöhnlichkeit und Ungewöhnlichkeit wieder auferstehen. Pionierhaft waren deswegen auch seine Studien zu den archaischen Formen sozialer Bewegung, zu den bäuerlichen Sozialrebellen und Sozialbanditen in der Phase der Industrialisierung (Sozialrebellen, 1959/62; Banditen, 1969/72). Von der Sozialgeschichte ging er damals Stück für Stück über zu einer umfassenden Gesellschaftsgeschichte, von der Geschichte der Industrialisierung (Industrie und Empire, 1968/69) zur Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert (seine monumentalen vier Bände The Age of Revolution, 1962; The Age of Capital, 1975/80; The Age of Empire, 1987/89; Age of Extremes, 1994/95). Und selbst seine gelegentlichen Ausflüge in die Geschichte des Jazz (Captain Swing, 1969; The Jazz Scene, 1989), des Nationalismus (Nationen und Nationalismus, 1990/91) und des Marxismus (Wie man die Welt verändert: Über Marx und den Marxismus, 2011/12) oder in die Theorie der Geschichte und ihrer Geschichtsschreibung (On History / Wieviel Geschichte braucht die Zukunft, 1997/98) sind Meilensteine eines Ouevres, dessen einzelne Schriften mit ihrer Mischung aus sachlicher Tiefe und stilistischer Form durchgängig ihresgleichen suchen.
Die Gegenwart durch die Vergangenheit verstehen und die Vergangenheit durch die Gegenwart, das war sicherlich auch Hobsbawms Sache. Ganz und gar unaufdringlich suchte er immer wieder nach der politischen Dimension von Geschichte, mischte sich mit zunehmendem Alter auch selbst immer stärker in politische Diskussionen ein (Politics for a Rational Left, 1989; Globalisierung, Demokratie und Terrorismus, 2007/09). Ein bekennender Traditionskommunist, der den Liberalen nicht selten näher stand als den Linken und politisch für den postmodernen Flügel der Labour-Partei Partei ergriff – das hat ihm nicht wenig Kritik eingehandelt auf der britischen Linken (während ihn Liberale und Konservative gleichzeitig noch immer viel zu links fanden). Doch so fragwürdig manche seiner Ansätze und Interventionen auch gewesen sein mögen (vgl. hierzu auch den Globkult-Beitrag Blut wird fließen, viel Blut - Eric Hobsbawms Provokationen), so sehr er sich also ein wenig unmodern und altmodisch gab, so legte er seinen Finger doch zumeist in die richtige Wunde. Beispielsweise in jenem wunderschönen kleinen Beitrag über Revolution und Sex von 1969, in welchem er den damaligen Burschen, die da wild nach kühnen Taten drängten, ins Stammbuch schrieb, dass es keine triftigen Gründe gebe für einen direkten Zusammenhang zwischen sozialrevolutionären Bewegungen und Freizügigkeit »in öffentlichem Sexual- oder anderweitigem persönlichem Verhalten«. Kulturelle Auflehnung und kultureller Nonkonformismus seien, »für sich betrachtet, Symptome, keine revolutionären Kräfte. In politischer Hinsicht sind sie nicht sonderlich wichtig. (…) Den Bürger zu schockieren ist leider leichter als ihn zu stürzen.«
Dass keine menschliche Gemeinschaft ohne historisches Bewusstsein denkbar, dass die Vergangenheit »also eine dauerhafte Dimension des menschlichen Bewusstseins, ein unausweichlicher Bestandteil der Institutionen, Werte und anderen Strukturen der menschlichen Gesellschaft« ist, das hat er gern betont im Zeitalter des vermeintlichen Posthistoire, welche die Geschichte einzig als vergangenen Mumpitz abzutun vermag (»history is bunk« – so schon Henry Ford). Und so befand er sich im selbsterklärten Zweifronten-Krieg gegen jene, die ahistorisch und rein technisch an mechanischen Modell-Lösungen gesellschaftlicher Krisensituationen arbeiten, wie gegen jene, die die Geschichte noch immer für unvernünftige Zwecke, d.h. zum Zwecke ihrer politischen Instrumentalisierung verfälschen: »Geschichte als Mittel der Begeisterung und als Weltanschauung«, schrieb er, »hat ihre eigene Tendenz, zu einem sich selbst rechtfertigenden Mythos zu verkommen. Nichts ist gefährlicher als solche Scheuklappen, wie die Geschichte moderner Nationen und Nationalismen beweist. Es ist die Aufgabe des Historikers, sich mit allen Kräften zu bemühen, diese Scheuklappen zu entfernen oder sie zumindest geringfügig oder gelegentlich zu erweitern, und soweit er dies tut, kann er der gegenwärtigen Gesellschaft einige Dinge sagen, aus denen sie ihren Nutzen ziehen kann, auch wenn sie sich dagegen sperrt, etwas daraus zu lernen.«
Bescheiden und souverän zugleich hat er damit auch seine eigene Anspruchs-Latte hoch gehängt. Doch gefällig war er einzig in der Form seiner Arbeit, nicht in ihrem Inhalt – und auch dies teilte er irgendwie mit seiner beeindruckenden Historiker-Generation. Gut gemacht Eric Hobsbawm, die Toten müssen sich Deiner nicht schämen.
Eine stark gekürzte erste Fassung dieses Beitrags erschien in der Tageszeitung junge Welt vom 4. Oktober 2012.
Foto: Eric Hobsbawm (CC BY 3.0; Frederico L. Maciel; http://picasaweb.google.com)