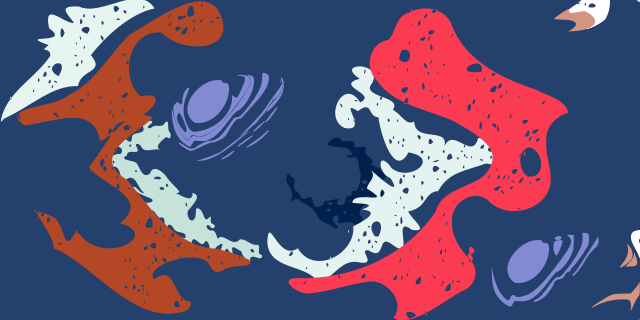von Rainer Paris
Die Stimmabgabe bei Wahlen ist ein einfacher Akt: Man macht an einer bestimmten Stelle sein Kreuz und hat damit seiner demokratischen Bürgerpflicht und Verantwortung Genüge getan. Und dann geht man nach Hause und wartet am frühen Abend die ersten Ergebnisse und Hochrechnungen ab.
Das Vorfeld jedoch ist, zumal in heutigen Tagen, kompliziert. Vorbei sind die Zeiten, in denen es klare Präferenzen für bestimmte Parteien gab und man immer schon wusste, wen man wählen würde. Nicht nur, dass die Zahl der Parteien erheblich zugenommen hat; heute muss man von vornherein in möglichen oder absehbaren Koalitionsoptionen denken, also die gesamte Figuration einbeziehen, wenn man den Wirkungsgrad seiner Stimme abschätzen will.
Wahlen und Wahlkämpfe sind das Hochamt der Demokratie. Zwar ist das Prinzip der Volkssouveränität nur ein Eckpfeiler der parlamentarischen Demokratie – die beiden anderen sind Verfassungstreue und Gewaltenteilung –, und doch ist der Wahltag stets eine zentrale Zäsur, an dem über die neue politische Machtverteilung und die Grundrichtung des Gemeinwesens entschieden wird. Andererseits jedoch gilt: Wahlsiege sind noch längst keine Problemlösungen.
Im politischen Konflikt der modernen Demokratie überlagern sich drei sehr verschiedene Streittypen: Im Sachstreit der Parteien geht es um Grundvorstellungen gesellschaftlicher Ordnung und deren Umsetzung in praktische Politik. Dies ist verquickt mit der erbitterten Rivalität ambitionierter Politiker um die Besetzung von Ämtern mit Pfründen und Macht – ein Ziel, das sie jedoch nur erreichen können, wenn es ihnen gelingt, durch ihre ständige Präsenz in den Medien ein heterogenes Publikum, also das künftige Wahlvolk, davon zu überzeugen, dass sie für die Führung und Gestaltung des Landes in den nächsten Jahren die geeigneten Kandidaten sind. Sachstreit, persönlicher Streit und massenmedial vermittelte Eindruckskonkurrenz bestehen nebeneinander und stimulieren sich wechselseitig.
In jeder Wahlentscheidung geht es also um sachliche Überlegungen und Wertvorstellungen, unmittelbare persönliche Präferenzen und mehr oder minder rationale Chancenabwägungen, die miteinander in Einklang zu bringen sind. Grundwerte, Interessen, persönliche Sympathien und Fragen der Glaubwürdigkeit sind stets vermengt mit Kalkulationen über mögliche Ergebnisse und Auswirkungen des eigenen Tuns – kein Wunder, dass so manchem Zeitgenossen schon in Wahlkampfzeiten der Kopf schwirrt.
Denn die Überlagerung der Konflikttypen reproduziert sich ja auch in häufigen Unklarheiten und Dilemmata, die den Prozess der eigenen Urteilsfindung begleiten. Schon die Verbindung von allgemeiner Programmatik und konkreter Maßnahmenebene ist oftmals prekär: Was ist, wenn ich zwar die Grundanschauungen einer Partei, nicht aber ihre Einzelvorschläge auf verschiedenen Politikfeldern gutheißen kann? Oder wenn ich zwar die beschworenen Werte und die ins Auge gefassten Maßnahmen befürworte, mir die Repräsentanten der Partei aber zutiefst zweifelhaft oder unglaubwürdig, mitunter gar ›glaubunwürdig‹ (Michael Klonovsky) erscheinen. Gerade in Zeiten einer starken Polarisierung und gesellschaftlicher Kulturkämpfe ist das keine leichte Aufgabe.
Tröstlich ist allerdings, dass die Geschichte limitiert ist. Am Wahltag, noch vor Aschermittwoch, ist alles vorbei. Es ist einer der großen Vorzüge der parlamentarischen Demokratie, dass sie gestaffelte Beteiligungschancen erlaubt und bereithält. Wer sich dazu berufen fühlt, in die Politik ›einzusteigen‹, kann in eine Partei eintreten, sich dort engagieren und als Delegierter oder Kandidat aufstellen lassen. Und auch wenn er das nicht tut, kann er sich in der Öffentlichkeit am politischen Meinungsstreit beteiligen, abweichende Meinungen demonstrieren und sich als politische Opposition organisieren.
Und auch die Beschränkung und Selbstbeschränkung aufs Wählen und sogar der Verzicht darauf sind legitim. Ein hervorstechendes Merkmal von Diktaturen ist (neben fingierten Wahlen) ja gerade das Bestreben der Herrschenden, durch einen ständigen Appell des politischen Dauerengagements eine fortwährende Mobilisierung der Bevölkerung zu erreichen, die sich der allgegenwärtigen Propaganda kaum entziehen kann. In Diktaturen werden schon Kindern politische Eide und Bekenntnisse abverlangt, sind Indifferenz und Desinteresse bereits verdächtig. Demgegenüber gewährt die parlamentarische Demokratie ihren Bürgern neben den Chancen dosierter Beteiligung eben auch die Freiheit und Möglichkeit, für sich selbst ganz andere Präferenzen des Lebens und der Glückssuche in den Vordergrund zu stellen. Es ist nicht der geringste Vorteil der Demokratie, dass sie einem erlaubt, die Aufmerksamkeit zu begrenzen und sich nur gelegentlich oder am Rande für Politik zu interessieren.