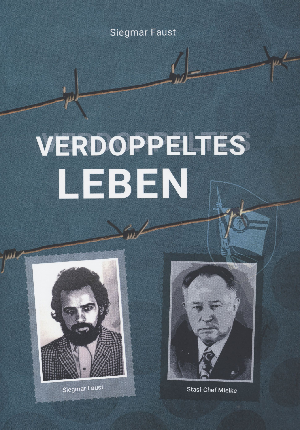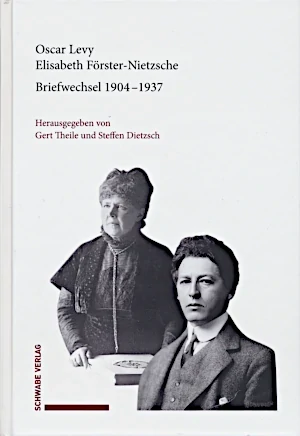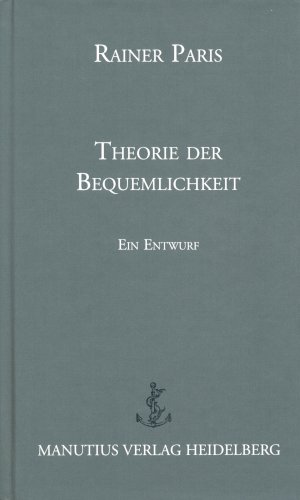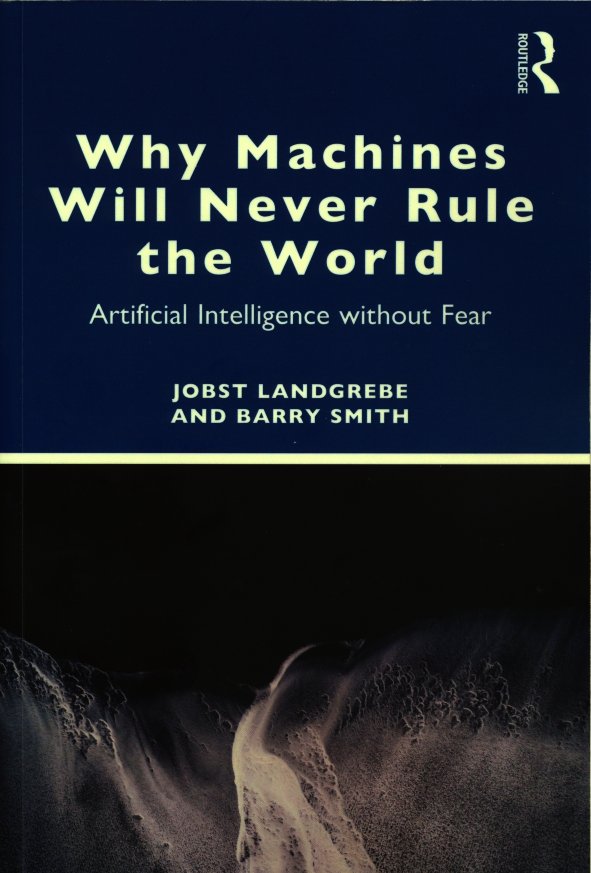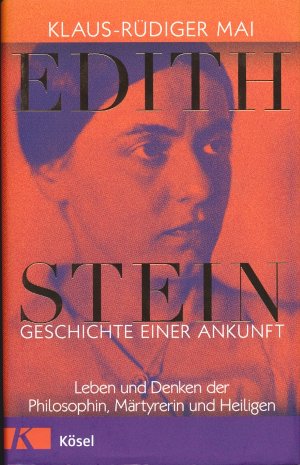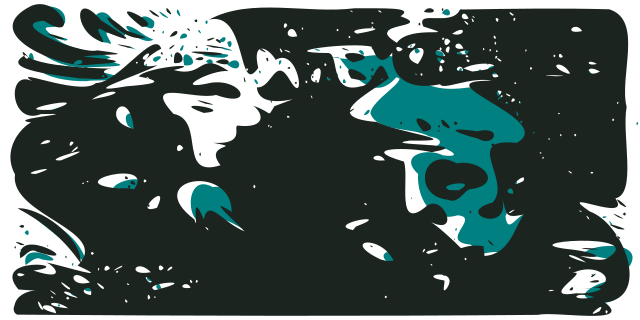.jpg)
(unter Mitberücksichtigung der deutsch-russischen Beziehungen)
von Peter Brandt
Wir sind gewohnt, auch für weit zurückliegende Zeiten von ›deutsch-polnischen‹ Beziehungen zu sprechen, obwohl wir es im Mittelalter und der frühen Neuzeit beiderseits nicht mit Nationalstaaten oder ihren unmittelbaren Vorformen zu tun haben, auch nicht mit Nationen im modernen Sinn, seien sie ethnisch-kulturell oder staatsbürgerlich definiert. Für das Heilige Römische Reich, das im 15. Jahrhundert, nach dem Ausscheiden Italiens und Burgunds aus dem Reichsverband, den Zusatz »Deutscher Nation« erhielt, ist dieser Tatbestand im Hinblick auf seinen bis zu seinem Ende 1806 nicht überwundenen lehnsrechtlich-genossenschaftlichen Charakter offenkundig. In ähnlicher Weise wie das Römisch-Deutsche Reich, wenn auch ganz anders gestaltet in seiner inneren Struktur und Regierungsform einer Adelsrepublik, war Polen vor den Teilungen des späten 18. Jahrhunderts ein trans- bzw. vornationaler und transkonfessioneller Staat.
Die im Hochmittelalter beginnende deutsche Ostsiedlung darf schon deshalb nicht unter dem Blickwinkel der Volkstumskämpfe seit dem späten 19. Jahrhundert betrachtet werden.
Nach der ersten Jahrtausendwende unserer Zeitrechnung, als Otto III. im Jahr 1000 in Gnesen spektakulär mit dem polnischen Herzog Boleslaw zusammentraf, entbehrten die Beziehungen der beiden übernationalen Reiche sieben Jahrhunderte lang der besonderen Dramatik. Wie in anderen Fällen benachbarter, zeittypisch komplexer Herrschaftsgebilde wechselten Phasen des friedlichen Zusammenlebens oder der Eintracht mit Konfliktphasen. Einen Umschwung brachten der Aufstieg des brandenburgisch-preußischen Territorialfürstentums, schon weit eher ein souveräner Staat als das Alte Reich, nach dem Dreißigjährigen Krieg und die expansive und auf Europäisierung zielende Machtentfaltung Russlands unter Peter d. Gr. um 1700. Unter Peter leitete das Russische Reich eine vor allem auf Preußen und Österreich gerichtete, hegemoniale Bündnispolitik ein, in deren Rahmen die polnische Republik als strategisches Vorfeld zu fungieren hatte.
Das brandenburgisch-preußische Herrschergeschlecht der Hohenzollern entwickelte, namentlich nach der Begründung des Königtums »in (Ost-)Preußen« (1701), das nicht Teil des Alten Reiches war, ein vermehrtes Interesse an der Schwächung des polnischen Faktors. Zwar hatte schon Kurfürst Friedrich Wilhelm 1657 für seine Dynastie die zuvor bestehende Lehnsabhängigkeit von Polen als (ost-)preußischer Herzog abstreifen können, doch war damit noch nicht der rechtliche Status des Landes Preußen als polnisches Lehen aufgehoben, der beim Aussterben des Geschlechts der Hohenzollern hätte praktisch bedeutsam werden können.
So entwickelte sich aus der Machtausdehnung der neuen europäischen Großmacht Russland und den aus der Dekomposition des Alten Reiches erwachsenen, diese gleichzeitig verstärkenden Territorialstaaten Österreich, bereits etabliert, und (noch deutlicher) Preußen, das sich anschickte, als kleinster Akteur ebenfalls in das sich etablierende ›Konzert‹ der Staaten einzutreten, die in der Folgezeit dominierende antipolnische Konstellation. Die gemeinsame Beherrschung Polens wurde zum Kernbestand vor allem des preußisch-russischen Einvernehmens für zwei bis zweieinhalb Jahrhunderte. Angesichts des Klammergriffs des autokratischen Russlands und des absolutistischen Preußens hatte die polnische Republik des freien Adels als schwächstes Glied des europäischen Staatensystems und mit seiner anachronistischen inneren Ordnung kaum eine Chance, als sich im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts den aufstrebenden Monarchien zusammen mit Österreich die Gelegenheit bot, in Polen zu intervenieren und in drei Schritten dessen Staatsgebiet komplett unter sich aufzuteilen. Es war das gemeinsame Interesse an der Aufrechterhaltung der Teilung Polens – sie wurde, nach dem Zwischenspiel des napoleonischen Großherzogtums Warschau, 1815 in modifizierter Form erneuert – , das die drei konservativen Ostmächte zusammenhielt.
Nachdem schon die Verfassungsgebung von 1791 und der Aufstand gegen die Fremdherrschaft von 1794 in ganz Europa Sympathien für die polnische Sache geweckt hatten, begann die Hochzeit der ›Polenfreundschaft‹ in Deutschland (wie in Frankreich und anderswo) mit dem Scheitern der revolutionären Erhebung von 1830/31. Auf dem Hambacher Fest 1832 und noch in den Märztagen 1848, als man die Gefangenen von 1846, an ihrer Spitze Mieroslawski, triumphal aus dem Gefängnis Berlin-Moabit befreite, wehten die rot-weißen Fahnen Polens neben den schwarz-rot-goldenen der deutschen Demokratie. Die liberal-demokratischen Nationalbewegungen des Vormärz sahen sich in einer Front gegen das repressive Metternich´sche System, und speziell die deutschen fortschrittlichen Patrioten bewunderten das freiheitsliebende, rebellische Volk der Polen.
Der Verlauf der Revolutionsereignisse von 1848/49 machte dann schnell deutlich, dass die in ihren verfassungs- und gesellschaftspolitischen Forderungen meist verwandten Nationalbewegungen in Gegensatz zueinander geraten konnten, besonders im östlichen Mitteleuropa mit seiner ethnischen Gemengelage. Die Polendebatte des Frankfurter Paulskirchenparlaments im Juli 1848, wo es um die nationale Zukunft der preußischen Provinz Posen ging, zeigte die Schwierigkeiten überdeutlich. Doch erst nach der Gründung des Deutschen Reiches von 1871 radikalisierte sich die preußische Politik gegenüber der polnischen Minderheit im Sinne des epochenspezifischen integralen Nationalismus und provozierte verstärkte Anstrengungen auf polnischer Seite zur nationalen Selbstbehauptung. Angehöriger der eigentlich vornationalen preußischen Monarchie zu sein, mochte, da ein polnischer Staat nicht existierte, angehen; Bürger eines deutschen Nationalstaates wollte man, wenn man sich als Pole fühlte, keineswegs sein.
1918/19, nach der Niederlage des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg, kam ebenfalls keine Verständigung zwischen dem wieder aufgerichteten Polen und dem neuen, republikanischen Deutschland zustande. Auch die Weimarer Republik sah ihre Polenpolitik in der Kontinuität Preußens und erkannte die Grenzziehung im Osten (mit dem westpreußischen ›Korridor‹) nicht an, anders als die ebenfalls mit Gebietsverlusten behaftete neue Grenze im Westen. Der Wunsch nach der Revision der als ungerecht empfundenen, ›blutenden‹ Grenze zu Polen bestand übrigens nicht nur auf der Rechten und im Offizierskorps. Dort dachte man indessen insgeheim sogar über eine militärische Liquidierung des polnischen Staates im Zusammengehen mit dem inzwischen bolschewistischen Russland nach. Umgekehrt wird man auch indessen auf die Maßlosigkeit und die Selbstüberschätzung der tragenden politischen Kräfte Polens verweisen dürfen, deren territoriale Ambitionen über den Status quo weit hinausgingen. Das autoritäre Regime, das sich in Polen sukzessive etablierte, richtete sich im besonderen Maß gegen die in großem Umfang eingemeindeten nationalen Minderheiten, darunter die deutsche. Schon damals kam es zur Verdrängung von ca. einer Million Deutscher, vor allem derjenigen, die für die deutsche Staatsbürgerschaft optiert hatten und ausgewiesen wurden.
Nicht ganz ohne Berechtigung hatten die Deutschen generell den Eindruck, dass das vom US-amerikanischen Präsidenten Wilson proklamierte »Selbstbestimmungsrecht der Völker« von den Siegern des Weltkriegs hauptsächlich da praktiziert wurde, wo es zu Lasten Deutschlands ausschlug. Das trug zur Entlegitimierung des dem Deutschen Reich in Versailles buchstäblich diktierten Friedensvertrags und der daraus hervorgegangenen Staatenordnung erheblich bei, und es lag für die Verantwortlichen unter pragmatischen Gesichtspunkten nahe, die Tuchfühlung zu (Sowjet-)Russland zu suchen, dem anderen Verlierer der Neuordnung am Ende des Ersten Weltkriegs. Doch wurde die (auf dem militärischen Sektor verdeckte) deutsch-russische Zusammenarbeit in den 1920er Jahren und frühen 1930er Jahren mehr als ausbalanciert durch die kooperative Außenpolitik der Weimarer Republik nach Westen und den Einfluss der republikanischen Kräfte im Innern.
Wenn es nach Stalin gegangen wäre, wären die Beziehungen zwischen dem Deutschen Reich und der UdSSR auch nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 kontinuierlich weiter entwickelt worden. Ohne einen plötzlichen Bruch zu vollziehen, setzte Hitler andere Prioritäten. Der Nichtangriffspakt mit Polen vom Januar 1934, der die außenpolitische Isolierung Deutschlands durchbrach, stand für die bis in das Frühjahr 1939 weiter verfolgte Option des deutschen Diktators, Polen in einen Feldzug gegen die Sowjetunion einzubeziehen (und dabei de facto deutscher Vorherrschaft zu unterwerfen). Der Ausgleich auf der zwischenstaatlichen Ebene durch den erwähnten Vertrag wurde begleitet von einer wechselseitig freundlichen Publizistik und sogar jeweiligem politischen und folkloristischen Werben. Frühere Deutschnationale sprachen kritisch vom ›Polenrummel‹ der Nationalsozialisten. In der Tat wäre die von der Rechten stets des nationalen Verrats geziehene Weimarer Republik kaum imstande gewesen, eine solche, sei es rein taktisch gemeinte, Wendung gegenüber Polen vorzunehmen, wie es die Nationalsozialisten taten.
Bekanntlich wiesen die polnischen Regierenden Hitlers mit Drohungen unterlegte Lockungen zurück – aus Gründen der ›nationale Ehre‹, aber auch in realistischer Einschätzung der Abhängigkeit, in die Polen als Verbündeter Deutschlands geraten wäre. Es kam dann im Spätsommer 1939 trotz ideologischer Todfeindschaft zwischen den beiden Beteiligten wieder die Konzeption des antipolnischen Revisionismus zum Tragen, und zwar in ihrer denkbar krassesten Form, als Deutschland und die Sowjetunion im Gefolge des Ribbentrop-Molotow-Pakts und des folgenden deutschen Angriffs das polnische Staatsgebiet unter sich aufteilten. Nachdem schon die nationalsozialistische Besetzung Polens in ihrer repressiven Gewalt weit über die Ostpolitik des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg (mit der Proklamation des Königreichs Polen 1916) hinausging, machten der Angriff Hitler-Deutschland auf die Sowjetunion im Juni 1941 und die genozidalen Folgeereignisse ganz klar, dass das nationalsozialistische Programm der Gewinnung von ›Lebensraum‹ im Osten etwas qualitativ Neues bedeutete.
Ob die mit dem »Unternehmen Barbarossa« provozierte Umkehrung der Allianzen für Polen positiv zu Buche schlagen würde, war noch nicht abzusehen. Einerseits stand Polen erstmals mit der Sowjetunion (und damit mit dem großen ostslawischen ›Brudervolk‹) sowie im Bündnis mit den Westmächten in einer Front gegen den deutschen Aggressor; andererseits erschwerte die sowjetische Besetzung und Annexion des frühen Ostpolen und Stalins Beharren auf seinem Landgewinn für die polnische Seite einen seriösen Interessenausgleich. Die Entdeckung der Massengräber von Katyn führte dann 1943 zum definitiven Bruch zwischen dem Kreml und der polnischen Exilregierung in London.
Aus – durchaus selbstkritischer – deutscher Sicht gehört zu den eigenartigen Phänomenen der alliierten Perzeption des deutschen Feindes im Zweiten Weltkrieg und danach die starke Negativfixierung auf Preußen. Insbesondere Sowjet-Russland und Polen sahen den preußischen Staat, wenn nicht schon den Ordensstaat des Mittelalters, übereinstimmend als Ursprung des ewigen deutschen Drangs nach Osten und überhaupt alles Reaktionären in der deutschen Geschichte. Und so erschien die Zerstörung des Staates Preußen durch Abtrennung seiner östlichen Kernprovinzen und durch formelle Auflösung qua Beschluss des Alliierten Kontrollrats als Korrektur einer langen Fehlentwicklung und des Vollzug der historischen Gerechtigkeit. Auch das Projekt der totalen Entgermanisierung der Gebiete jenseits von Oder und Neiße durch Zwangsaussiedlung der dort lebenden Deutschen, das schon während des Krieges nach und nach Gestalt angenommen hatte, wurde nicht zuletzt aus dieser geistigen Quelle gespeist.
Für die Polen, nicht nur für die Kommunisten, die die Vertreibung jedoch für sich zu nutzen wussten, ging es neben der Wiedergutmachung für alle nationalen Demütigungen seit 1772 auch um eine Kompensation für die verlorenen, wenngleich mehrheitlich ukrainisch und weißrussisch besiedelten Gebiete im Osten und um die Neuansiedlung der bis dahin dort lebenden Polen. Die Deutschen in ihrer übergroßen Mehrzahl konnten sich 1945 nicht vorstellen, dass die von den Siegermächten auf der Potsdamer Konferenz vereinbarte bzw. abgesegnete Übergabe der bis dahin ostdeutschen Gebiete und der Bevölkerungstransfer, jedenfalls in dem beschlossenen Umfang, dauerhaft wären. Auch die Mitglieder der SED in der Sowjetzone taten sich schwer, die Oder-Neiße-Grenze zu akzeptieren, mussten dann aber unter sowjetischen Druck ihr Einverständnis erklären und nach Gründung der DDR die »Friedensgrenze« formell anerkennen (Görlitzer Abkommen von 1950).
Man muss heute nachdrücklich daran erinnern, wie schwer es für die Westdeutschen, besonders für die Führungsschicht aller damals relevanten Parteien, war, die Vertreibung und den Verlust eines großen Teils des deutschen Territoriums hinzunehmen: von Oberschlesien und den Masuren abgesehen, nach allgemeinem Verständnis seit Jahrhunderten rein deutsches Land. Die Vertriebenen waren in der früheren Bundesrepublik überall mehr oder weniger präsent, und in allen politischen Formationen hatten die Landsmannschaften, die die früheren Bewohner der Ostprovinzen jenseits von Oder und Neiße »unter polnischer bzw. sowjetischer Verwaltung«, wie es hieß, sammelten (daneben gab es Landsmannschaften der Angehörigen anderer Vertreibungsgebiete) und offiziell als deren Vertretungen anerkannt waren, beträchtlichen Einfluss, auch in der Sozialdemokratie. Zweifellos spielte bei den Hemmungen, sich wenigstens zu einer de-facto-Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze durchzuringen und den Polen für den Fall der Wiedervereinigung Deutschlands diesbezüglich Entgegenkommen in Aussicht zu stellen, auch die Furcht eine Rolle, die Vertriebenen könnten sich rechtsextremen Kräften oder der jeweiligen parteipolitischen Konkurrenz zuwenden.
Die Bundesrepublik vertrat in den 1950er und 60er Jahren den Standpunkt, dass Deutschland völkerrechtlich in den Grenzen von 1937 – also vor Beginn der Expansion des Hitler-Staates – fortbestehe; in der Tat gab es ja keinen Friedensvertrag. Im Potsdamer Abkommen der Siegermächte mit seinem rechtlich nicht ganz klarem Status war die Frage der Ostgrenze nur provisorisch geregelt, wenn auch die dort einvernehmlich beschlossene Aussiedlung die Rückkehr zu den Vorkriegsverhältnissen auf friedlichem Weg recht unwahrscheinlich machte. In der bundesdeutschen Öffentlichkeit, auch seitens der Politiker, wurde die völkerrechtliche Ausgangsposition (Grenzen von 1937) immer wieder als Anspruch auf die Gesamtheit der damit benannten Territorien gedeutet. Äußerungen, dass man allenfalls einen territorialen Kompromiss ins Auge fassen könne, machten sich in einer Phase des Defätismus verdächtig, da – wie ich mich aus meiner Kindheit erinnere – vielerorts Plakate hingen mit der Aufschrift: »Dreigeteilt niemals!« Die drei Teile waren die Bundesrepublik, die DDR und die ehemals ostdeutschen Gebiete.
Diese Zweideutigkeit beim Offenhalten der Grenzanerkennung im Osten erschwerte den Polen eine realistische Einschätzung der Bonner Position und erleichterte den dort Regierenden die Stimmungsmache gegen die ›westdeutschen Revanchisten‹, bis hin zu einer fast grotesken Fehldeutung Konrad Adenauers, der als Ostlandreiter karikiert wurde. In Wahrheit zielte Adenauers Politik zu allererst auf eine nicht mehr aufhebbare Westbindung der Bundesrepublik unter Hintanstellung der deutschen Einheit Rumpfdeutschlands und ohnehin der Rückgewinnung der Gebiete jenseits von Oder und Neiße. Er legitimierte seine Westpolitik (einschließlich ihres militärischen Aspekts) in der Öffentlichkeit aber mit einem nationalen Motiv: Nur durch die Machtentfaltung des vereinigten Westens könnten die Sowjetunion und sein polnischer ›Satellit‹ veranlasst werden, die Wiedervereinigung des westdeutschen Kernstaats mit ›Ostdeutschland‹ wie mit der ›Sowjetzone‹ zuzustimmen. Adenauer war Realist genug, an ein solches Szenario nicht zu glauben, und (bisweilen zynischer) Machtpolitiker genug, um die Hoffnungen der Vertriebenen und Flüchtlinge auf eine friedliche Totalkapitulation des sowjetisch geführten Blocks zu nähren.
Letzte Ausläufer einer dermaßen doppelb ödigen Haltung waren noch in den mittleren 1980er Jahren unter der christlich-liberalen Regierung Kohl zu spüren, als eines der großen jährlichen Vertriebenentreffen unter der (dann modifizierten) Losung »Schlesien bleibt unser« angekündigt wurde und Regierungsmitglieder die früheren Rechtsvorbehalte explizit erneuerten. Mit der Formel von der »politischen Bindungswirkung« der im Warschauer Vertrag ausgesprochenen Grenzanerkennung Deutschlands nach Osten schloss dann auch Kanzler Kohl an die Linie der Vorgängerregierungen an, was im Übrigen ja auch für die Bonner Ostpolitik insgesamt und für die Beziehungen zur DDR speziell gilt.
Es ist nicht schwer, im Rückblick ein hohes Maß an Dogmatismus und Wirklichkeitsfremdheit gegenüber Polen auf Seiten der westdeutschen Politik in den 1950er und frühen 1960er Jahren auszumachen. Dabei hätten der Wechsel zur Führerschaft Gomulkas 1956 und die folgende Liberalisierung der Bundesrepublik wohl sogar die Chance geboten, ohne Grenzbestätigung zu diplomatischen Beziehungen zu kommen. In der Hochzeit des Kalten Krieges wurde das deutsch-polnische Verhältnis kaum als eigener relevanter Gegenstand politischen Bemühens wahrgenommen, und die einseitige Konzentration auf das Leid der deutschen Vertriebenen unter weitgehender Ignorierung oder Verdrängung des Vorangegangenen ließen einen Neuansatz kaum zu. Doch beginnend in der Publizistik, entwickelte sich in den mittleren 1960er Jahren in der Bundesrepublik eine intensive, alle Aspekte umfassende Debatte über das Verhältnis zu Polen (und sekundär zu den anderen Staaten des östlichen Europa). Die Denkschrift der Kammer für öffentliche Verantwortung der Evangelischen Kirche Deutschlands Die Lage der Vertriebenen und das Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn von 1965 setzte eine wichtige Wegmarke, während sich die deutschen katholischen Bischöfe nicht dazu durchringen konnten, auf die mutige Botschaft der polnischen Amtsbrüder: »Wir gewähren Vergebung und bitten um Vergebung«, adäquat zu antworten. Doch es war etwas in Bewegung gekommen. Eine realistische Sicht verband sich mit einer partiellen moralischen Neubewertung und mit der Perzeption der beginnenden Ost-West-Entspannung, die an Mitteleuropa nicht vorbei gehen sollte. Die Sozialdemokratie als Gesamtpartei gehörte anfangs nicht zu den treibenden Kräften, erkannte in den späten 1960er Jahren aber die Zeichen der Zeit und die Unhaltbarkeit der tradierten Bonner Position in der Grenzfrage. 1970 schrieben der Moskauer und der Warschauer Vertrag – unter dem unumgänglichen Friedensvertragsvorbehalt – die Oder-Neiße-Linie als deutsch-polnische Grenze fest und machten dadurch einen Neuanfang möglich.
Seit 1980 hatte es die Bundesrepublik im Verhältnis zu Polen mit einer veränderten Konstellation zu tun, die sich in eine neue Weltlage einfügte und ein maßgeblicher Teil davon war. Nachdem mit der Forcierung des atomaren Wettrüstens im Sektor der Mittelstreckenraketen, mit der Afghanistan-Invasion der UdSSR und mit dem Regierungswechsel zu Ronald Reagan in den USA (und zuvor zu Margaret Thatcher in Großbritannien) – für Polen gehörte wohl auch die Wahl Karol Wojtylas zum Papst im Oktober 1978 dazu – eine deutliche Verschärfung der Blockkonfrontation einher gegangen war, geriet die Entspannungspolitik der sozial-liberalen Bonner Regierung in die Defensive. Deren in den 1960er Jahren schrittweise entwickeltes und in den 70er Jahren an die Umstände angepasstes Konzept zielte auf Friedenssicherung, in Deutschland zudem auf ›menschliche Erleichterungen‹ und den Erhalt bzw. den Ausbau der gesamtnationalen Kommunikation mit der DDR, langfristig aber auch auf einen reformerischen, von Moskau geduldeten Wandel der bestehenden Systeme von oben. Deren Öffnung und die Aktivierung der Gesellschaft waren einkalkuliert und angezielt, nicht aber die massenhafte Verweigerung, die offene Rebellion der Unteren, wie sie die Arbeiter- und Volksbewegung der Solidarność verkörperte. Entscheidend für die ängstliche Distanz der westdeutschen Sozialdemokratie, jedenfalls ihrer Führung, gegenüber der Solidarność waren nicht ideologische Unterschiede – vor allem anfangs gab es trotz der engen Verbindung der oppositionellen Gewerkschaft mit dem katholischen Klerus in dieser ein starkes radikal- und quasi sozialdemokratisches Element –, sondern die schwer vereinbaren Methoden der Transformation des europäischen Status quo.
Obwohl sich die Bundesrepublik nach dem Regierungswechsel vom Oktober 1982 um demonstrative Bündnisloyalität bemühte, und sich zeitweise wieder auf einen verbalen Schlagabtausch mit der Sowjetunion einließ, blieb das spezifische Dilemma bestehen (und wurde von Bonn weiterhin beachtet), dass es die deutsche Sondersituation gebot, dem Aufkommen eines neuen Kalten Krieges mit Dämpfungsbemühungen entgegenzuwirken. Angesichts der Teilung des Landes entlang der Trennungslinie der hochgerüsteten Paktorganisationen fiel es den Westdeutschen schwerer als anderen Westeuropäern, für die polnische Opposition lautstark Partei zu ergreifen. Ungeachtet dessen war die materielle Unterstützung für Polen aus der Bundesrepublik Deutschland beträchtlich: sowohl die humanitäre Hilfe nicht zuletzt aufgrund massiver Spendenbereitschaft der Bevölkerung im kritischen Winter 1981/82, als auch die gezielten Solidaritätsaktionen gewerkschaftlicher, kirchlicher und anderer Gruppen für politische Zwecke.
Wie immer man die westliche, insbesondere westdeutsche Entspannungspolitik in ihrer Wirkung auf die Umwälzungen von 1989/90 beurteilt, in zwei Punkten lässt sich ein progressiver Effekt kaum leugnen: Erstens nahm die Entspannungspolitik den regierenden Kommunisten, namentlich in Polen, das lange strapazierte Argument des deutschen Revanchismus und Revisionismus, das die Sowjetunion zum Protektor aller Slawen werden ließ und die von ihr aufgezwungene politisch-gesellschaftliche Ordnung zur nationalen Sicherheitsgarantie. Dieser Mechanismus funktionierte seit 1970 trotz gelegentlicher Reinstallationsversuche nicht mehr. Zweitens waren gewisse Auflockerungen im osteuropäischen Bündnissystem wie innerhalb der meisten Einzelstaaten unverkennbar, wozu die auf allen Ebenen intensivierten Beziehungen zu den östlichen Nachbarstaaten beitrugen, und die Dokumente der KSZE-Konferenz von Helsinki von 1975 boten Anknüpfungspunkte für Dissidenten, auch wenn das Beharrungsvermögen der kommunistischen Partei- und Staatsapparate größere Veränderungen noch nicht zuließ.
Vergleicht man den Stand der westdeutsch-polnischen Beziehungen am Ende der 1980er Jahre mit dem zwei Jahrzehnte zuvor, dann darf man von einer ganz erheblichen Verdichtung und Vertiefung sprechen – wohlgemerkt: noch unter der Blockarchitektur. In bestimmten Jahren, während der Aushandlung und Ratifizierung der Ostverträge nach 1970, während der Verhandlungen in Helsinki Mitte der 70er Jahre und dann wieder mit der innerpolnischen und zwischenstaatlichen Neugestaltung 1989/90, gehörten die deutsch-polnischen Beziehungen zu den wichtigsten Teilbereichen der bundesdeutschen Außenpolitik. Doch sogar in diesen Phasen stand die Gestaltung des Verhältnisses zur DDR bzw. – auf lange Sicht – die Lösung der ›deutschen Frage‹ an der Spitze der Prioritätenliste – und damit das Verhältnis zur UdSSR.
Dass der Schlüssel für alles, was »Deutschland als Ganzes« betraf, in Moskau lag, dass der Sowjetunion als vierter Besatzungsmacht und östlicher Vormacht deshalb im Rahmen der deutschen Ostpolitik der erste Platz gebühre – bezüglich der zeitlichen Abfolge ebenso wie bezüglich des Ranges –, war in den vier Jahrzehnten separater Existenz der Bundesrepublik unter allen Regierungen Konsens. Auch die Versuche des Außenministers Gerhard Schröder (CDU 1961-66), über die Einrichtung von Handelsmissionen die Beziehungen zu den kleineren und mittelgroßen Warschauer-Pakt-Staaten zu verbessern, ohne den diplomatischen Alleinvertretungsanspruch und damit das Bemühen, die DDR zu isolieren, aufzugeben, stellten das ›Moskau-zuerst‹-Gebot nicht grundsätzlich in Frage. Von dem paktfreien Jugoslawien und zeitweise von dem auf Eigenständigkeit bedachten Rumänien abgesehen, akzeptierten die im östlichen Europa Regierenden ihrerseits die sowjetische Vorherrschaft.
Die Einstellung der Nachkriegs-Deutschen, auch der Westdeutschen, zur UdSSR war viel ambivalenter als es auf den ersten Blick erscheinen musste. Zwar riss die Traditionslinie der preußisch- bzw. deutsch-russischen Zusammenarbeit (nicht zuletzt auf Kosten Polens) mit dem Zweiten Weltkrieg und den Folgeereignissen ab. Die deutschen Kriegsgefangenen und die zivilen Flüchtlinge vor der Roten Armee, Millionen Menschen, brachten ein vorwiegend negatives Bild, vielfach ein Schreckbild, mit, in dem Russentum und stalinistischer Kommunismus ineinander übergingen: ein expansives Riesenreich, ein despotisches Regime und ein gutmütiges, zugleich zur Brutalität neigendes Volk auf niedriger Zivilisationsstufe. Auch gegenüber der Sowjetunion gilt, dass die dem sowjetrussisch verursachten Leid der Deutschen vorausgegangenen Ereignisse, der Angriff der Wehrmacht und die deutsche Besatzungsherrschaft, wenig reflektiert wurden, bevor die Neue Ostpolitik um 1970 eine Bewusstseinsveränderung beförderte.
Das Gefühl der Fremdheit und der Abneigung gegenüber der UdSSR bestimmte bis in die 1960er Jahre auch die Haltung der meisten führenden Politiker Westdeutschlands. Für Adenauer ist das offensichtlich, doch auch der erste Vorsitzende der SPD nach dem Krieg, Kurt Schumacher, der in der Außen-, Sicherheits- und Deutschlandpolitik andere Prioritäten setzte, verband seine rigorose Ablehnung des Sowjetsystems mit ziemlich klischeehaften Vorstellungen über Russland.
Und trotz alledem hielt sich, leicht wieder zu beleben, die alte deutsche Faszination von dem großen Land im Osten, dem gegenüber Intellektuelle wie auch einfachere deutsche Menschen seit jeher eine Art Seelenverwandtschaft empfinden konnten. Der Respekt gebildeter Russen vor der deutschen Kultur (und vor der Effizienz und dem technischen Können der Deutschen) beeindruckte auch die Deutschen. Unter Umständen konnten die auf den Zweiten Weltkrieg bezogenen Leiderfahrungen beider Seiten sogar eine Brücke für eine Annäherung bilden.
Natürlich ist die Verknüpfung Deutschlands mit Polen noch erheblich enger als mit Russland, im Positiven und im Negativen. Trotz der Anstrengungen des Deutschen Kaiserreichs und später des neu gegründeten polnischen Staates um ethnisch-kulturelle Assimilation der jeweiligen Minderheiten, trotz der rassenideologisch geprägten Annexion bzw. Kolonialisierung des deutsch besetzen Polen ab 1939 – mit dem Ziel, die polnische Nation auszulöschen –, trotz der Flucht und der Vertreibung der Deutschen in den Jahren ab 1945 verschwanden nicht einfach die kulturellen Resultate der jahrhundertelangen Koexistenz von Angehörigen beider Völker im östlichen Mitteleuropa, wobei sich – neben dem Phänomen der kleinen, trotz ihres slawischen Ursprungs zunehmend deutsch assimilierten Ethnien wie der Masuren und Kaschuben – das Zusammenleben besonders eng gestaltete in den Gebieten mit ›schwebendem Volkstum‹ wie in Oberschlesien. Allein die simple Tatsache der Inbesitznahme ganzer Provinzen deutschen Bodens und bedeutender deutscher Städte durch Polen schuf eine für die Beziehungen zwischen Nationen in Europa einzigartige wechselseitige Bezogenheit aufeinander. Aber anders als Russland (aufgrund dessen Größe und Macht) wurde Polen von der Mehrzahl der Deutschen und ihrer politischen Repräsentanten nach 1945 wie vor 1939 nicht als gleichrangiger Faktor des internationalen Staatensystems wahrgenommen, und die Kultur des polnischen Nachbarn fand nicht die gebührende Beachtung, auch wenn sich beides seit den 1960er Jahren langsam zu ändern begann.
Der Umbruch von 1989/90 in Deutschland wie in Polen und andernorts hat die Koordinaten für das deutsch-polnische wie für das deutsch-russische (selbstverständlich auch für das polnisch-russische) Verhältnis grundlegend verschoben. Mit der Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands und dem Rückzug der russischen Truppen ist die frühere, spezifische Bedeutung Russlands bzw. der Sowjetunion für die Außenpolitik der Bundesrepublik obsolet geworden. Der Systemwechsel hat den ideologischen Konflikt beseitigt. Sofern die Russische Föderation als Großmacht, ohne die eine stabile Sicherheitsstruktur auf dem europäischen Kontinent nicht geschaffen werden kann, für die Bundesrepublik weiterhin eine wichtige Rolle spielt, stellt sich die Lage prinzipiell nicht anders dar als für die übrigen Staaten West- und Mitteleuropas von vergleichbarem Gewicht. Es gibt in Deutschland, über die Regierungswechsel von 1998 und 2005 hinweg und ungeachtet unterschiedlicher Akzentuierungen, heute einen weit reichenden Konsens, dass Polen für die deutsche Außenpolitik einen wesentlichen Faktor bildet, auch seiner geostrategischen Lage wegen. Im Hinblick auf dessen Mitgliedschaft in der EU (wie in der NATO) bestehen zwangsläufig engere Beziehungen zu Polen als zu Russland. Zudem lässt sich nicht bestreiten, dass die kulturelle wie technologisch-wirtschaftliche Kluft zwischen Deutschland und Polen nicht so tief ist wie zwischen Deutschland und Russland. Dabei fallen weiterhin lange zurückliegende Vorgänge ins Gewicht wie die Trennung der Ost- von der Westkirche (kulturell einschneidender als die Verselbstständigung des Protestantismus) und die viel stärkere Beteiligung Polens an der gemeineuropäischen Geistesgeschichte. Dazu kommen die unvergleichbaren geographischen Dimensionen Russlands.
Weitgehende Übereinstimmung herrscht bei den deutschen Politikern aber auch darüber, dass den Beziehungen der Bundesrepublik wie auch der EU zu Russland ein hoher Stellenwert zukommt, der sich in einer institutionalisierten Zusammenarbeit und Partnerschaft ausdrücken soll. Ein enges kooperatives Verhältnis zu Russland berührt nicht allein die militärisch-politische Sicherheit zumindest im nördlichen Teil der eurasischen Landmasse. Die Verzahnung zweier komplementärer Wirtschaftszonen scheint sich anzubieten. Und im günstigen Fall könnte ein geregeltes Miteinander der beiden Subkontinente die politische und Rechtskultur sowie die demokratisch-emanzipatorischen Tendenzen im Innern Russlands stärken.
Vortrag beim Ost-West-Forum Gödelitz am 27.03.2009
Literaturhinweise:
Manfred Alexander, Kleine Geschichte Polens, Stuttgart 2003.
Winfried Baumgart u. a., Preußen-Deutschland und Rußland vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, Berlin 1991.
Dieter Bingen, Die Polenpolitik der Bonner Republik von Adenauer bis Kohl 1949-1991, Baden-Baden 1998.
Friedhelm Boll u. a. (Hg.), Versöhnung und Politik. Polnisch-deutsche Versöhnungsinitiativen der 1960er Jahre und die Entspannungspolitik, Bonn 2009.
Wodzimierz Borodziej/Klaus Ziemer (Hg.), Deutsch-polnische Beziehungen 1939-1945-1949, Osnabrück 2000.
Norman Davies, Im Herzen Europas. Geschichte Polens, München 2000.
Thomas Goll (Hg.), Polen und Deutschland nach der EU-Osterweiterung, Baden-Baden 2005.
Franciszek Grucza (Hg.), Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen: Sprache, Literatur, Kultur, Politik. Material des Millennium-Kongresses 5.-8. April 2000, Warszawa 2001.
Adam Krzeminski, Deutsch-polnische Verspiegelungen. Essays, Wien 2001.
Horst Guenther Linke (Hg.), Quellen zu den deutsch-russischen Beziehungen 1801-1917, Darmstadt 2001.
Ders. (Hg.), Quellen zu den deutsch-sowjetischen Beziehungen 1917-1945; 1945-1991, 2Bde., Darmstadt 1998/99.
Reiner Pommerin/Manuela Uhlmann (Hg.), Quellen zu den deutsch-polnischen Beziehungen 1815-1991, Darmstadt 2001.
Thomas Urban, Von Krakau bis Danzig: eine Reise durch die deutsch-polnische Geschichte, München 2000.
Klaus Zernack, Preußen-Deutschland-Polen. Aufsätze zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen, Berlin 1991.