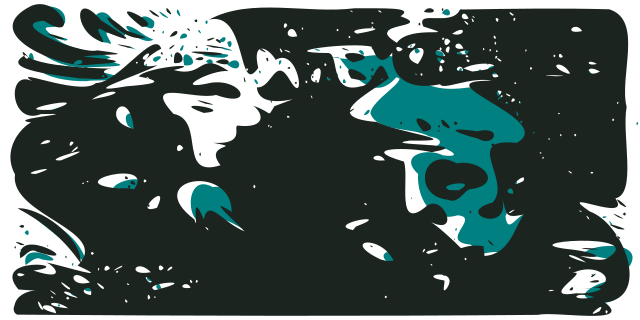Notizen anlässlich einer Tagung in der Münchner Siemens-Stiftung im November 2007
von Dietrich Harth
Eine alte Mär erzählt, die Vorfahren der mittelamerikanischen Völker aus vorkolonialer Zeit – Olmeken, Maya, Azteken, Mixteken – stammten aus China. Auch wenn es dafür keinerlei Beweise gibt, Narren lassen sich immer finden, die solche gegen gutes Geld aus dem Nichts hervorzaubern. In einem mit Kuriositäten gespickten schelmischen Vortrag ging Gordon Whittaker von der Universität Göttingen diesen angeblich wissenschaftlich seriösen Beweisgängen nach – und kam doch nur zur Erkenntnis, dass Winde und Wellen zwar den altchinesischen Seefahrern hätten nützen können, dass aber außer der einen oder andern Ähnlichkeit im Allgemeinmenschlichen von Evidenzen für die Stichhaltigkeit der alten Mär nicht die Rede sein kann.
Whittakers Vortrag stand am Ende einer Tagung, die Anfang November 2007 eine internationale Gruppe von Mesoamerikanisten – Mesoamerikanistik ist eine Teildisziplin der Altamerikanistik, sie erforscht die präkolumbischen und kolonialen Kulturen Mittelamerikas, das von den Wüsten Nordmexikos bis Honduras und El Salvador reicht – und Asienwissenschaftlern in der Münchner Carl-Friedrich-Siemens-Stiftung zusammenführte. Eingeladen hatten die Sinologin Xiaobing Wang-Riese (München) sowie der Ethnologe und Mesoamerikanist Daniel Graña-Behrens (Frankfurt am Main), die beide in einem von der VW-Stiftung geförderten Tandem-Projekt mit dem Titel Writing, Ritual and Cultural Memory in Early States kooperieren. Die Münchner Tagung, der vor zwei Jahren eine Konferenz in Shanghai vorausgegangen war, bezog sich auf die anthropologisch höchst relevante Thematik Tod und Ahnenkult sowie auf Zeitvorstellungen und Kalendergestaltungen in den antiken Gesellschaften Chinas und Mittelamerikas.
Wenn ein echter Kulturvergleich angestrebt war, so konnten die vorgetragenen Beobachtungen jedoch bestenfalls mit Parallelen oder zufälligen Ähnlichkeiten zwischen beiden Kulturräumen aufwarten. Ein Vergleich im Sinn einer methodisch kontrollierten Komparatistik muss wegen des offensichtlichen Mangels an strukturellen Gemeinsamkeiten scheitern und ist nicht zuletzt wegen der großen geopolitischen und ökonomischen Unterschiede in diesen frühen Gesellschaften kaum zu rechtfertigen. Und dennoch, die Teilnehmer waren sich einig, dass der größte Nutzen in der, wie es der Mittelamerikaforscher Maarten Jansen (Leiden) nannte, interkulturellen Verständigung der Wissenschaftler über ihre Begriffe und Methoden liegt.
Das ist sicher richtig und hat auch seinen systematischen Grund. Denn die alten Kulturen, die im Mittelpunkt der Tagung standen, sind weder gegeben noch sind sie – wie es ein schlichter Begriff von Kultur nahelegen könnte – als homogene oder organische Einheiten zu betrachten. Im alten China sind es z. B. – worauf in den Diskussionsrunden hingewiesen wurde – die mit Dynastie- und Machtwechseln einhergehenden Formen gewaltsamer memoriae damnatio, die es verbieten, ein historisches Kontinuum etwa der Herrschergenealogien zu unterstellen; Robert Gassmann (Zürich) präsentierte Beispiele für Abweichungen anhand der Ahnenkulte der Östlichen Zhou-Dynastie (1020-770 v. u. Zt.). In Mittelamerika hat der nicht weniger gewaltsame spanische Kolonialismus nicht nur vorkoloniale Traditionen ausgelöscht, sondern auch neue, hier könnte man mit Recht sagen, ›hybride‹ Kultur- und Lebensformen hervorgebracht, eine Tatsache, deren sich die retrospektiv arbeitenden Historiker und Archäologen bei ihren Rekonstruktionsversuchen stets bewusst bleiben müssen. Im einen wie anderen Fall kommt die fragmentarische, oft nur durch spärliche Grabfunde belegte Überlieferungslage hinzu, die den Forschern eine Art kontrollierter Kreativität im Umgang mit Konjekturen und Hypothesen abverlangt. Kurz, bereits die Rede von der altchinesischen oder der mixtekischen Kultur gehört zu den Mutmaßungen (Präsumtionen) und Hypothesenbildungen. Auf diese kann Wissenschaft allerdings nicht verzichten, will sie antizipierend die sprachliche Spur und das fragmentarische Bruchstück in jene sinn- und sinnenhafte Kontextmuster einfügen, die der Kulturbegriff nun einmal assoziiert.
In welchem Maß philologisch-historische Detailuntersuchungen in allgemeine kulturtheoretische und anthropologische Fragen verstrickt sind, zeigten die Vorträge und anschließenden Diskussionen über Todesauffassungen und Ahnenkulte in den ›klassischen‹ Mayagesellschaften (Daniel Graña-Behrens, Frankfurt am Main; Markus Eberl, New Orleans) und in der altchinesischen Gesellschaft der Östlichen Han (Dennis Schilling, München). Es mag trivial erscheinen, aber die ›Gestaltung‹ des Todes gehört in allen Gesellschaften zu den wichtigsten kulturellen Praktiken. Der Tod markiert allemal einen Bruch im Rhythmus des sozialen Lebens, und es gilt diesen möglichst so zu kompensieren, dass die mit ihm eingetretene jähe Veränderung das jeweilige System anerkannter Werte nicht stört.
Die formenreichen Toten- und Bestattungs-Rituale der Maya schrieben dem Ableben die Bedeutung eines Opfers zu, das den substantiellen Lebenstrieb, natürliche Fruchtbarkeit, nicht verneinen, sondern bestätigen sollte. Eine dem modernen Europäer noch vertraute, wenn auch längst abgeschwächte Form der Kompensation ist die symbolische Verkörperung des Totengedenkens im Grabmal. Im alten China hatten diese Grabsteine oft die Gestalt monumentaler, über und über mit Schrift bedeckter steinerner Tafeln (Stelen), deren Texte sich rituell verlebendigen ließen, ein dramatischer Moment im kommemorativen Ahnenkult.
Überhaupt scheinen Schrift und schriftähnliche Zeichentexturen, soweit sie in haltbarem Material überliefert sind, einen Schlüssel zu der mit dem Begriff ›Tradition‹ verbundenen Vorstellungswelt der frühen Gesellschaften zu liefern. Nicht zufällig stehen im Zentrum der bekannten Heidelberger Theorie des Kulturellen Gedächtnisses Schrift und Schriftkultur als mediale Agenzien gesellschaftlicher Kohärenzbildung und Identitätsstiftung. Zwar wurde diese Theorie während der Tagung kontrovers diskutiert, sie wurde jedoch auch, zumindest was das Leitkonzept ›Kulturelles Gedächtnis‹ betrifft, als ein Angebot für die Funktionsanalyse jener Texte akzeptiert, die zu den Kontexten der Todesgestaltung in den verschiedenen Kulturen gehören. Doch Schrift ist nicht überall Schrift, Text nicht einfach Text im gewöhnlichen Sinn.
Signifikante Unterschiede fielen vor allem dort ins Gewicht, wo es darum ging, mit herkömmlichen philologischen und rhetorischen Mitteln die Semantik der piktographischen, in den mittelamerikanischen Gesellschaften verwendeten (Schrift)Zeichen zu rekonstruieren, bevor sich überhaupt triftige Aussagen über mögliche soziale Funktionen, etwa die gemeinschaftsstiftenden rituellen bzw. zeremoniösen Formen einer kommemorativen Ahnenverehrung machen lassen. Verwirrend genug ist die Tatsache, dass sich in den heute noch lebendigen Spielarten des kollektiven Erinnerns in Mittelamerika eine intermediäre Gestalt des Kulturellen erhalten hat, die auf das Zeitalter der Conquista und die von den spanischen Missionaren ausgeübte kulturelle Gewalt zurückgeht.
Die noch vor allen kultur- bzw. sozialhistorischen Aussagen notwendige Analyse der in Gestalt schwer entzifferbarer Grapheme und Glyphen erhaltenen Dokumente verlangt oft nach einer komplizierten Kombination sehr verschiedener zeichen- und textanalytischer Methoden. So ist zum Beispiel die Entzifferung der chinesischen Grapheme auf den Orakelknochen der Westlichen Zhou-Periode nicht nur eine notwendige Vorbedingung für den Entwurf jener Deutungshypothesen, die auf den Sinn religiöser Inhalte und ritueller Praktiken zielen; sie ist auch – wie Ken-ichi Takashima (Vancouver) demonstrierte – eine Herausforderung an den konventionellen Methodenkanon. Und wiederum mit ganz anders beschaffenen Schwierigkeiten haben die Wissenschaftler zu kämpfen, die auf eine kolonialistisch überformte Überlieferung angewiesen sind, um etwas über die vorkolonialen, hier die präkolumbischen Auffassungen von Kult und Zeit erfahren zu können (Victoria Bricker, New Orleans). In letzterem Fall geht es nicht nur darum, vom Fragment ausgehend, auf ein hypothetisch entworfenes Ganzes zu schließen; vielmehr ist hier kritisch zu reflektieren, in welchem Maß der europäische Kolonialismus an den Zerrbildern der Fremdkulturen mitgewirkt hat und vermutlich heute noch exotistische Präjudizien bestärkt.
Aber trotz den so ganz unterschiedlichen Überlieferungsgeschichten haben die Asien- und die Mittelamerikaforscher gleichermaßen Anteil an den Grundproblemen methodisch kontrollierter Rekonstruktionen und Sinndeutungen. Eine Gemeinsamkeit, die – so darf man vermuten – eher zum kulturellen Gedächtnis der philologisch-historischen Disziplinen gehört, als zu dem der von ihnen in den Blick genommenen Fremdkulturen. Ohnehin bedarf die Projektion der Gedächtnismetapher in die Lebenswelten längst vergangener, schwer zugänglicher Gesellschaften einer sehr genauen Überprüfung. Und die wird dort beginnen müssen, wo sprachliche und semantische Äquivalente zu den uns vertrauten Wörtern (memoria, memory, Erinnerung, Gedächtnis etc.) in den überkommenen Quellen zu vermuten sind.
Die Frage nach der Genese eines historischen Bewußtseins, von der Xiaobing Wang-Riese (München) in ihrem Vortrag über die Vergangenheits- und Zukunftsvorstellungen der altchinesischen Shang- und Zhou-Dynastien ausging, setzt zum Beispiel ein erwiesenermaßen modernes Geschichtsverständnis und einen avancierten Begriff historischen Erinnerns voraus. In diesem Zusammenhang sind, wie auch die Diskussion im Anschluss an Maria Khayutinas (München) Beitrag über die Königskalender der Westlichen Zhou zeigte, Zweifel an der notorischen Unterscheidung zwischen zyklischen und linearen Modellen der Geschichtsbewegung angebracht. Zumindest kann die Zeitforschung in den hier verhandelten Feldern von skeptischer Distanz gegenüber der Verbreitung dieser Modelle nur profitieren. Edward Shaughnessys (Chicago) Vortrag über die Kalender der Westlichen Zhou ließ jedenfalls keinen einfachen Vergleich zu. Denn beinahe poetisch, vor allem aber divinatorisch überhöht haben die Zhou die Wochen und Monate je nach Intensität des Mondlichts eingeteilt und entsprechende »auspicious moments« hinzugefügt.
An der Oberfläche der kalendarischen Zeitmessung nach Mond- und Sonnenphasen mögen viele Kulturen untereinander Familienähnlichkeiten aufweisen, an den großen Unterschieden in der Anwendung von Zeitbegriffen auf die Erfahrungen des vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Lebens ändert das nichts. Es ist die Erkenntnis dieser Unterschiede, in deren Licht erst verständlich wird, was es heißt, von anthropologisch gültigen Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen, raumzeitlich weit auseinanderliegenden Kulturen zu reden. Zu diesen Gemeinsamkeiten gehören nicht zuletzt die oft verborgenen Wechselbeziehungen zwischen symbolischer und materieller Kultur. Geht man davon aus, dass unsere Erkenntnisse über längst vergangene Lebenswelten zu einem guten Teil den Ausgrabungen ihrer materiellen Teilkulturen zu verdanken sind, so ist es naheliegend, auch nach jener Geschichte der Dinge zu fragen, an der George Kubler die kulturell variierenden Formen der Zeit ablesen wollte (The Shape of Time. Remarks on the History of Things, New Haven & London 1962). Denn Dauer ist nicht nur eine chronographisch bzw. kalendarisch messbare Größe, sie ist auch eine Funktion des von Hand bearbeiteten und beschrifteten Materials: Ob die Wahl auf Stein, Terrakotta, Pergament oder Bronze als Schrift- und Zeichenträger fällt, ist in diesem Zusammenhang alles andere als trivial.
Dem Münchner Dialog zwischen Asienwissenschaften und Altamerikanistik ist eine Fortsetzung zu wünschen. Wichtige methodologische und kulturtheoretische Fragen wurden angeschnitten, vieles blieb offen und verlangt nach einem systematisch vertieften transdisziplinären Gespräch. Auch die kleinteiligste Arbeit am philologisch-historisch definierten Detail ist auf Verstehensprozesse und methodisch kontrollierte Begriffsstrategien angewiesen und will erklärtermaßen zum Verständnis der weit abgelegenen Kulturphänomene beitragen. Das ist ein hoch gestecktes Ziel, und deshalb ist es um so wichtiger, im Dialog mit anderen die Voraussetzungen der eigenen Arbeit offen zu legen und wechselseitige Kritik nicht zu scheuen.