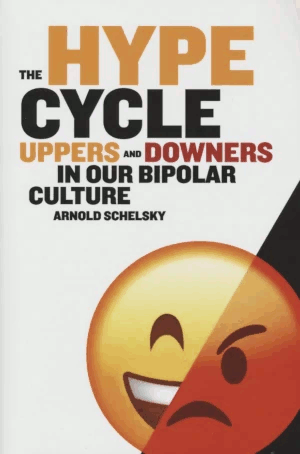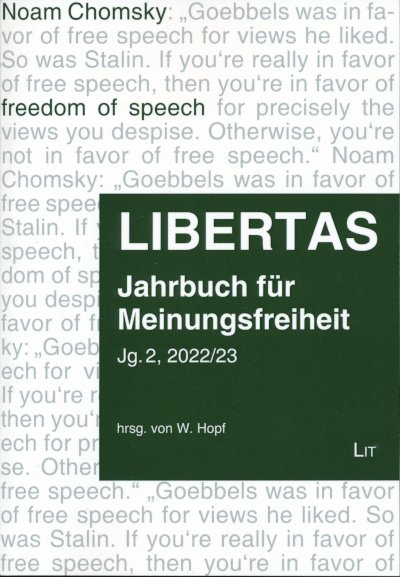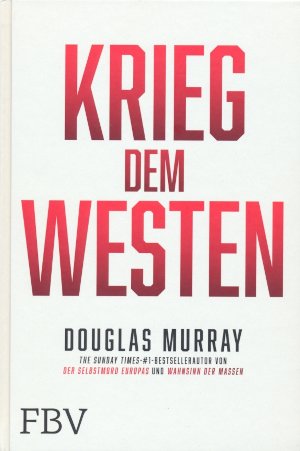von Ulrich Siebgeber
Wann immer eine irreguläre Gewalttat oder eine Ballung endemischer Gewalt Zutritt zum öffentlichen Bewusstsein erlangt, prallen die Sprache der politischen Korrektheit und ihr Gegenbild, die öffentliche und private Hass- oder Wutrede, aufeinander. Zweifellos handelt es sich um ein Ritual, dessen wenig geheime Bedeutung darin besteht, ›das Schlimmste‹ zu verhüten: das Überspringen der Gewalt in die allgemeine Praxis oder in eine ›neue Dimension‹, wie es euphemisierend bei den Verantwortlichen heißt.
Political correctness und hate speech: begriffslogisch handelt es sich um korrelative Begriffe, einst geprägt, um einer linksliberalen Politikauffassung das Navigieren in einem von sozialer Ungleichheit und ideologischer Borniertheit geprägten Umfeld zu erleichtern. Das ist lange her. Heute gehören sie zum Schmäh-Vokabular einer entgleisenden Debattenkultur, in der die Erregung konsequent das Argument dominiert. In ihrem strikten Wechselbezug sind sie Varianten der Stereotypen-Rede, deren Muster und Wirkungsmechanismen jahrzehntelang systematisch erforscht wurden, ohne dass die Ergebnisse dieser Arbeit sich jemals auf die öffentliche Sprechtätigkeit ausgewirkt hätten. Sicher liegt das auch an der Vielzahl von Studien, in denen Stereotype vorrangig mit Vorurteilen, Hass und struktureller Gewalt in Verbindung gebracht werden. Wissenschaft schützt nicht vor Parteilichkeit: Stereotype sind stets die der Anderen.
Etwas daran ist zweifellos wichtig – und richtig. Schließlich dienen Stereotype der Abgrenzung vom jeweils Anderen, die mittelbar in Kontrolle übergeht. Wer einmal ins Schema fällt, kann identifiziert, isoliert und auf Distanz gebracht werden. Das lässt sich verbal oder dinglich ins Werk setzen: durch klassifizierende Herabwürdigung, durch physische und psychische Demütigung, Bestrafung, Missachtung, durch sozialen Tod, durch manifeste Ausgliederung wie Haft, Abschiebung, Ghettoisierung, schließlich durch Proskription und Markierung im Hinblick auf künftige Auseinandersetzungen. Wer den Gegner kontrolliert, kontrolliert in der Regel auch die eigenen Leute, soll heißen, er schreibt ihnen vor, welche Empfindungen, Bilder und Worte ihnen einfallen, sobald sie über ihr Gruppen-Wir zu kommunizieren beginnen.
So weit, so bekannt. Weniger bekannt scheint zu sein, dass die Aufrechterhaltung von Ordnung, sofern sie, von normaler Polizeiarbeit abgesehen, allein oder überwiegend mit Hilfe von Stereotypen gelingt, allen Bedenken zum Trotz den milderen Regimen zugerechnet werden muss. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Stereotype, hinter denen keine unmittelbare Gewalt droht, sich in der Praxis nicht ungebremst durchsetzen lassen. Sie werden, je nach den Erfordernissen des Alltags, zurechtgeschliffen, interpretiert, beiseitegeschoben, gelegentlich ins Gegenteil verkehrt, ohne dass es dazu einer förmlichen Aufhebung bedürfte. Und sie müssen sich der Konkurrenz der Argumente stellen, wann immer die konkrete Situation es erforderlich macht. Natürlich weiß das die Mehrheit. Doch der Doppelcharakter der Hassrede treibt die Parteien unweigerlich gegeneinander und verschließt die Einsicht in das, was als spontane Einsicht dem Spiel der Stereotype zugrunde liegt. Diese Einsicht ließe sich folgendermaßen zusammenfassen: Erst das Gruppengefühl lässt den Einzelnen über sich hinauswachsen und verleiht ihm die Stärke, die zur Bewältigung größerer Daseinsprobleme vonnöten ist. Die Gruppe wiederum ist stärker als jedes Hindernis auf dem Weg zum besseren Leben – und sei es der Tod. Der ›Kampf‹ der Gruppe – nicht ums Dasein, sondern für eine angenehmere, bedürfnisoffenere, bedarfsgerechtere, selbst-gerechtere Welt – eröffnet das ›bessere‹ Leben, dessen bedeutendster Teil im Hochgefühl liegt. Stereotype sind, anthropologisch gesehen, Kodifikationen dieses Hochgefühls.
Der Primat des Sozialen kommt nicht von ungefähr. Gleichgültig, ob man seinen Ursprung in der Jagdgemeinschaft und den räuberischen Instinkten der Kleingruppe, in prototypischen familiären Bindungen oder in den Notwendigkeiten der Arbeitsteilung, in den hierarchischen Strukturen von Großorganisationen oder in der Angst des Einzelnen vor dem Unbekannten verankert sieht – das Ergebnis bleibt immer dasselbe. Gemeinsam sind wir stärker. Dieser Satz ist vielleicht die erste und mächtigste aller Stereotypen. Gewiss liegt er allen anderen zugrunde. Man versteht wenig oder nichts von Religionen, wenn man sie als einen Mix aus überkommenen Glaubenssätzen und archaischen Praktiken ansieht, die unbegreiflicherweise und zum Schaden ihrer Anhänger der Erosion durch neue Erkenntnisse und vor allem durch die Zeit selbst trotzen. Während zum Beispiel der Nationalstaat mit seiner bekannten Tendenz, sich Religionen gefügig zu machen, auf ein Territorium und eine gemeinsame Geschichte angewiesen ist, um zu überleben und sich zu behaupten, genügt den Frommen die Ursprungsrede, der gemeinsame ›Quell‹ ihrer Überzeugungen, um zueinander zu finden und ›stark zu sein‹ – auf welchem Boden auch immer. Wer daraus schließen will, dass Religionen stärker sind als Nationen oder postnationale Standards, möge das tun. Auf Zeit gesehen – wie sonst? – handelt es sich wohl eher um ein totes Rennen, bei dem ›am Ende‹ alle wieder miteinander auskommen müssen. Was die Ewigkeit angeht – nun...
Immer wieder zeitigt der Primat des Sozialen groteske, entsetzliche und tragische Ergebnisse. Die liberalen Gesellschaften sind gewarnt: zu seinen schauerlichsten Hervorbringungen zählt der Sündenbock, die erbliche Fratze aller ›Kultur‹, und mit ihm der Pogrom. Doch es gibt weitere – bis hin zum kulturell verhängten Selbstmord einer Gruppe oder ganzer Populationen. Ein zu bedenkendes Beispiel wären Gesellschaften, die zerfallen und sogar absterben, sobald Ressourcen versiegen, auf deren Ausbeutung ihr Selbstbild oder das einer ihrer führenden Schichten beruht. Es marschiert sich leichter in den Ruin als in die Namen- und Gesichtslosigkeit. Apropos: zur Gesichtslosigkeit zählt auch die Geschichtslosigkeit. Es ist stets nur ein kleiner Teil einer Gesellschaft, der über wirkliche Geschichtskenntnisse verfügt. Der Rest fügt sich den Stereotypen und verstaut darin, was man ihm beigebracht hat. Die stereotype Geschichte bändigt die Gesellschaft in der Mitte und lässt sie an den Rändern ausbrechen. Das Spiel der Stereotype führt sich selbst die Opfer (und Helden) zu, die es zu seinem Überleben benötigt.
Es besteht kein Grund, sich über die Anderen zu erheben.