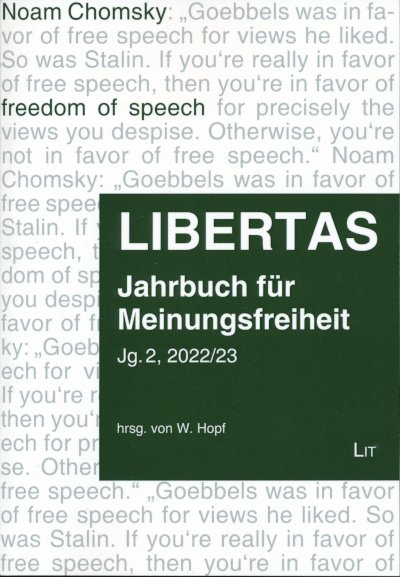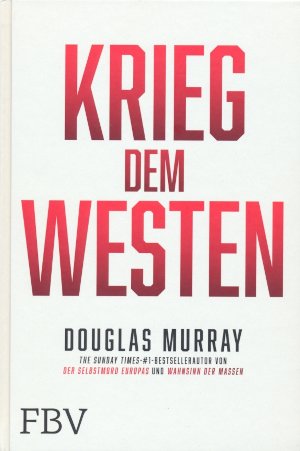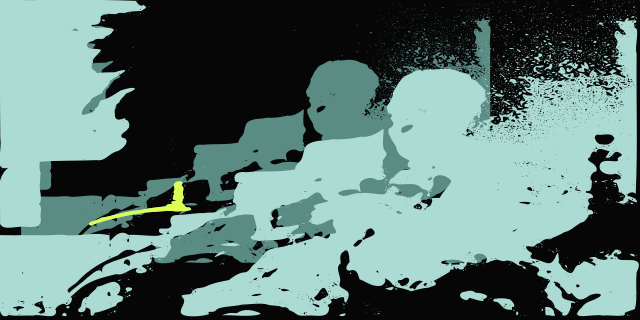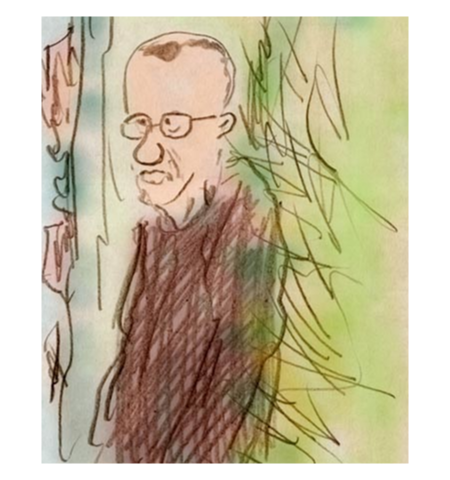von Rainer Paris
Eine soziologische Wortmeldung
In den jahrelangen Debatten um eine angebliche ›Spaltung der Gesellschaft‹, die Zuspitzung kultureller Konflikte oder vielfältige Gefährdungen der Demokratie zeichnet sich eine gewisse Übersättigung ab. Fortdauernder Alarmismus hat das Problem, dass er sich mit jeder Wiederholung schwächt und irgendwann erlahmt. Und auch das Prinzip Penetranz der ideologischen Dauerpropaganda funktioniert nicht ewig.
Soziologische Bestandsaufnahme
In der soziologischen Diskussion über die Zunahme gesellschaftlicher Spannungen und das gegenwärtige Auseinanderdriften der deutschen Gesellschaft haben in letzter Zeit zwei zentrale Publikationen für grundlegende theoretische Klärungen und eine empirische Neufundierung gesorgt. Die von Jürgen Kaube und André Kieserling vorgelegte Studie Die gespaltene Gesellschaft (Berlin 2022) – dem Buchtitel hätte allerdings ein Fragezeichen gutgetan – destruiert überzeugend die allgegenwärtige Spaltungsmetapher zugunsten einer detaillierten Darstellung der sehr verschiedenen – sozialräumlichen, kulturellen und institutionellen – neuen Grenzziehungen und Verschiebungen, die die europäischen Gesellschaften etwa im Vergleich zur amerikanischen Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten durchlaufen haben.
Das Grundargument von Kaube und Kieserling knüpft zunächst an die Luhmannsche Theoriekonzeption funktionaler Differenzierung an. So habe die Rollenteilnahme an den verschiedenen Teilsystemen und religiösen Milieus in Deutschland nie jenen Charakter der institutionellen Separierung und ›Versäulung‹ angenommen, wie er in der Nachkriegszeit zum Beispiel in den Niederlanden feststellbar war. Stattdessen sei das Bild einer scheinbar unaufhaltsamen Polarisierung der Gesellschaft eher den Dramatisierungs- und Zuspitzungsmechanismen von Medien und Parteien geschuldet. Von einer irreversiblen Spaltung in zwei in sich abgeschottete Gegengesellschaften sei die deutsche Gesellschaft jedoch noch ein gutes Stück entfernt.
Auch die verbreitete Deutung eines modernen Tribalismus, also der Aufsplitterung und Paralysierung der Gesellschaft in einem Nebeneinander von ›Stämmen‹, lässt sich auf diese Weise wirksam entkräften. Meine Standardformulierung dafür war immer, die Gesellschaft zerfalle in Bodybuilder, Bankmenschen und Feministinnen. Dem wäre aus der Perspektive von Kaube/Kieserling plausibel entgegenzuhalten, dass es heute keineswegs unwahrscheinlich sei, dass eine erfolgreiche Bankmanagerin sich zugleich als Feministin verstehe und nach Feierabend ein Fitnessstudio aufsuche.
Die andere breit diskutierte Veröffentlichung zu diesem Thema ist die im Herbst letzten Jahres erschienene Untersuchung von Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westheuser Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft (Berlin 2023). Ihr Tenor: Es gäbe zwar eine Vielzahl zugespitzter sozialer und kultureller Konfliktlinien in der deutschen Gesellschaft, die sich insbesondere an sogenannten ›Triggerpunkten‹ (Kluft zwischen Arm und Reich, Migration, Gendern, LGTBQ-Forderungen usw.) festmachten. Dennoch sei auch in diesen Konfliktfeldern und den darin angesprochenen Streitthemen die Schnittmenge gemeinsam geteilter Überzeugungen und Grundeinstellungen zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Teilgruppen – die Autoren verwenden das sehr praktikable deskriptive Klassenschema des Schweizer Soziologen Daniel Oesch – de facto sehr viel größer als es die öffentlich aufgeheizten Debatten vermuten ließen. Von einer auch klassenmäßig verankerten Lagerbildung könne in der deutschen Gesellschaft zumindest zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls keine Rede sein, stattdessen seien es, ähnlich wie bei Kaube/Kieserling, vor allem die Konkurrenzmechanismen des medialen Marktes und des Parteiensystems, die das Zerrbild einer grundsätzlich gespaltenen und polarisierten Gesellschaft hervorbrächten.
Das Verdienst dieser beiden Publikationen besteht zweifellos in einer gewissen empirischen Erdung der zugespitzten, oftmals hysterisch anmutenden Debatten. Kaum etwas wird so heiß gegessen, wie es von um Aufmerksamkeit heischenden Journalisten und Politikern gerne gekocht wird. Trotzdem seien hier einige Argumente angeführt, die die verhalten beschwichtigende Tendenz dieser Untersuchungen – auch die Autoren geben ja keine Entwarnung! – doch ein Stück weit in Frage stellen und für die Zukunft relativieren.
Langzeitgeschichte
Aufzuwerfen ist zunächst die Frage, was die ›Triggerpunkte‹ eigentlich sind und wie sie zustande kommen. Die Autoren bestimmen sie sehr allgemein als »neuralgische Stellen, an denen besonders aufgeladene Konflikte aktiviert werden«. Doch worin besteht der Modus der Aufladung und Aktivierung der Akteure und wie kommt es, dass an den einzelnen ›Punkten‹ derart weitreichende Verallgemeinerungen vorgenommen werden? Hierzu bedarf es meines Erachtens einer umfassenderen emotionssoziologischen Grundierung und Erklärung.
Wichtig ist als Erstes festzustellen, dass die als Triggerpunkte bezeichneten Konfliktthemen einen langen, bereits Jahrzehnte währenden Vorlauf haben. Sie bezeichnen nicht nur aktuelle Kristallisationen verschiedener Ungleichheitsdimensionen (Oben-Unten, Innen-Außen, Wir-Sie, Heute-Morgen), sondern sind gleichzeitig gesellschaftliche und politische Dauerbrenner, die seit einem halben Jahrhundert die Deutschen beschäftigen und umtreiben. So ist beispielsweise die Debatte um die sogenannte ›Gendersprache‹ alles andere als neu. Schon in den siebziger Jahren gab es Ansätze einer rigorosen feministischen Sprachpolitik: Statt ›history‹ sollte es ›herstory‹ heißen, später kamen als Berufsbezeichnungen ›Amtfrau‹ und ›Amtmännin‹ hinzu, in den Achtzigern war dann erstmals von »Mitgliederinnen« des Berliner Senats (Anne Klein) die Rede usw. Es gab auch damals bereits einen Kult um Betroffenheit und den ›Hamburger Belästigungsbegriff‹ (Belästigung ist, was frau als Belästigung empfindet) als Vorläufer heutiger woker Attitüden, und auch die ständige Klage über die Problemferne und Abgehobenheit der etablierten Politik war in Westdeutschland keineswegs unbekannt (›Raumschiff Bonn‹).
Das Gleiche gilt für die zumindest im Hintergrund wirksame linksradikale Propaganda von Multikulti und Antifa. Nie wieder Deutschland! und Liebe Ausländer, lasst uns bitte mit den Deutschen nicht allein – das ist aus heutiger Sicht geradezu ein Programm zur Hervorbringung von Leuten und Politikern wie Björn Höcke.
Doch nicht nur bei den Inhalten der Konfliktthemen, auch in der emotionalen und mentalen Langzeitentwicklung gibt es eine deutliche Kontinuität. So entstand in den achtziger Jahren in der alten Bundesrepublik im Kontext der ›neuen sozialen Bewegungen‹ (Frauen-, Ökologie- und Friedensbewegung) ein äußerst aggressives, vor allem moralisch aufgeladenes Juste Milieu, das schon damals über weite Strecken die kulturelle Hegemonie gewann. Die alles überragende Reiz- und Hassfigur dieses Milieus war Helmut Kohl. Als dieser nach dem Mauerfall vor dem Schöneberger Rathaus eine Rede halten wollte, wurde er vom linksgrünen Westberliner Publikum gnadenlos ausgepfiffen.
In der DDR lagen die Dinge anders. Doch auch hier entwickelte sich ein über lange Jahre aufgestautes Grundgefühl von aggressiver Ohnmacht, Verdruss und Ausweglosigkeit, das erst in der friedlichen Revolution von 1989 massenhaft aufbrach und den Sturz der Diktatur einleitete. Zugleich jedoch verlängerte sich dieses, auf dem Erfahrungshintergrund der DDR auflastende Gefühlsspektrum für einen Großteil der Ostdeutschen in den abgründigen Wirren und biografischen Kränkungen der Neunziger, wobei die Frontstellung nun eine andere, aggressiv gegen die westdeutsche Dominanz gerichtete Färbung annahm.
Mit anderen Worten: Die heutigen politischen und kulturellen Polarisierungen sind keineswegs neu. Sie haben eine Langzeitgeschichte, in der die aktuellen Debatten und Erregungszustände lediglich als Zuspitzung jahrzehntealter Konflikte erscheinen, die in der heutigen Grundsituation kumulierender Krisen allerdings eine neue Brisanz und Dynamik entfalten.
Groll als Grundlage
Wie ist nun diese emotionale Grundströmung, die sich heute in den Triggerpunkten manifestiert, näher zu charakterisieren? Hierzu gab es im Merkur (5/2021) einen schönen Artikel von Sighard Neckel über den Groll. Neckel charakterisiert den Groll als eine »tiefverwurzelte Emotion«, die sich vor allem durch ihre hintergründige Präsenz und Dauerhaftigkeit auszeichnet: »Lange schon trägt er Ärger, Verdruss, eine tiefe Abneigung oder stillen Hass mit sich herum.« Der Grollende ist jemand, der sich in einem elementaren Sinne zu kurz gekommen und zurückgesetzt fühlt; er hat tiefe Kränkungen erfahren, ohne dass er sie bislang in offene Aggressionen umsetzen konnte.
Wesentlich für den Groll ist seine diffuse Ungerichtetheit. Er weiß gewissermaßen nicht, wohin mit seiner bösen Energie. Während andere negative Gefühle wie Neid und Hass in der Regel klare Adressaten haben und sich gegen konkrete Individuen oder Gruppen richten, ist der Groll unbestimmt. Andererseits ist er immer da und kann keinesfalls abgestellt werden. Das heißt: Er ist kein Affekt, sondern hat durchaus den Charakter einer Leidenschaft. Immanuel Kant hat in seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798) die Differenz zwischen Affekten und Leidenschaften folgendermaßen beschrieben: Der Affekt ist »Überraschung durch Empfindung, wodurch die Fassung des Gemüts aufgehoben wird«; er ist unbesonnen, unüberlegt, eine emotionale Überwältigung, die oft rasch verraucht. Die Leidenschaft dagegen ist grundsätzlich von Dauer und intensiviert sich an ihren Erfüllungen. Und er findet hierfür ein plastisches Bild: »Der Affekt wirkt wie ein Wasser, was den Damm durchbricht; die Leidenschaft wie ein Strom, der sich in seinem Bette immer tiefer eingräbt.«
Als immerwährendes, diffuses Gefühl sucht sich der Groll geeignete Anlässe, man könnte auch sagen: Triggerpunkte, an denen er sich entzünden und abreagieren kann. Das bedeutet: Hier lodern keine Affekte, die sich auch wieder beruhigen und politisch besänftigt werden könnten, sondern es treffen tief verankerte Stimmungslagen und feindselige Gefühle aufeinander, die längst den Charakter von Leidenschaften angenommen haben. Dabei kann sich der Groll sicher auch in stärker konturierte Gefühle wie Hass und Verachtung verwandeln, die konkret adressiert sind und ihn fortan kanalisieren. Aber auch dann wird er nicht ganz von ihnen absorbiert werden.
Wenn es also richtig ist, den Groll als tiefsitzende emotionale Grundlage anzunehmen, so bedeutet das, dass die heutigen Konfliktszenarien auch ohne einen Bezug auf strukturelle Klassenlagen oder institutionelle Separierungen eine grundlegende gesellschaftliche Frontbildung, gewissermaßen einen Flächenbrand mit mehreren Brandherden, anzeigen, der mit den Begriffen ›Demokratiegefährdung‹ oder ›Kulturkampf‹ nur unzureichend erfasst ist. Der diffuse Charakter des Grolls könnte auch den empirischen Befund erklären, dass die identifizierten Triggerpunkte offenbar gerade nicht in einem kompakten Syndrom miteinander verbunden sind, sondern sich, abgesehen von den politischen Rändern, durchaus unregelmäßig streuen und in der Bevölkerung verteilen.
Wegbrechen von Normalität
All das ist außerdem auf die Grundsituation zu beziehen, in der sich die westlichen Gesellschaften allgemein und die deutsche Gesellschaft im Besonderen im 21. Jahrhundert befinden. In einer Zeit rapider technischer Umwälzungen, gravierender weltpolitischer Verwerfungen und globaler Risiken vervielfältigen sich die Anlässe für Ängste und Aggressionen, wird – in den Kategorien von Reinhart Koselleck – das Verhältnis von Erfahrung und Erwartung neu justiert. Es setzt sich dabei ein Grundgefühl durch, dass die Gewissheiten der alten, überkommenen Normalität der letzten Jahrzehnte unwiderruflich im Schwinden begriffen sind, während sich eine neue Normalität noch nicht abzeichnet und mit großen Gefahren verbunden scheint. Dies gilt vor allem für abstiegsbedrohte Aufsteiger, bei denen die Nerven blank liegen.
Allen ist mittlerweile klar, dass sich die gewohnten Zustände und Sicherheiten in absehbarer Zukunft tiefgreifend verändern werden, dass also große Umbrüche mit hohen biografischen Risiken ins Haus stehen – eine Situation, die für die deutsche Gesellschaft in besonderem Maße zutrifft. Hier schlagen nämlich zusätzlich die unterschiedlichen Erfahrungen und Grundhaltungen, die Ost- und Westdeutsche nach wie vor voneinander trennen, zu Buche. Was die Westdeutschen heute als bedrohliche Zukunftserwartung und Abstiegsängste umtreibt, haben die Ostdeutschen 1990 als umstürzenden Erfahrungsschock bereits erlebt. Anders als die Westdeutschen wissen sie, was Deindustrialisierung bedeutet. Kein Wunder, dass sie auf entsprechende Anzeichen und ideologische Déjà-vu-Situationen besonders empfindlich und gereizt reagieren. Es ist auch dieser gravierende Unterschied in den prägenden Erfahrungen und dem Gefühlshaushalt der Ostdeutschen, der dafür verantwortlich ist, dass die aggressiven Aufwallungen dort besonders heftig ausfallen.
Die häufigste Metapher im Zusammenhang mit den jüngsten Bauernprotesten war ›der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen‹ bringe. In der Tat: In vielen dokumentierten Äußerungen kam eine ›Schnauze-voll‹-Attitüde von Grundaversion und Kompromisslosigkeit zum Ausdruck, die eine Unversöhnlichkeit anzeigt, die durchaus auf eine neue Qualität der Konflikte schließen lässt. Mein Plädoyer wäre deshalb, die Fragerichtung umzukehren: Was hat denn über lange Jahre hinweg das Fass erst gefüllt? Und welche Akteure und Ideologien waren dabei maßgebend? Wenn es richtig ist, dass die Triggerpunkte letztlich nur Wellenbewegungen an der Oberfläche anzeigen und das Fass tatsächlich dabei ist, überzulaufen, ist es mit etwas mehr Tropfenmanagement jedenfalls nicht getan.