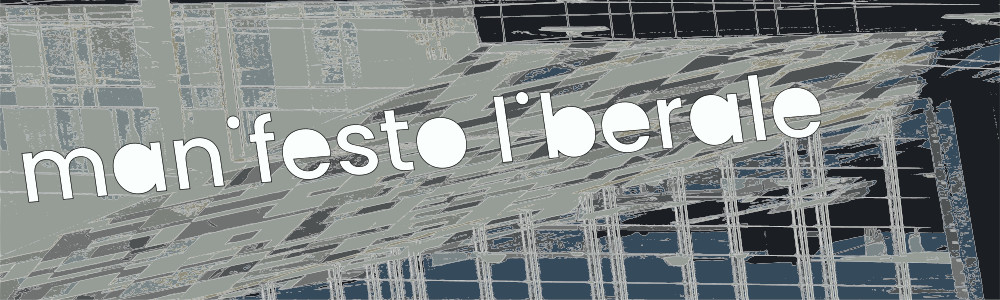Halle 25. Ein Lehrstück
von Ulrich Schödlbauer
Mein lieber ***
auf Ihrem Weblog las ich vor wenigen Tagen die Bemerkung, es sei besser ein wenig Licht zu verbreiten als schmollend im Dunkeln zu verharren. Das ist, ohne jeden Zusatz gedacht, die Formel der Aufklärung, zuzüglich des Schmollens, auf das ich noch zu sprechen kommen werde. Man kann diese Formel heute überall finden. Sie ist der Weichmacher der Informationsgesellschaft, in der die digitalen Flutlichtanlagen jeden Winkel aufs Grellste ausleuchten (und das...