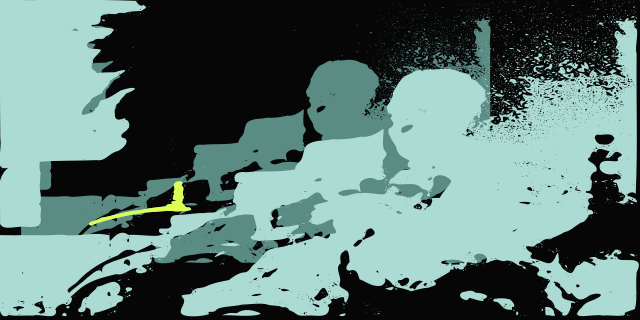von Patrick Pritscha
Perspektivwechsel
Es ist ein verbreitetes Phänomen in der Politik nur die Probleme aufzugreifen, für die eine scheinbare Lösung präsentiert werden kann. Denn oft wird auf Kritik mit der Gegenfrage geantwortet: »Was würden Sie denn tun?«. Wer als Politiker darauf keine Antwort hat, gerät schnell ins Abseits.
Ausgeblendet wird dabei aber, dass es für manche Fragen, Probleme und Konflikte keine ›Multiple-Choice‹- Antworten gibt, bei denen die Lösung einfach nur angekreuzt werden muss, also schon existiert, und es nur eine Frage der richtigen Entscheidung bzw. des politischen Willens ist. So muss es nicht verwundern, dass die öffentlich geführte Debatte um den Afghanistankrieg vor allem ein Thema kennt: Truppenabzug - ja oder nein? Hier sind wir in der klassischen Situation, dass es je nach politischer, ideologischer oder sonstiger Überzeugung nur ein richtig oder falsch geben kann. Und wie immer bei ideologisch motivierten politischen Grundsatzfragen wird die Debatte entsprechend hart und kompromisslos geführt. Dabei ist sie bei näherer Betrachtung erschreckend unruchtbar, denn sie bietet keine Antwort auf die Frage: Quo vadis, Afghanistan?
Dass der westliche Truppeneinsatz aus meiner Sicht kontraproduktiv und vor allem sinnlos ist, steht auf einem anderen Blatt. Dieser Ansicht kann allerdings zurecht entgegengestellt werden, dass keine Truppen auch keine Lösung sind. Deshalb soll der folgende Beitrag kein Plädoyer für oder gegen einen Truppenabzug sein, sondern eher einige Problemstellungen skizzieren, mit denen sich nicht nur die Politik beschäftigen sollte. Wenn die Afghanistanfrage überhaupt einmal gelöst werden kann, dann wäre dies nur möglich, wenn die dortige Situation in ihrer ganzen Komplexität analysiert und verstanden wird.
Ich möchte mich dieser Problemstellung aus einer historischen Perspektive nähern. Wenn Gegenwart die Folge von vorangegangenen Prozessen und Entwicklungen ist, kann ein Blick in die Geschichte dazu beitragen, aktuelle Problemkonstellationen aus ihrer Entstehung heraus zu analysieren und vielleicht sogar zu verstehen. Zu wissen, warum etwas so ist, wie es uns erscheint, also Kausalitäten aufzudecken, kann helfen Lösungsstrategien zu entwickeln oder zumindest bestimmten Entwicklungen nicht mehr völlig hilf- und verständnislos gegenüber zu stehen. Denn zu erkennen, dass es im Werkzeugkasten der Politik nicht für jedes Problem eine vorgefertigte Lösung gibt, ist eine Voraussetzung dafür, überhaupt erst eine fruchtbare Debatte zum Thema zu eröffnen und durch sie möglicherweise neue Strategien und Ziele zu entwerfen.
Krieg und Frieden
Es ist nicht weiter erstaunlich, wenn in unseren Breitengraden an die Betrachtung und Bewertung von gesellschaftlichen Problemlagen eurozentristische bzw. westliche Maßstäbe angelegt werden. Mit der Moderne in Europa und den USA wurde begonnen, Entwicklungsprozesse unter teleologischen Gesichtspunkten zu interpretieren. In Verbindung mit einer jahrhundertelangen Kolonialpraxis verbreitete sich als deren Folge diese Sichtweise global und ist bis in die Gegenwart eine Grundlage politischer Theorie und Praxis. Ob sie aber auch immer und überall tauglich ist, steht auf einem anderen Blatt. Denn machen wir uns eines bewusst: Den Rahmen für die Gültigkeit eurozentristischer Gesellschaftsmodelle und Normen bilden Staat und Nation, eventuell auch noch das Konzept des ›Imperiums‹ (Herfried Münkler). Wo diese nicht greifen oder schlicht nicht vorhanden sind, verlieren auch die damit verbundenen Muster und Ziele ihre Wirksamkeit, ebenso die entsprechenden Handlungsanleitungen. Vor diesem Dilemma steht die »internationale Staatengemeinschaft« in einigen Regionen der Welt. Eine davon ist Afghanistan.
Welche Auswirkungen dies hat, soll an einem Beispiel illustriert werden:
Für ›uns‹ stellen Krieg und Frieden zwei grundsätzlich verschiedene Gesellschaftszustände dar, wobei dem Frieden die allgemein anerkannte und erstrebenswerte Priorität zukommt. Insofern überrascht es nicht, dass »Frieden in Afghanistan« zu den häufig propagierten Zielen der Politik gehört. Dass aber Frieden nichts ›Natürliches‹ ist, zu dem der Krieg nur die Ausnahme darstellt, kann schon der Blick in die Geschichte Europas zeigen.
Nicht nur für die ›barbarischen‹ Germanen stellte der Krieg den Normalzustand dar, während der Friede erst vertraglich vereinbart werden musste (Herwig Wolfram). Selbst die ›zivilisierten‹ Griechen mussten sich 884 v.u.Z. vertraglich auf den jeweils zeitlich begrenzten »Olympischen Frieden« einigen, um die sichere Durchführung der Spiele zu gewährleisten. Die Pax Romana wiederum war eine Herrschaftsideologie, welche einen inneren Frieden im römischen Reich erst mit der imperialen kaiserlichen Alleinherrschaft des Augustus im großen und ganzen durchsetzen konnte. Dass im Gegenzug dafür die Republik, und damit eine nach historischen Maßstäben ›demokratische‹ Regierungsform unterging, war für die meisten Menschen damals nach den jahrzehntelangen Schrecken des Bürgerkrieges wohl das geringere Übel. Mit dem Zerfall des (west-)römischen Reiches war es mit dem inneren Frieden in Europa für über tausend Jahre vorbei.
In den Herrschaftsverbänden des Mittelalters (von Staaten kann keine Rede sein) dominierte das Fehdewesen, welchem die Kirche mit dem Pax Dei (Gottesfrieden) zu begegnen versuchte. Doch erst mit der Errichtung von Zentralgewalten, welche den Absolutismus begründeten, gelang es wieder, in Ansätzen einen ›inneren Frieden‹ durchzusetzen. Dass damit noch lange keine friedlichen Zeiten anbrachen, zeigen die geführten Religions- und Bürgerkriege (Niederlande, Dreißigjähriger Krieg, England usw.) zur Genüge. Dass die Zivilbevölkerung im Laufe der Zeit aus einem Krieg mehr oder weniger heraus gehalten wurde, geht einher mit der Gründung absolutistischer und bürgerlicher Staaten, welche zum einen ein stehendes Heer und zum anderen als mögliche gegenseitige Vertragspartner das Monopol auf die Kriegsführung besaßen. Das heißt, es gab eine überschaubare Anzahl von ›gleichberechtigten‹ Parteien, welche zur Kriegsführung im Stande waren, und eine Diplomatie, welche Einfluss auf Krieg und Frieden nehmen konnte, bei gleichen bzw. ähnlichen Rahmenbedingungen.
Die aufgeführten Gesichtspunkte zusammengefasst, lässt sich sagen: Frieden ist in der europäischen Geschichte ein ›künstlicher‹ Zustand, hergestellt durch Gewalt. Er setzt voraus, dass es entweder Vertragspartner gibt, die zu einer Übereinkunft gelangen und diese durch ein Gewaltmonopol auch einhalten können, oder dass es, wie z.B. unter Augustus, keine Konfliktparteien mit der Möglichkeit zum Kriegführen gibt, da alle relevante Gewalt innerhalb einer Großregion (Imperium) auf eine Institution vereint ist (was Kriege nach außen natürlich nicht ausschließt). Ein längerer ›innerer‹ Frieden innerhalb einer Region ist, historisch gesehen, eher die Ausnahme und in der Regel an bestimmte gesellschaftspolitische Bedingungen geknüpft. Und genau diese Bedingungen sind ebenfalls historisch und nicht naturgesetzlich. Egal, ob wir den Frieden in Europa als Ergebnis eines Lernprozesses nach zwei Weltkriegen oder als Resultat einer Unmöglichkeit der Kriegsführung angesichts der Blockkonfrontation mit drohender gegenseitiger atomarer Vernichtung auffassen: Spätestens der Jugoslawienkrieg in den 1990er Jahren hat gezeigt, wie brüchig die Fundamente einer stabilen ›Friedensordnung‹ auch in Europa sind.
Nehmen wir aber die europäischen Erfahrungen als Maßstab für eine Friedenspolitik in Afghanistan zum Ausgangspunkt, fragt sich, wo angeknüpft werden sollte. Afghanistan ist eher ein Begriff für eine geographische Region, als für einen Staat, geschweige denn für eine Nation. Weder gibt es dort eine Zentralgewalt, noch eine ›überschaubare‹ Anzahl von möglichen Vertragspartnern und es ist in näherer Zukunft auch nicht damit zu rechnen, dass sich dies ändert, weil dafür einfach die Voraussetzungen fehlen.
Facetten der Geschichte und Gesellschaft Afghanistans
An welche gesellschaftlichen Bedingungen eine Friedensordnung nach europäischem Muster unter anderem gekoppelt ist, wurde bereits skizziert. Doch mit welchen Bedingungen haben wir es in der Region Afghanistan zu tun?
In Bezug auf die politische Geografie handelt es sich um eine in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eingerichtete herrschaftslose Pufferzone zwischen Russland, Britisch-Indien und Persien (Conrad Schetter). In der Zeit zum Übergang ins 20. Jahrhundert entstanden in diesem Gebiet die ersten staatlichen Strukturen. 1923 wurde mit der Errichtung der konstitutionellen Monarchie die Unabhängigkeit von Großbritannien manifestiert. Doch das sind überwiegend formale Äußerlichkeiten.
Die Region, von der wir hier sprechen, war weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart in der Lage landwirtschaftliche Überschüsse zu produzieren. Da dies vor allem in den geografischen Gegebenheiten begründet ist, lässt sich daran auch nicht viel ändern. Allein der Transithandel zwischen China, Indien und Persien erlaubte Erträge, die entlang der Handelsrouten die Entstehung von Städten wirtschaftlich ermöglichten. Mit dem Handel und Warentransport verbundene ›Erwerbsformen‹ wie Wegelagerei oder bezahltem Geleitschutz boten Teilen der ländlichen Bevölkerung ein Auskommen. Dass sich daran bis heute nicht viel geändert hat, zeigen die einträglichen Schutzgeldgeschäfte der sogenannten Taliban mit den ausländischen Truppenverbänden (Times vom 12. 12. 2008).
Jede ›staatliche‹ Herrschaft war seit dem 19. Jahrhundert von finanzieller Hilfe aus dem Ausland abhängig. Afghanistan schaffte es in den Hochzeiten des Kalten Krieges sowohl von der Sowjetunion als auch von den USA und der BRD Entwicklungshilfe in Millionenhöhe zu erhalten und damit über 40 Prozent des Staatshaushaltes zu bestreiten.
Unter solchen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist es nicht überraschend, dass es bis heute nicht gelungen ist, eine selbsttragende Wirtschaft aufzubauen, die in der Lage ist, sowohl einen Staat zu finanzieren, als auch die Bevölkerung ›legal‹ zu ernähren. Das einzige, was neben Schutzgeld, Schmuggel und Plünderungsökonomie (Robert Kurz) prosperiert, ist der Drogenanbau. Die Jahresproduktion von rund 8000 Tonnen Opium stellt nicht nur für rund 80 Prozent der Landbevölkerung eine sichere Einnahmequelle dar, sondern deckt darüber hinaus circa 90 Prozent des globalen Drogenbedarfs (Das Parlament 50/2010). Schon allein aus diesen Gründen erscheinen die vollmundigen »Wiederaufbaustrategien« der internationalen Staatengemeinschaft äußerst fragwürdig.
Die in letzter Zeit diskutierten Rohstofffunde und die damit verbundenen »atemberaubenden Möglichkeiten« für Afghanistan (Spiegel-Online 14.06.2010) dürften kaum einen Ausweg bieten. Diese für das Land nutzbringend zu fördern und zu verarbeiten, setzt eine moderne Infrastruktur sowohl in technischer als auch personeller Hinsicht voraus, welche kaum vorhanden ist.
Der Grund für das Scheitern einer solchen notwendigen Infrastruktur liegt an der bisher unüberwindlichen Dichotomie von Stadt und Land. Die wenigen urbanen Gebiete sind mehr oder weniger Inseln in einer Region tribaler Gesellschaften. Dabei handelt es sich um fundamentale Gegensätze und nicht nur um ein Phänomen der »Ungleichzeitigkeit« (Ernst Bloch). Diese auch nur in Ansätzen aufzulösen ist weder den einheimischen Herrschern noch den Interventionsmächten bisher gelungen.
Der extreme Partikularismus der afghanischen Gesellschaft verhindert das Entstehen von halbwegs stabilen politischen Strukturen. Die wichtigsten gesellschaftlichen Orientierungs- und Herrschaftsrahmen sind Dörfer, Clans, Stammesgruppen und religiöse Gemeinschaften. Eine allgemeine Rechtsverbindlichkeit nach europäischen Maßstäben existiert nicht, jedes Anliegen muss mit dem jeweiligen lokalen Oberhaupt verhandelt werden. Politische Bündnisse sind so fragil, dass es in den letzten 200 Jahren gerade einmal zwei Landesherrscher geschafft haben, nicht vertrieben oder ermordet zu werden. Hinzu kommt noch eine extreme Heterogenität in Bezug auf Kultur, Sprachen, Ethnien und Religionen. Finden all diese Aspekte Berücksichtigung, wird es sogar fraglich, ob die militärische Intervention ausländischer Mächte tatsächlich die alleinige Ursache für den bis heute andauernden Krieg in Afghanistan darstellt.
Für die Islamisten beginnt der Afghanistankrieg im Jahre 1974 mit der Verhaftung ihres Führers Mohammad Niyazi und 200 seiner Gefolgsleute (Conrad Schetter). Infolge dieses Ereignisses flüchtet zum Beispiel der spätere Ministerpräsident und berüchtigte Warlord Gulbuddin Hekmatyār nach Pakistan, um von dort aus den Widerstand zu organisieren. Die Machtübernahme durch die kommunistische DVAP in Afghanistan erfolgte hingegen erst 1978 und der Einmarsch der sowjetischen Armee zu Weihnachten 1979.
Doch nicht nur in Bezug auf Kriegsursachen gibt es Unschärfen in der öffentlichen Debatte. Die aktuelle Hilflosigkeit der deutschen Politik ist mit Blick auf die eigene Vergangenheit geradezu unerklärlich, gehörte doch gerade Deutschland seit den 1920er Jahren zu den wichtigsten außenpolitischen Partnern Afghanistans. Schon 1921 kamen die ersten afghanischen Studenten nach Deutschland und 1924 wurde in Kabul die deutsche Nejat-Schule gegründet, deren Absolventen zu den wichtigsten Politikern des Landes wurden, wie der Premierminister Mohammad Yusof (1963-1965) oder der Präsidenten Babrak Kamal (1980-1986). Ende der 1930er Jahre kamen bereits 70 Prozent der Industrieausrüstung und Maschinen aus Deutschland. Nach dem zweiten Weltkrieg gab es zahlreiche Universitätspartnerschaften und in den 1960er Jahren eröffnete das Goethe-Institut und das DAI Dependancen in Kabul. Bis Ende der 1970er Jahre war Afghanistan mit knapp 360 Millionen DM drittwichtigstes Empfängerland von Entwicklungshilfe. Selbst nach der sowjetischen Intervention rissen die deutsch-afghanischen Beziehungen nicht ab, da jetzt die DDR in vielen Bereichen die Nachfolge der BRD antrat. An der Humboldt-Universität wurde sogar das Fach Afghanologie eingerichtet und afghanische Studenten absolvierten ihre Ausbildung nun in Berlin, Leipzig oder Dresden. Diese Zusammenarbeit dauerte bis 1992 an. Im Ergebnis hat sie bis heute mitunter bizarre Spuren zurückgelassen. So hat die Regierung Karzai die Straßenverkehrsordnung der DDR übernommen, inklusive Schildern und grünem Rechtsabbiegepfeil (FAZ 26.7.2008). Deutschland hatte sich über Jahrzehnte hinweg als Partner etabliert, der keine neokolonialen Interessen verfolgte.
Um so verwunderlicher ist es, dass in der gegenwärtigen Politik von diesem reichhaltigen Erfahrungsschatz kein Gebrauch gemacht wird, mehr noch, er scheint völlig verloren gegangen zu sein. Die Kampfeinsätze der Bundeswehr am Hindukusch inklusive der mehr als fragwürdigen KSK-Einsätze haben zusätzlich dazu beigetragen, dass Deutschland nicht mehr als neutraler Unterstützer wahrgenommen wird, sondern als Besatzungsmacht und militärischer Gegner. Die Rolle des politisch-neutralen Vermittlers, wie noch 2001 zur Petersberger Konferenz bei Bonn, dürfte damit verspielt sein.
Fazit
Immer offener tritt zutage, dass die Politik in Bezug auf Afghanistan gescheitert ist und nicht einmal in Ansätzen funktionierende Lösungsstrategien existieren. Doch statt eines ehrlichen Eingeständnisses gibt es offizielle Lageeinschätzungen, bei denen es dem Leser Tränen in die Augen treibt. So schreibt das Bundeswirtschaftsministerium in der aktuellen Länderinformation:
»Die wirtschaftliche Entwicklung ist durch eine praktisch komplett zerstörte Infrastruktur - Energie, Wasser, Transport - weiterhin stark beeinträchtigt. Auch wenn die Sicherheitslage weiterhin schwierig ist und Rechtsunsicherheit und mangelhafte Institutionen den Aufbau behindern: Afghanistan ist grundsätzlich auf dem richtigen Weg. Die von der Regierung angestrebte Wirtschaftsreform kann als soziale Marktwirtschaft bezeichnet werden.« (Hervorhebung P.P.)
(www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Bilaterale-Wirtschaftsbeziehungen/laenderinformationen,did=277744.html?view=renderPrint abgerufen am 6.1.2011)
Diese Verbindung von Analyse und Einschätzung sollte man sich ruhig mehrmals und in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, denn sie bezieht sich auf ein Land, in dem, wie selbst das BMWI zugibt, 80 Prozent der Bevölkerung mehr oder weniger vom Drogenanbau lebt.