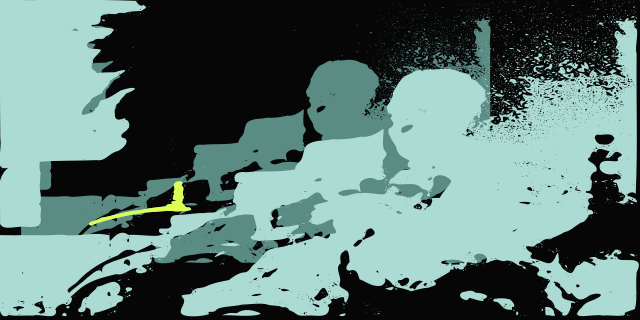von Richard Schröder
In einem neueren Aufsatz (»Dreißig Jahre danach. Die zweite Chance«, Blätter für deutsche und internationale Politik 9/2020) ist Jürgen Habermas der Frage nachgegangen, worauf die hohen Wahlerfolge der AfD im Osten beruhen. Seine Erklärung: Die Ostdeutschen konnten sich nie gründlich mit der NS-Zeit auseinandersetzen, denn sie hatten »weder vor 1989 noch nachher Zugang zu einer eigenen politischen Öffentlichkeit, in der konfligierende Gruppen hätten eine Selbstverständigungsdebatte führen können.«
Es stimmt, dass in der DDR bis 1989 eine mit der bundesrepublikanischen vergleichbare Auseinandersetzung mit der NS-Zeit nicht stattgefunden hat, »weil sich 1945 an die eine Diktatur eine andere angeschlossen hat.« Wahrscheinlich sind die Kontinuitäten und Analogien zwischen den beiden Diktaturen heute vielen nicht mehr präsent, weil sich die SED-Diktatur im Unterschied zur Nazi-Diktatur im Laufe der Zeit mäßigte, zugleich aber der Terror der Frühzeit wirksam tabuisiert war. In der DDR wurde bis 1989 permanent erklärt, die DDR gehöre an der Seite der Sowjetunion zu den Siegern der Geschichte und habe ›den Faschismus‹ (das Wort Nationalsozialismus wurde vermieden) mit Stumpf und Stiel ausgerottet durch die Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln. Das Schlimmste an dieser Faschismus-Theorie: Der Antikommunismus der Nazis wurde so stark betont, dass ihr Antisemitismus dahinter fast verschwand. Die Ermordung Ernst Thälmanns (die Stalin bis 1941 hätte verhindern können) spielte im öffentlichen Gedenken der DDR eine überragend größere Rolle als die Ermordung von 6 Millionen europäischer Juden. Auch das wirkt nach. Dies ist wohl unstrittig.
Habermas behauptet aber zudem, auch 1989 und danach seien die »Bürger der ehemaligen DDR … nicht in den Genuss einer eigenen Öffentlichkeit gelangt.« Zwar habe sich »die Öffentlichkeit der Bundesrepublik für ihre neuen Bürger geöffnet, diesen blieb aber eine eigene Öffentlichkeit verwehrt. So fehlte ein abgeschirmter Raum für die überfällige Selbstverständigung, die nicht präjudiziert würde von einer ›drüben‹ herrschenden Meinung, die es immer schon besser weiß.«
Auf zwei Wegen habe der Westen den Ostdeutschen nach 1989 eine eigene Öffentlichkeit verwehrt und so die Erfolge der AfD im Osten verschuldet. Sie seien nämlich ihrer Zeitungen sozusagen beraubt worden, weil sie von westdeutschen Verlagen aufgekauft worden sind und sie seien ihrer Wortführer beraubt worden, denn die »westdeutsche Presse besorgte … die Abwicklung der ostdeutschen Schriftsteller und Intellektuellen.« Obwohl sie zuvor auch in der Bundesrepublik respektiert waren, galten nun »Stefan Heym, Christa Wolf, Heiner Müller und all die anderen … als die intellektuellen Wasserträger des Stasi-Regimes, die sie nicht gewesen waren.« Hier wird ein Ost-West-Gegensatz konstruiert, der bei näherem Hinsehen so gar nicht bestand. Niemand hat Stefan Heym Stasi-Verwicklungen oder Servilität gegenüber der SED vorgeworfen. Christa Wolf war selbst erschrocken, als sie sich damit konfrontiert sah, in jungen Jahren als überzeugte Genossin kurzzeitig mit der Stasi kooperiert zu haben. Sie hatte das wohl verdrängt. Heiner Müllers Verteidigung seiner Stasi-Kontakte ist ausgerechnet von einer ostdeutschen Autorin, Sarah Kirsch, angegriffen worden: »Niemand musste mit der Stasi reden.« Richtig ist, dass es zumeist westliche Medien waren, die Stasi-Verwicklungen prominenter Ostdeutscher aufgedeckt haben. Westdeutsche Kritiker haben Christa Wolfs literarische Qualitäten in Frage gestellt, aber Westdeutsche haben sie auch verteidigt. Und es war die Volkskammer, die die Öffnung der Stasi-Akten erzwungen hat, auch für Journalisten. Habermas spricht uns Ostdeutschen die Urteilsfähigkeit ab, wenn er unterstellt, einige westdeutsche Schmähartikel hätten für uns genügt, um unsere bisherigen Wortführer fallen zu lassen. In Wahrheit haben sich viele der zuvor SED-kritischen ostdeutschen Intellektuellen dadurch ins Abseits manövriert, dass sie auch nach dem Fall der Mauer dafür geworben haben, die DDR als »eine sozialistische Alternative zur Bundesrepublik zu entwickeln«, so im Aufruf »Für unser Land« (26.11.89), wie es sich damals auch Habermas gewünscht hat. Die überwiegende Mehrheit der DDR-Bevölkerung wollte aber nicht Versuchskaninchen im nächsten Menschheitsexperiment sein, sondern leben wie in der Bundesrepublik. Sie votierten bei den freien Volkskammerwahlen mehrheitlich für die Parteien, die die schnelle deutsche Einheit versprachen. Das waren postrevolutionäre Ost-Ost-Auseinandersetzungen. Aber zunehmend wird es üblich, sie als Ost-West-Auseinandersetzungen umzudeuten und die Ostdeutschen als Opfer des Westens darzustellen.
Nun zu den Ost-Zeitungen. In der DDR waren alle Tageszeitungen Eigentum der Parteien. Die wichtigen politischen Artikel wurden von der Propagandaabteilung im ZK der SED wörtlich vorgegeben. Die Zeitungen von CDU und LDPD unterschieden sich von den SED-Zeitungen nur im Kulturteil. Die größte Verbreitung genossen die SED-Bezirkszeitungen. Sie allein verfügten über ein flächendeckendes Netz von Lokalredaktionen. Das verschaffte ihnen das Monopol für Lokalnachrichten, Klein- und Familienanzeigen. Das machte sie unersetzbar. Für die politische Meinungsbildung spielten sie aber kaum eine Rolle – außer bei den überzeugten Genossen, aber die lasen dann doch lieber gleich das überregionale »Neue Deutschland«, Zentralorgan der SED. Für die Meinungsbildung waren Rundfunk und Fernsehen und vorrangig Westsender am wichtigsten, vor und nach 1989.
Mit dem Ende der ›führenden Rolle‹ der SED (1.12.89) brach die ZK-gesteuerte Medienherrschaft ersatzlos zusammen. Es begann eine Phase echter Pressefreiheit. Aber die Journalisten waren ja alle noch die alten, unter dem SED-Regime im ›Roten Kloster‹ zu Leipzig auf Linie getrimmt. Das wirkte nach. Am schnellsten legten die Tageszeitungen der CDU (»Union«, »Neue Zeit«) und der LDPD (»Der Morgen«) die Scheuklappen ab. Für die Herbstrevolution selbst aber waren Rundfunk und Fernsehen entscheidend, nicht die Printmedien. Besonders keck war der Jugendsender DT64. Die Sitzungen des Runden Tischs wurden vollständig im DDR-Fernsehen übertragen, die Volkskammersitzungen in erheblichem Umfang.
Es gab aber 1989/90 auch sehr viele neu gegründete Printmedien, etwa einhundertzwanzig. Von denen haben aber nur zwei über 1990 hinaus bestanden. Der anfängliche Enthusiasmus der revolutionären Freizeitjournalisten ohne professionelle Infrastruktur ließ sich nicht auf Dauer stellen. Tageszeitungen wurden bald wieder vorrangig des Lokalen wegen gehalten und da konnten die Neugründungen nicht mithalten. Wohl aus denselben Gründen haben auch die von westlichen Verlagen übernommenen beiden überregionalen Ostzeitungen »Neue Zeit« und »Der Morgen« nur einige Jahre durchgehalten. So kam es, dass allein die Nachfolger der ehemaligen SED-Zeitungen bis heute bestehen. Mit dieser ihrer Herkunft verbindet sie aber nur noch ihr jeweiliges Verbreitungsgebiet in den Grenzen der einstigen DDR-Bezirke. Für die Meinungsbildung gewannen die öffentlich-rechtlichen Sender der neuen Bundesländer (MDR, RBB, NDR Ost) an Gewicht.
Habermas behauptet, die von westlichen Verlagen aufgekauften SED-Bezirkszeitungen hätten nun den westlichen ›mainstream‹ im Osten verbreitet. Schließlich seien ja überall westdeutsche Chefredakteure installiert worden. Das stimmt zwar, aber die Journalisten aus SED-Zeiten blieben und ließen oft lange noch ihre bisherige Prägung durchblicken, was anderen Ostdeutschen ein Ärgernis war. Habermas blendet auch diese postrevolutionäre Ost-Ost-Konfrontation aus und ersetzt sie durch einen Ost-West-Gegensatz.
Einen echten Kapitalisten interessieren an einer Zeitung die Auflagenhöhe und die Zahl der Abonnenten, denn daraus ergeben sich die Werbeeinnahmen. Deshalb ist beim Erwerb einer Zeitung das Hauptinteresse: nur die Leser nicht verschnupfen. Am besten, sie merken den Trägerwechsel nicht. Die neuen Eigentümer waren deshalb mit den SED-Journalisten ganz zufrieden – eine merkwürdige Allianz, die Habermas entgangen ist. Den Ostdeutschen, sagt Habermas, habe nach 1989 »ein abgeschirmter Raum für die überfällige Selbstverständigung« gefehlt.
In der DDR waren westdeutsche Zeitungen strikt verboten. Nach der Maueröffnung stürzten sich Ostdeutsche auf westliche Printmedien – und nicht vorrangig auf die anspruchsvollsten. Auch Beate Uhse war Neuland. Wie bitte hätte da ein ›abgeschirmter Raum‹ aussehen sollen? Weiter Importverbot für Westmedien? Das klingt doch nach Reservat, in dem die Eingeborenen vor schädlichen äußeren Einflüssen geschützt werden sollen, bis sie die notwendige Reife erworben haben, den westlichen Versuchungen zu widerstehen – Edel-Kolonialismus sozusagen.
In diesem abgeschirmten Raum hätte nach Habermas den Ostdeutschen auch Gelegenheit gegeben werden sollen, dass »sie eigene Fehler hätten machen können«. Aus Fehlern lernen lässt man Kinder und Lehrlinge, allerdings nur in beschnittenen Handlungsräumen, auf der Spielwiese. Busfahrer, Chirurgen, Brückenbauer dürfen dagegen im Ernstfall keine Fehler machen, auch nicht, um aus ihnen zu lernen. Das unterscheidet Erwachsene von Kindern.
Es gibt Fürsprecher der Ostdeutschen, die diskriminieren versehentlich nicht weniger als unsere Verächter. ›Lieber Gott, schütze mich vor meinen Freunden. Vor meinen Feinden will ich mich schon selber schützen.‹
Die Räume, in denen Ostdeutsche sich untereinander verständigten – und zerstritten! – gab es doch vom Herbst 89 an so reichlich wie nie zuvor: in den neuen Bürgerbewegungen und Parteien, aber auch in den Blockparteien, SED inbegriffen, an Runden Tischen landauf landab, dann in der freien Volkskammer, den neuen Kommunal- und Landesparlamenten, in den Betrieben und Lehrerkollegien – aber leider weniger als erhofft an den Universitäten. Es ging dabei allerdings nicht zuerst um die von Habermas erhoffte ›überfällige Selbstverständigung‹ über die NS-Diktatur, sondern vorrangig um die SED-Diktatur. Erst vom Herbst 89 an wurde bekannt, dass der sowjetische Geheimdienst einige KZs weitergeführt hat. Einige Sozialdemokraten waren vor und nach 1945 im KZ. Workuta war bis dahin ein unbekanntes Wort. Die genaueren Umstände des 17. Juni 1953, politische Prozesse gegen prominente SED-Mitglieder wie Walter Janka und vieles mehr wurde jetzt erst bekannt. SED-Funktionäre wurden von der SED-Justiz unter dem Vorwurf des Amtsmissbrauchs und der Korruption inhaftiert, Politbüromitglieder aus der SED ausgeschlossen. Dazu kamen die Enthüllungen über inoffizielle Mitarbeiter der Stasi auch unter den Exponenten der Opposition, wie Wolfgang Schnur und Manfred alias Ibrahim Böhme. Das alles führte zu regen, aufgeregten und hart kontroversen Diskussionen unter Ostdeutschen.
Neben diesen postrevolutionären Auseinandersetzungen gab es vom Herbst 89 an auch innerostdeutsche Identitätsdebatten. Der Ruf nach der deutschen Einheit kam zuerst aus dem Osten, und zwar als Zitat aus dem unter Honecker verbotenen Text der Nationalhymne der DDR: ›Deutschland einig Vaterland‹. Der Gedanke an die deutsche Einheit galt im Westen vielen als reaktionär. Die SED dagegen bekämpfte ihn seit Honeckers Machtantritt. Deshalb war er in der DDR gefährlich, aufsässig oder gar subversiv.
Das andere Feld ostdeutscher Identitätsdiskurse betraf die Wiedereinrichtung der Länder. Die SED hatte sie abgeschafft und durch die Bezirke ersetzt, auch um den Bruch mit der bisherigen Geschichte zu vollziehen und den landsmannschaftlichen Zusammenhalt zu zerstören. Heimatmuseen traktierten bis zum Überdruss die ›Geschichte der Arbeiterbewegung‹. Nach 1989 wurde die Lokalgeschichte neu entdeckt. Bis in die Dörfer hinein erschienen Publikationen und kleine Periodika zur Lokalgeschichte. Dabei wurden auch ältere Heimatkalender ausgeschlachtet. Die Museen wurden nach 1989 durchweg neu konzipiert. Ab 1989 begann landesweit die Rettung der verfallenden historischen Bausubstanz. Ja, auch die verfallenen Gefallenendenkmäler des Ersten Weltkriegs wurden restauriert. Das alles mögen viele Westdeutsche als spießig oder hinterwäldlerisch belächeln oder gar verurteilen. Das beweist aber lediglich ein schwaches Einfühlungsvermögen. Die allermeisten Ostdeutschen hatten die Nase voll vom abstrakten ›sozialistischen Internationalismus‹, der wegen der innersozialistischen Reisebeschränkungen eine einzige Heuchelei war. Es war die Liebe zur Heimat oder Patriotismus, die sich in dieser Hinwendung zur Lokalgeschichte meldeten.
Habermas hat seinerzeit erklärt: »Der einzige Patriotismus, der uns dem Westen nicht entfremdet, ist der Verfassungspatriotismus.« Franzosen oder Polen lassen sich aber ihre Vaterlandsliebe nicht auf die Liebe zur Verfassung zurückstutzen. Dolf Sternberger, der den Ausdruck geprägt hat, hatte seinerzeit gemeint: Patriotismus ist uns derzeit verwehrt, weil die Nation geteilt ist. Aber unsere Verfassung ist ungeteilt. Habermas hat aus der Not eine Tugend gemacht. Aber Verfassungspatriotismus exklusiv wäre doch schon wieder ein deutscher Sonderweg! Auch Karl Dietrich Brachers Formulierung von 1976, die Bundesrepublik sei eine »postnationale Demokratie unter Nationalstaaten«, war unter der Bedingung der deutschen Teilung gesagt. Nach der deutschen Vereinigung auf diesem ›Postnationalismus‹ zu beharren würde die Deutschen nicht nur dem Westen, sondern stärker noch dem Osten Europas entfremden und uns verdächtig machen.
Über das Verhältnis von Patriotismus und Nationalismus sollten wir noch einmal gründlich nachdenken. Patriotismus meint hier die Liebe zum eigenen Vaterland wie andere das ihre lieben. Unter Nationalismus sei die Überhöhung der eigenen Nation verstanden, verbunden mit der Abwertung anderer.
Nicht wenige im Westen nehmen diese Unterscheidung nicht ernst, weil sie bereits Patriotismus als Nationalismus ablehnen. »Patriotismus, Vaterlandsliebe also, fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland nichts anzufangen und weiß es bis heute nicht.« (Robert Habeck 2010). Es wird schwer sein, eine vergleichbar dezidierte Absage von einem bekannten Ostdeutschen zu finden. ›Ich fühle mich nicht als Deutscher, ich bin Europäer‹, auch das kann Flucht aus der deutschen Identität und ihrer Last sein, ähnlich dem ›Antifaschismus‹ der SED – und bei anderen europäischen Nationen als neue deutsche Anmaßung übel ankommen: Sollen wir schon wieder am deutschen, nun postnationalen Wesen genesen?