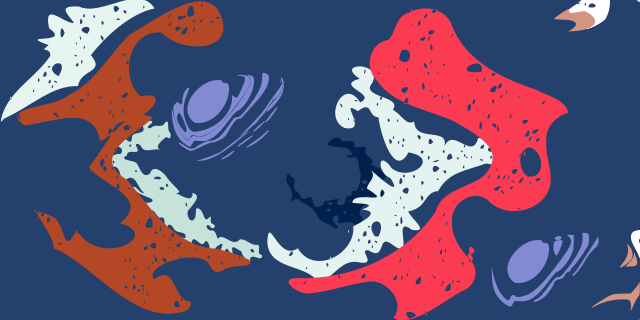von Heinz Theisen
Selbstbehauptung durch Selbstbegrenzung in einer multipolaren Welt
Der Westen hat kein Monopol auf Modernisierung mehr. Je weniger es nur eine Moderne, den Westen gibt und neue Formen der Modernisierung entstehen, desto mehr werden auch Indien und China politisch ihre eigenen Wege gehen.
Mit der moralischen, den Westen in seiner Hegemoniebestrebungen legitimierenden Unterscheidung von Demokratie und Diktatur werden wir der Multipolarität der Welt nicht gerecht, zumal die meisten Mächte jeweils oligarchische Züge ausprägen. Es ist weniger eine moralische Forderung als ein Appell an das aufgeklärte Eigeninteresse, sein Heil nicht mehr in seiner Ausdehnung, sondern in der eigenen Selbstbehauptung durch Selbstbegrenzung zu suchen.
In einer multikulturellen Welt braucht der Westen eine neue geopolitische Strategie, die bereit ist, den anderen Kulturen als Werteordnungen und konkurrierenden Mächten ihre Eigeninteressen bis hin zu eigenen Einflusssphären zuzugestehen. Statt der Universalität westlicher Werte und einer Hegemonie des Westens gilt es die Gegenseitigkeit der Kulturen und Mächte in den Mittelpunkt zu stellen.
Die USA nehmen bereits von ihrer Hegemoniepolitik Abstand. Selbst befreundete Staaten wie Brasilien und Indien verweigern dem Westen hinsichtlich der Russland-Sanktionen die Solidarität und orientieren sich an einem neuen Staatenbündnis der BRICS-plus, in dem die ideologische Ausrichtung der politischen Systeme keine Rolle spielt. Sie entziehen sich damit der Zweiteilung nach westlichen Demokratien und Autokratien im Rest der Welt.
Vielfalt nach innen, Einheit nach außen. Eine Europäische Union à la carte
Die Frage lautet nicht, »Europa: Ja oder Nein?«, sondern »Welches Europa?« Wollen wir ein dezentraleres Europa der Nationen und der Vielfalt nach innen und der Gemeinsamkeit und Stärke nach außen? Was mit freiem Handel und innerer Friedenspolitik begann, hat zu einer zentralisierten Machtstruktur geführt, die auf Kosten der nationalen Souveränität geht. Nötig ist hingegen eine Rekonstruktion der Grundwerte Europas wie Demokratie, Souveränität und Gleichgewicht.
Der erste Schritt eines »Zurück zu den Wurzeln« wäre das Modell einer Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, wie sie 1957 begründet wurde. Dieses Szenario würde eine Dezentralisierung mit sich führen. Die Souveränität der Mitgliedsstaaten sollte wiederhergestellt werden – im ausdrücklichen Gegensatz auch zu Emmanuel Macrons Forderung nach einer »europäischen Souveränität«. Die nationalen Regierungen sollten wieder die Verantwortung für Schlüsselbereiche der Politik innehaben. Daraus würde die freiwillige Zusammenarbeit in spezifischen Projekten möglich. Die EU wäre keine politische Union, sondern eine »Gemeinschaft der Nationen«. Die Europäische Union braucht sich selbst behauptende Nationalstaaten, die in der Lage sind, eine sich nach außen selbstbehauptende Europäische Union zu stützen. Die meist zu kleinen europäischen Staaten sind weder dem globalen Wettbewerb noch Konflikten mit den drei Weltmächten gewachsen. Der isolierte Nationalstaat wäre auch dem Kampf mit der islamischen Welt nicht gewachsen. Gefordert ist hingegen ein À-la-carte-Modell der Integration. Die Staaten wählen selbst, wo sie sich an einem engeren Verbund beteiligen wollen und wo nicht (Opt-in und Opt-out). In jedem Fall sollte EU-Recht keinen Vorrang mehr vor nationalem Recht haben.
Es wäre möglich, Europas Grenzen zu sichern, wie Australien, Kanada oder auch Ungarn beweisen. Die Europäische Union muss daher ein positives Verhältnis zu imperialer Stärke in defensiver Absicht finden. Eine Europäische Verteidigungsgemeinschaft liegt in weiter Ferne. Die EU-Staaten sind derzeit nicht einmal in der Lage, ihre Waffenbestände zu erheben und zu koordinieren.
Eine Nato, die sich differenziert und begrenzt
Im Kalten Krieg waren die Grenzen des Westens bis auf den Meter geklärt, was trotz aller ideologischer Feindschaft den Frieden erhalten half. Die militärischen Interventionen des Westens in der islamischen Welt haben sich dagegen von Afghanistan bis Mali als Desaster erwiesen. Sie standen im Einklang mit einer Strategie einer sich global engagierenden NATO.
Nach dem Ende des Kalten Krieges mutierte die NATO zum globalen Akteur, bis hin zu gleichzeitigen Partnerschaften mit Aserbaidschan und Armenien. In der multipolaren Welt wird sie von einem neoimperialen wieder zu einem defensiven Verteidigungsbündnis des längst wieder selbst bedrohten Westens schrumpfen müssen. Im Gegensatz zu dem naiven Glauben der europäischen Eliten geht es in der Welt nicht um eine Moralordnung, schon sondern um eine Machtordnung. Eine herbeifantasierte »regelbasierte Weltordnung« hat es nie gegeben. Das Völkerrecht war für die amerikanische Weltpolitik vom Kosovo bis zum Irak so irrelevant, wie sie es für Moskau im Hinblick auf die Ukraine ist.
Die nach 1991 eingeleitete Globalität und Universalität des Westens sollte mit der Einverleibung der Ukraine und Georgien in die Nato gekrönt werden. Mit der Nato-Politik, die Ukraine und Georgien aus der Machthemisphäre Russlands herauszulocken, ohne ihnen unmittelbaren Beistandsschutz zu gewähren, wurde die Ukraine in eine Falle gelockt. Diese geokulturelle Überdehnung in die russische Machtsphäre hinein erwuchs aus den Annäherungsversuchen vor allem der Nato, aber auch der Europäischen Union an die vorher bewusst neutral gebliebene Ukraine. Sie wurde unter Missachtung aller geopolitischen Gesichtspunkte nach Westen gezogen und im Ergebnis zerrissen.
Damit wurde das Gleichgewicht der Macht, jenes Minimum einer machtpolitischer Friedensordnung, in Europa massiv in Frage gestellt. Die Gegenreaktion Russlands, der Angriff auf die Ukraine, resultiert aus dem Bestreben, eine Großmacht bleiben zu wollen. Nach dem Krieg wird es um eine Wiederherstellung des verlorenen Gleichgewichts zunächst in Europa gehen müssen. Dafür wird sich die Nato an ihre Grenzen halten und der russischen Einflusssphäre ihren Tribut zollen müssen.
Die neue amerikanische Regierung will im Rahmen einer multipolaren Weltordnung ihr weltpolitisches Disengagement auch in Europa zum Ausdruck bringen. Es gehört aber nicht zu den amerikanischen Interessen, ganz auf Einflussnahme in Europa und damit auch in Nahost und Afrika zu verzichten. Die USA verlangen von der EU mehr Eigenleistungen. Dies kommt wiederum dem Interesse der Europäer nach mehr Wahrung ihrer eigenen Interessen entgegen. Sie werden eine Europäische Verteidigungsgemeinschaft innerhalb der Nato aufbauen müssen.
Ein Verzicht auf eine Nato-Mitgliedschaft würde sie auf unabsehbare Zeit wehrlos, d.h. nicht abschreckungsfähig machen. Dies wäre schon im Hinblick auf islamistische Tendenzen in der Türkei gefährlich. Stattdessen sollten die EU-Europäer dazu beitragen, dass die Nato wieder als Defensivbündnis wie im Kalten Krieg rekonstruiert wird. (Zu den vom Westen zu verantwortenden Ursachen des Krieges gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Büchern, vgl. etwa Thomas Röper, Die Ukraine-Krise, Günter Verheugen, Petra Erler, Der lange Weg zum Krieg. Russland, die Ukraine und der Westen.)
Die Nato muss sich daher im Rahmen einer Strategie von einem die USA und die EU-Staaten umfassenden Bündnis zu einem Grenzsicherungsbündnis entwickeln. Eine Grenzsicherung im Süden Europas wäre wesentlich wichtiger als 22 globale Partnerschaften, über die die Nato jetzt verfügt. Nach erfolgreicher Abgrenzung von anderen Kulturen und Eindämmung seiner Feinde kann der Westen von seiner angemaßten Universalität zu einer Koexistenz der Kulturen und Mächte übergehen. Die Koexistenz von Kultur und Politik könnte dann zur Konnektivität von Wissenschaft, Technik und Wirtschaft überleiten.
Grenzen der Kulturen in einer multipolaren Weltordnung
Ein defensiver Imperialismus der Selbstbehauptung des Eigenen würde den Übergang von einer unipolaren zu einer multipolaren Weltordnung einleiten. Der Ukraine-Krieg resultiert aus geokultureller Perspektive auch aus der mangelnden Einsicht in die Grenzen zwischen dem westlichen und dem russisch dominierten Teil Osteuropas. Der kulturelle Unterschied zwischen West- und Osteuropa ergibt sich aus der 1000-jährigen Trennung des orthodoxen Christentums vom säkularen West-Christentum. Die theologischen Unterschiede sind kaum mehr bekannt, aber die Prägungen, vor allem im Verhältnis zu Staat und Kirche, sind weiterhin relevant.
In der Ukraine treffen beide Kulturen aufeinander und deshalb wäre ihre Neutralität als einer Art Schweiz zwischen West und Ost geboten gewesen. Jetzt bleibt nur noch ihre Teilung. »Gerechter Friede« durch westliche Werte, dieser Anspruch lag dem Moralismus und Globalismus der westlichen Außenpolitik in den letzten drei Jahrzehnten zugrunde. Präsident Selenskyj bemüht das Narrativ vom »Gerechten Frieden«, um damit einen Waffenstillstand und die damit verbundene Teilung der Ukraine auszuschlagen. Dabei hat eine solche Teilung wie im Fall Koreas, Zyperns und nicht zuletzt Deutschlands über vierzig Jahre hinweg den Frieden zu bewahren geholfen und die Möglichkeiten späterer Veränderungen gleichwohl offen gehalten. Nord- und Südkorea haben seit 1954 nie einen Friedensvertrag unterzeichnet. Formal gesehen befinden sie sich immer noch im Kriegszustand, aber die koreanische Halbinsel ist seither friedlich. Auch die Türkei und Griechenland haben nie ein Friedensabkommen über Zypern geschlossen.
Die Rekonstruktion Europas würde demnach aus einer geo- und realpolitischen Teilung zwischen Ost- und Westeuropa hervorgehen. Hierbei könnte Europa seine Dekadenz zu Hilfe kommen. Selbst befreundete Staaten wie Brasilien und Indien verweigerten dem Westen hinsichtlich der Russland-Sanktionen die Solidarität und orientieren sich am neuen Staatenbündnis der BRICS-plus.
Die anstehende Teilung zwischen der russischen Ost-Ukraine und einer dann west-europäisch orientierten West-Ukraine könnte in ein neues Gleichgewicht der Mächte in Europa und dann auch der multipolaren Welt übergehen. Emmanuel Todd ist davon überzeugt, dass die Bemühungen der Vereinigten Staaten, Deutschland von Russland zu trennen, letztlich scheitern werden. Ihre gemeinsame Geburtenrate von 1,5 Kindern pro Frau stimme Russen und Deutsche versöhnlich und nähere sie einander an. Sie könnten nicht mehr gegeneinander Krieg führen. Hingegen würden sich ihre wirtschaftlichen Spezialisierungen gegenseitig so gut ergänzen, dass sie den Chancen der Kooperation nicht dauerhaft entgegenstehen werden.
Eine Rückkehr zu den Grenzen der Kulturen würde den Blickwinkel von Osten nach Süden verlagern, denn die Unterschiede des westlichen Europas zum Islam sind ungleich gravierender als die zu Russland. Nach Corona und Klima hat die politische Linke das autoritär regierte Russland zur größtmöglichen Gefahr erklärt, wohl auch, um über diese Dramatisierung von ihrem Versagen in der Migrationspolitik und der daraus entstandenen sozialen und kulturellen Destabilisierung Europas abzulenken. Aber es sind nicht Putins Agenten, die in unseren Straßen Menschen abstechen und vergewaltigen und auch innerhalb Russlands werden keine fremdreligiösen Gruppen attackiert und ermordet – wie in dem von der Europäischen Union zum neuen Partner ausgerufenen islamistischen Syrien.
Es gehört zu den unverzeihlichen Fehlern eines Staatsmannes, den falschen Feind zu bekämpfen. Anders als die 1,9 Milliarden Muslime sehen sich die Russen, Angehörige des christlichen Kulturkreises, nicht als ideologisch geborene Feinde des Westens. Die falsche Feindbestimmung unterlässt die gebotene Unterscheidung von Autoritarismus und Totalitarismus. Während autoritäre Regime primär an ihrer Herrschaftssicherung und Stabilität interessiert sind, richten totalitäre Ideologien und ihre Regime, seien sie kommunistisch oder islamistisch, wesensgemäß ihre Herrschaft auf Ausdehnung aus. Anderenfalls würden sie ihren totalen Wahrheitsanspruch auch nach innen verlieren.
Die Vertauschung des kleineren Übels »Autoritarismus« mit dem größeren Übel des islamistischen Totalitarismus zeigte sich etwa in der Feindschaft gegenüber dem säkularen Assad-Regime in Syrien. Demgegenüber steht die EU dem neuen islamistischen Regime in Syrien mit Milliarden-Hilfen bei. Für die seltsame weltanschauliche Sympathie zwischen Linken und Islamisten gibt es nur eine Erklärung: der ihnen gemeinsame, von der »postkolonialen Ideologie« untermauerte Hass auf den einst christlich und liberal-bürgerlich orientierten Westen.
Im Rahmen der Unterscheidung zwischen Autoritarismus und Totalitarismus sollte auch an der Unterscheidung von Islam und Islamismus festgehalten werden. Sie ermöglicht eine Politik des »Teile und Herrsche« bzw. »Teile und Verteidige« durch Koexistenz gegenüber gemäßigten islamischen Staaten und – dann auch mit ihrer Hilfe – der Eindämmung totalitärer Akteure und Staaten.
In ihrer Logik läge es sogar, das autoritäre Russland als Sicherheitspartner im Kampf gegen den Islamismus aufzubauen. Der globale Kampf des Islam wird nicht nur gegen das Judentum, sondern gegen das Christentum geführt, welches im Nahen Osten nahezu verschwunden ist. Dementsprechend wird nach Israel Europa das Ziel islamischer Ausdehnung sein. Der totalitäre Islamismus ist weder für demokratische noch für autoritäre Systeme akzeptabel, woraus sich neue Konstellationen einer Zusammenarbeit ergeben.
Literatur
Hauke Ritz, Vom Niedergang des Westens zur Neuerfindung Europas, Frankfurt/M 2023
Thomas Röper, Die Ukraine-Krise. 2024 bis zur Eskalation, Wie der neue Kalten Krieg begann, Gelnhausen, 3. Aufl. 2022
Emmanuel Todd, Der Westen im Niedergang. Ökonomie, Kultur und Religion im freien Fall, Frankfurt/M 2024
Günter Verheugen, Petra Erler, Der lange Weg zum Krieg. Russland, die Ukraine und der Westen: Eskalation statt Entspannung, 6. Aufl. München 2024
Wer rettet den Westen?
Der Westen braucht eine neue Soft Power, die an die besseren Elemente der alten Kultur anknüpft. Der amerikanische Vizepräsident sieht die Redefreiheit als wichtigstes Element der Freiheit und der Demokratie überhaupt. Im Hinblick auf das neue Paradigma der amerikanischen Regierung einer Selbstbehauptung des Eigenen beruft er sich auf den »ordo amoris« der christlichen Soziallehre, welcher aus dem Geist der Subsidiarität die Hilfe zuerst dem naheliegenden Raum zuweist. Darüber wird der zuvor universalistische und globalistische Eifer erst wieder in eine tragfähige Reihenfolge gebracht. Diese Dezentralität macht nicht nur demokratische Verfahren allein möglich, sondern ist auch der Problemlösung dienlich.
In der Personalität als einem weiteren Grundprinzip der Soziallehre könnte der Ausgangspunkt für eine Erneuerung des Bürgertums liegen. Personalität bedeutet anders als eine radikalisierte Individualität, dass Bürger sich berufen fühlen, neben den eigenen Interessen auch immer die Gemeinwohlinteressen zu bedenken. In der dem Bürgertum spezifischen Gegenseitigkeit von Rechten und Pflichten, von Arbeit und Freizeit, von Individualität und Gemeinschaft müsste der Bürger wieder zu einer Restrukturierung seines Ethos finden.
Orbán, Trump und die Gegenseitigkeiten der multipolaren Welt
Als Fellow am Mathias Corvinus Collegium in Budapest konnte ich einige Monate aus nächster Nähe erleben, wie die Regierung Orbán an einer immer neuen Ausgestaltung der Synthese von Liberalismus und Kommunitarismus und zugleich am Aufbau eines weltweites konservatives Netzwerkes baute.
Der Hass der Globalisten auf Orbán und Trump resultierte aus deren Weigerung, sich als Liberale zu bekennen. In seinen Reden bekennt sich Orbán zu einer »christlichen Demokratie«, die die Werte des Christentums, von Freiheit und Menschenrechten vertritt. An der leitkulturellen Rolle des Christentums lässt er keinen Zweifel. Christen glaubten an den freien Willen des Menschen, sie hätten einen moralischen Kompass und wären immun gegen dekonstruktivistische und neomarxistische Ideologien. Ein großer Vorteil christlich fundierter Politik sei die Selbstprüfung vor Gott. Europas Erfolge entstammten dem Geist der ständigen Selbstreflexion.
Die Christliche Soziallehre schlägt sich auch in der Verbindung von personaler Verantwortung, gegenseitiger Solidarität und Subsidiarität nieder. In der ungarischen Sozialpolitik gilt die Devise: »Sozial ist, was Arbeit schafft.« Sozialhilfe wird in Ungarn – hier schlägt der Calvinismus durch - nur bei Gegenleistungen gewährt und trägt eher zur gesellschaftlichen Integration bei als ein voraussetzungsloses »Bürgergeld«. In der Verfassung Ungarns werden gemeinschaftliche Grundrechte den individuellen Rechten beigeordnet, Rechte und Pflichten miteinander verknüpft.
Der kommunitarischen Sozialpolitik zufolge gelten Individuen als Mitglieder von Gemeinschaften und der konservativen Kulturpolitik gilt die Nation als die größte Identitäts- und Wertegemeinschaft. Der Gemeinwohlbegriff setzt die Existenz einer umgrenzten Gemeinschaft voraus, die in der Regel über lange Zeiträume gewachsen ist und gepflegt werden muss. Ungarns Politik beruht auf einer durchdachten Ordnungskonzeption, die man den zahlreichen Interviews von Viktor Orbán und einschlägigen Schriften seiner Mitarbeiter entnehmen kann. Auch darüber ist Budapest zu einem geistigen Zentrum von Konservativen aus aller Welt geworden. Ihre programmatischen Bemühungen wollen vor allem der Versuchung widerstehen, sich - wie die Britischen Konservativen oder die CDU – von Wahl zu Wahl immer mehr dem Wunschdenken »fortschrittlicher« Parteien anzunähern und von den Notwendigkeiten des Bewahrens abzuwenden.
Orbán kämpft für neue Mehrheiten in den alten Bündnissen. Ein Austritt aus EU oder Euro sei nur für kleine Minderheit noch eine attraktive Option. Auch das amerikanische Bündnis werde nur ein kleiner Teil der Europäer aufgeben wollen, solange das Machtvakuum nicht aus eigenen Kräften gefüllt werden kann.
Orbán, der beinahe täglich Interviews gibt, weiß um die Bedeutung der metapolitischen Ebene, ohne die auf Dauer keine Ordnungsvision durchgesetzt werden kann. Mittelfristig muss vor allem die Brandmauer zwischen bürgerlichen, gemäßigten und radikaleren Kräften fallen, zwischen denjenigen, die an den Symptomen herumwerkeln und denjenigen, die auch die Ursachen der Krisen analysieren und kurieren wollen.
Die Präsidentschaft von Donald Trump bedeutet eine strategische Revolution. Sie geht über von der Überdehnung der eigenen Macht zu deren heilsamen Selbstbegrenzung. Ihr Ziel ist nicht eine fiktive Universalität westlicher Werte, sondern die Konzentration auf eigene Interessen bei Respekt anderer Kulturen und anderer konkurrierender Mächte. Sie bedeutet eine Anerkennung der Verschiedenheit einer multipolaren Welt. Die Gegenrevolution von Donald Trump besteht darin, keine moralischen Ziele, sondern die Interessen des Eigenen zu befürworten. Als Geschäftsmann geht er nicht Kompromisse auf Kosten Dritter, in der Regel des Steuerzahlers, sondern versucht im gegenseitigen Geben und Nehmen realistische Geschäftspolitik zu betreiben.
Bei Trumps »America first« handelt es sich um die Rekonstruktion eines Wirtschaftsnationalismus, der das Gute nicht mehr in alle Welt verteilen möchte, sondern das Gute der Welt zu sich ziehen möchte. Das schließt die Anerkennung der eigenen Grenzen und dies wiederum die Möglichkeit ein, sich mit anderen Mächten auf Abgrenzungen und neutrale Zonen zu einigen. Europa bleibt im Moment demgegenüber nur die Hoffnung, dass aus den USA immer noch Gutes und Schlechtes nach Europa übergeschwappt ist und sich die realitätsentrückten Eliten Europas den neuen strategischen Leitlinien der USA beugen werden.
Trump schließt keine Kompromisse auf Kosten Dritter, in der Regel des Steuerzahlers, sondern fordert Gegenseitigkeit ein. Das Prinzip Gegenseitigkeit ist der Kern seines neuen Realismus. Es bedeutet das Ende von Gemeinschaftsträumereien. Der Anspruch auf Realpolitik unterstellt dem Gegner keinen Wahnsinn, sondern versucht, sich in dessen Ziele und Strategien hineinzudenken. Sie respektiert die Geopolitik, in der die Geographie kaum änderbare Realitäten definiert, woraus Einsichten in Einflusssphären und damit auch für notwendige Grenzziehungen erwachsen. Oft ist ein Blick auf die Landkarte wichtiger als ins Völkerrecht. Die Einflusssphären der anderen Großmächte Russland und China müssten eine ähnliche Berücksichtigung finden wie sie die USA etwa im mittelamerikanischen Raum und in Westeuropa für sich erwarten.
Religion entscheidet: Israel als Menetekel und Modell für den Westen
Die Zugehörigkeit Israels zum Westen kommt indirekt dadurch zum Ausdruck, dass an es im Westen immerzu höhere moralische Ansprüche gestellt werden als an seine Feinde. Ohne die jüdische Leitkultur wäre die Existenz Israels weder möglich geworden noch ihr Zusammenhalt auch nur eine Woche denkbar gewesen. Israel lehrt uns die Bedeutung von Religion für den Fortbestand einer Kultur.
Im auch in der westlichen Welt allgegenwärtigen Hass auf Israel bündelt sich auch der Hass gegen den erfolgreichen »postkolonialistischen« Westen. Das winzige Israel wird zum Kolonisator und Unterdrücker ernannt. Aus dieser postkolonialistischen Perspektive erwuchsen dann auch die idealistisch-humanitären Ansinnen zur Ausrufung einer für Israel selbstmörderischen Zweistaatenlösung.
Der Westen sollte von der einzigen multireligiösen Demokratie im Nahen Osten lernen, dass er nur durch ein Bekenntnis zu sich selbst seine Verteidigung überhaupt möglich machen wird und nur so im Kampf der Kulturen bestehen kann. Dieses Selbstbewusstsein beginnt im alltäglichen Zusammenleben. Die fast zwei Millionen meist muslimischen Palästinenser Israels sind in Israel nicht integriert, sondern entweder assimiliert oder sie leben getrennt in eigenen Städten. Es wird Religionsfreiheit gewährt, aber die Leitkultur ist das Judentum. Andere Kulturen in Israel partizipieren am Bildungs- und Sozialsystem in dem Maße, wie sie sich selbst in dieses einbringen. Teilnahme und Teilhabe stehen in einem Verhältnis der Gegenseitigkeit.
Im Hinblick auf seine Nachbarschaft betreibt Israel eine »Balance of Power«, welche zwischen kleineren und größeren Übeln, zwischen gemäßigten islamischen Staaten und islamistischen Akteuren unterscheidet. Israels Kampf um seine Existenz verlängert sich durch die offenen Grenzen Europas zum Kampf sowohl um die christliche als auch um die relativistische Kultur Europas.
Im Nahen Osten haben sich Teile der arabischen Welt mit den Israelis und den USA zu einem Entwicklungsfrieden verbündet. Jede Macht im Nahen Osten muss sich entscheiden, ob sie die wirtschaftlich-technische Entwicklung oder die islamistische Vision unterstützen will. Indem sich immer mehr arabische Staaten dem Abraham-Abkommen einer zivilisierten Zusammenarbeit mit Israel annähern, räumen sie der Meerwasserentsalzung, Begrünung von Wüsten, Handel und Tourismus einen höheren Stellenwert als dem Heiligen Krieg ein.
Auch die Palästinenser lassen sich entlang ihrer Teilhabewünsche an den Erfolgen der Zivilisation differenzieren. Das Westjordanland und die dort regierende Fatah sind gespalten nach denjenigen, die mit Israel Geschäfte machen, und denjenigen, die den Endsieg anstreben. Die Palästinenser in Israel sind angesichts der Vorteile des zivilen Lebens in Israel weitgehend loyal. Mit der Wahl der Hamas haben sich viele Palästinenser für den Islamismus und damit für ein Leben im Kampf und in Not entschieden.
Langfristig soll in Gaza ein Terminal für den asiatisch-europäischen Handel errichtet werden, zu dessen Aufbau die Palästinenser des Gaza-Streifens eingebunden werden könnten. Über die Teilnahme am Aufbau erhalten die Palästinenser erneut die Chance, sich vom Kampf der Kulturen abzuwenden und dem Kampf für die Zivilisation zuzuwenden.
Weisheit des Christentums: Subsidiarität und Personalität
Die Demokratie – so David Engels - schuldet ihre Existenz dem Christentum; sie ist an dem Tag entstanden, als der Mensch begonnen hat, in der Zeitlichkeit des Diesseits die Würde des Menschen zu verwirklichen.
Man muss nicht einmal gläubig sein, um im Christentum die geistige Grundlage des Abendlandes zu erkennen. »Abendländer« sehen Europa daher nicht als »Projekt«, sondern als geschichtlich gewachsenen Kulturraum, der, wie jeder Raum, der sich erhalten will, weder nach innen unbegrenzt offen noch nach außen unbegrenzt ausdehnbar sein darf. Dafür bedarf es zunächst eines Sturzes der falschen Götter, den wir im Paradigmenwandel dieser Zeit in manchen Ländern erleben. Am Beispiel zweier Grundprinzipien der christlichen Soziallehre, von Personalität und Subsidiarität soll gezeigt werden, was dieser Wandel für ein neues bürgerliches Ethos bedeuten würde.
Einer Generation ohne nennenswerte religiöse Rückbindung diente die globalistische Ethik der Regenbogen-Kultur als Religionsersatz. Die Fernstenliebe entlastet sie zugleich vor einem konkreten Engagement gegenüber dem Nächsten, deren Probleme den kosmopolitischen Eiferern ziemlich egal zu sein scheinen. Die eigene Wohlfühlgesinnung erhebt einen moralisch soweit über andere hinaus, dass man sich nicht einmal zum Gespräch mit ihnen herabbeugen muss. Ohne Hierarchie des Guten, wie sie das Subsidiaritätsprinzip der Christlichen Soziallehre postuliert, endet grenzenloser Idealismus in Naivität gegenüber dem Fernen und in Verachtung des Nächsten.
Der Fortschrittsbegriff ist im Wanken und das Bewusstsein von den Verlusten der Modernisierungsprozesse prägt heute das Denken und Empfinden. Noch begnügt man sich mit der Förderung kläglicher sexueller Identitäten, aber dies könnte der Vorlauf zu größeren identitären Wahrnehmungen sein. Ohne eigene Identität gibt es keinen Grund, das Eigene über vordergründige und oft widerstreitende Interessen zu behaupten. Wir müssen daher unbedingt darüber streiten, was unsere kollektiven Identitäten ausmacht.
Der Verzicht auf die kulturprägende Rolle einer Religion erzeugt ein geistiges Vakuum, welches dann etwa eine falsche Toleranz gegenüber dem religiös von seiner Wurzel her uns feindseligen Islam, aber auch Fehleinschätzungen im Verhältnis zu Russland und weiterhin ersatzreligiöse Regenbogenvisionen vordringen lässt. Die Migrations- und Klimapolitik lässt sich als Perversion der christlichen Lehre verstehen. Die bedeutungsvolle Rolle diverser Geschlechter und die Fernstenliebe zu weit entlegenen Weltregionen beanspruchen in beiden Fällen ein Selbstschöpfertum des Individuums und die göttergleiche Herrschaft über das Schicksal der Erde.
Der Rückzug des Westens auf seinen westchristlichen Kulturraum wäre ein Beitrag zu einer friedlichen multipolaren Weltordnung. Diese Begrenzung und Besinnung würde den Westen zugleich auch über die Grenzen des Christentums aufklären und daher eine wesentlich defensivere Außenpolitik begründen helfen.
Eine Restrukturierung auf den spezifisch westlichen Ausgleich vor allem zwischen Kultur, Gesellschaft, Staat und Markt muss nicht neu gedacht werden. Sie ist unter anderem in der Österreichischen Schule der Nationalökonomie überzeugend dargelegt worden. Im Hinblick auf den Konflikt zwischen Globalisten und Protektionisten würde allein der Rekurs auf eines der drei Hauptprinzipien der christlichen Soziallehre – die Subsidiarität – genügen, um einen neuen Mittelweg zu finden, der die Fernstenliebe nicht ausschließt, sie aber in eine tragfähige Reihenfolge mit der vorrangigen Aufgaben bringt.
Der zum Katholizismus konvertierte US-Vizepräsidenten J. D. Vance besteht auf Meinungsfreiheit und daher auf dem Einriss der Brandmauern zwischen links und rechts. Schon als Senator hatte er durch seinen Einsatz für verfolgte Christen – nicht zuletzt in der Ukraine – von sich reden gemacht.
Indem er die christliche Ordnung der Nächstenliebe (ordo amoris) wieder zum Leitbild der Politik erklärte, brachte er die neue Politik der Selbstbehauptung in einer globalisierten Welt auf den Punkt. Es gelte, zuerst die Aufmerksamkeit auf das Gedeihen der kleineren Einheiten - von der Familie bis zum eigenen Staat – zu richten und erst danach den Blick auf die ganze Welt zu werfen.
Subsidiarität: Einhegung der Globalisierung in dezentrale Strukturen
Bei den so genannten »Rechten« handelt es sich um heterogene Bewegungen, vereint nur im Bestreben, der Selbstauflösung des Eigenen die Selbstbehauptung des Eigenen entgegenzusetzen. Es wäre ein Fehler, das Eigene auf die nationale Dimension zu reduzieren, zur Dezentralität gehören Familie, Region, vor allem aber auch die eigene Kultur. Der Nationalstaat bildet konkurrenzlos die effektivste Form der Selbstbehauptung, die sich in der abendländischen Geschichte der Neuzeit aber allzu oft durch Selbstübersteigerung diskreditiert hat.
Die politische Rechte in der westlichen Welt besteht nicht nur aus einem Mainstream. Sie ist geeint darin, die selbstauflösende Politik der global denkenden Eliten zu stoppen und diese in eine Politik der Selbstbehauptung umzuwandeln. Ungarn ist die Behauptung seiner nationalstaatlichen Souveränität gelungen, schon indem es sich allen Trends der Weltoffenheit widersetzte und seine Grenzen vor der muslimischen Invasion zu bewahren verstand. Zugleich pflegt das Land seine Mitgliedschaft in inter- und übernationalen Systemen. Orbán besteht aber darauf, dass EU und Nato ihre Grenzen nach außen nicht nur sichern, sondern auch einhalten und sich aus den Händeln fremder Völker heraushalten – eine zugleich politisch schützende und wirtschaftlich offene Politik.
Sozialdemokraten in Dänemark haben sich schon vor Jahren entschlossen, ihren Sozialstaat durch Schutz vor einer zügellosen Migration zu retten. In Italien sitzen angebliche »Postfaschisten« in der Regierung, in den Niederlanden bestimmt der »islamophobe« Geert Wilders die Richtlinien der neuen Regierung.
Im Hinblick auf die Europäische Union verbindet sie die Option für eine dezentralere Politik, die den globalen Entgrenzungen entgegengehalten werden müsse. Die globalen Prozesse in Wissenschaft, Technik und Ökonomie bedürfen schon deshalb im Umkehrschluss dezentraler politischer Prozesse, weil diese allein mit demokratischem Verfahren, mit Souveränität der Staaten und mit der Selbstbestimmung des Menschen kompatibel sind.
Der Ausgleich von Konnektivität und Selbstbehauptung des Eigenen wäre der Weg einer neuen liberalen Mitte. Auf diese Weise könnten die Gesinnungskriege zwischen utopischen Globalisten und den zumeist nationalen Protektionisten in Dritte Wege überführt werden. Statt einem absurden Pro oder Contra zur Globalisierung das Wort zu reden, ginge es darum, die besseren Globalisierungsprojekte zu fördern und die schlechteren zu unterbinden. Natürlich brauchen wir auch weiterhin weltweite Netzwerke, aber deren Knoten – zumeist die Nationalstaaten – müssten auch im Sinne der Netzwerke gestärkt und gefestigt sein.
Personalität: Bürgerliches Ethos der Gegenseitigkeit
Der »Weltbürger« ist ein Widerspruch in sich selbst. Bürger kommt von Burg. Bürgerrechte sind auf einen umgrenzten und zugleich geschützten Raum angewiesen. Der gesunde Menschenverstand resultiert aus der Alltagsbewältigung. Sein Realismus ist weitaus ausgeprägter als die Phantastereien halbgebildeter Akademiker, die, längst an Zahl und Qualität inflationiert, oft nur zum Lernen, aber nicht mehr zum eigenständigen Denken ausgebildet werden. Ihr Mangel an Urteilskraft ist allzu oft bestürzend. Während jeder Handwerker über grüne Phantastereien pleitegehen würde, sichern sich die Projektarbeiter der sich immer weiter ausdehnenden öffentlichen Dienste auch in den so genannten NGO’s untereinander in einer Weise ab, die an eine neue Form der Ausbeutung erinnert.
Je mehr sich der Westen aus den ihm kulturell fremden Weltregionen heraus hält, desto mehr Mittel stehen ihm für die Sicherheit daheim bereit. Freilich können sich die Bewahrer des Eigenen in Extremen wie Isolationismus und übersteigerten Nationalismus verrennen. Es braucht daher Dritte Wege jenseits von oder zwischen Fern- und Nah-Interessen und letztlich einen Ausgleich zwischen Offenheit und Eigensinn. Die Dialektik der Weltoffenheit erfordert Gegenseitigkeit und Gleichgewicht, Klugheit und Tapferkeit, Maß und Mitte, lauter Kardinaltugenden von zeitloser Gültigkeit.
Am Wiederaufbau solcher bürgerlichen Tugenden müssten sich große Teile des Bürgertums beteiligen. Ohne den Zwang der Not ist dies jedoch nicht realistisch zu erwarten. Bisher haben sie sich an dem Niedergang ihrer einstigen Rechte- und Pflichtenethik eher beteiligt als dass sie sich ihm entgegengestemmt hätten. »Links zu sein, bedarf es wenig«. (Johannes Groß) Wenn aber an immer mehr Stellen Knappheit ausgebrochen sein wird, werden diejenigen, für die reale Arbeit kein Problem ist, eher Wege zu ihrem Auskommen finden als die Utopisten des Regenbogens, die meist außer verwegenen Träumen und Forderungen an andere wenig zu ihrer und unserer Existenzsicherung zu bieten haben. Wenn es denn bald eng wird, werden diejenigen, die reale Kompetenzen erlernt haben, wesentlich besser dastehen und auch wieder den Ton angeben (Held, VW – die Rekonstruktionsaufgabe).
Fazit: Noch ist der Westen nicht verloren
Aus den deutlicher erkennbar gewordenen Bedrohungen des Eigenen ergibt sich auch die deutlichere Notwendigkeit von dessen Selbstbehauptung. Dies erleichtert den Konsens für die einigende Aufgabe. Darüber würden sich falsche Gegensätze aufheben. Die im rechten Lager notorischen Konflikte zwischen Patrioten und Europäern machen längst Vorstellungen von einer Europäischen Union der »Vielfalt nach innen und Einheit nach außen« Platz, in denen sich Nationalstaat und Union ergänzen. Zwischen Weltoffenheit und Schutz liegen auch Dritte Wege zwischen Links und Rechts auf der Hand. So ist eine leichtere Einbürgerung von Arbeitskräften genauso notwendig wie die Abwehr illegaler Zuwanderer. Am Ende des Regenbogens angelangt, müssen wir uns dem unbedingten Muss der bloßen Selbsterhaltung beugen.
Kurzfristig bräuchten wir die Rekonstruktion unserer Strukturen, mittelfristig die Rekonstruktion unserer Kultur und jederzeit die Rekonstruktion von Nüchternheit und Realismus. Uns wird nicht weniger als die Besinnung auf Voraussetzungen und Strukturen unserer Kultur, der sich daraus ergebenden Grenzen, der eigenen Interessen abverlangt. Die spezifisch bürgerliche Gegenseitigkeit von Rechten und Pflichten müssen wir kommenden Generationen sogar vorleben.
Angesichts der Größe dieser Aufgabe könnte man von einer umgekehrten Utopie sprechen. Die aufgeführten Aufgaben und Beispiele zeigen aber, dass es Gegenmodelle und hier auch hoffnungsvolle Ansätze gibt. Europa hat den Dreißigjährigen Krieg und zwei Weltkriege überstanden. Spanien war 781 Jahre von Muslimen besetzt und wurde doch wieder eine christliche und später eine demokratische Nation. Unmittelbar nach der Vertreibung der Sarazenen 1492 kapitulierte Granada, im selben Jahr entdeckte Kolumbus Amerika und die Blüte des spanischen Weltreiches nahm ihren Anfang.
Eine neue Blüte des Westens wird aber nicht mehr in fernen Erdteilen, sondern eben umgekehrt in der Rückkehr zu seinen eigenen Aufgaben, seinen eigenen Grenzen und Räumen zu suchen sein. Im anstehenden Paradigmenwandel zu einer Selbstbehauptung durch Selbstbegrenzung braucht der Westen keine Transformation zu ganz neuen Ideen und Ufern. Es kann auf den ungeheuren Schatz seiner Vergangenheit und Möglichkeiten zurückgreifen.
Literatur
David Engels, Défendre l'Europe civilisationnelle : petit traité d'hespérialisme, Paris 2024
Gerd Habermann, Freiheit in Deutschland. Geschichte und Gegenwart, Reinbek, 2. Aufl. 2022
Andreas Reckwitz. Verlust. Ein Grundproblem der Moderne, Berlin 2024
Heinz Theisen, Die Normalität der Selbstbehauptung. Löst Ungarn Europas gordischen Knoten, in: Cato. Magazin für neue Sachlichkeit, Nr.5, 2024