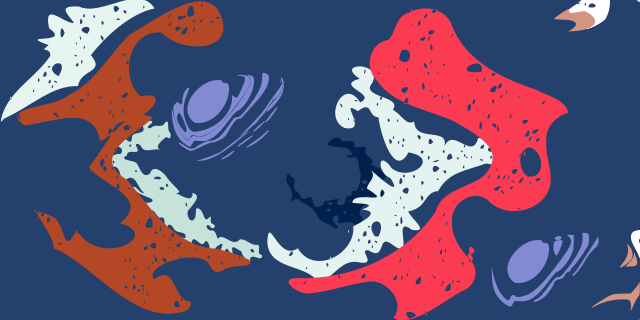von Herbert Ammon
I.
Putins Krieg in der Ukraine, der die Deutschen aus ihrer jahrzehntelangen Friedensgewöhnung aufgeschreckt hat, ist das beherrschende Thema in Politik und Medien. Alle sind sich einig in der Empörung über den Aggressor Putin und im Entsetzen über die Schrecken des Krieges. Dissens, der sich weniger zwischen Regierung und Opposition als innerhalb der Ampel-Regierung – zwischen Kanzler Scholz und Außenministerin Baerbock, zwischen SPD-Fraktionschef Mützenich und FDP-Wehrexpertin Strack-Zimmermann – und über die Parteilinien hinweg abzeichnet, besteht allein hinsichtlich der Frage, wie dem Aggressor entgegenzutreten, d.h. wie die angegriffene Ukraine zu unterstützen sei und welches der richtige Weg zur Beendigung des Krieges sein könne.
Sollen wir der Ukraine mit schweren Waffen aus deutscher Produktion – und mit traditonsreichen Serienbezeichnungen – beistehen? Laut Umfragen sind die Deutschen – der ukrainische Präsident Selenskyj sprach bei einem seiner kämpferischen und fordernden Appelle einmal gar vom ›Brudervolk‹ – in dieser Frage gespalten: eine knappe Mehrheit dafür, eine knappe Minderheit dagegen. Erst recht gilt dies für die wie stets mit moralischem Führungsanspruch hervortretende Intelligentsija: Die einen rufen zu umfassender Unterstützung der überfallenen Ukraine auf, die anderen warnen vor möglicher Eskalation durch Lieferung ebensolcher Waffen. Dies und dazu ihr – in der politischen Realität wirkungsloser Appell zu einem Waffenstillstand – trägt den Zögerlichen den Vorwurf eines eigennützigen und – unter Verweis auf den alliierten Sieg über Hitler-Deutschland – überdies stets fragwürdigen Pazifismus ein. Wie auch immer: Die einst massenwirksame protestantische Kirchentagsparole ›Frieden schaffen ohne Waffen‹ ist derzeit außer Kurs gesetzt. Stattdessen ertönte zuletzt in Stuttgart auf dem Kirchentag des progressiven Laienkatholizismus aus dem Munde der ukrainischen – mutmaßlich überwiegend katholisch-unierten – Gäste unwidersprochen der Gebetsruf nach ›Waffen, Waffen, Waffen‹.
II.
Die letztlich entscheidenden Fragen werden in der laufenden Debatte umfassend vermieden. Dabei ginge es zum einen darum, ob und wie von außen – sprich: im Kontext von Nato und EU, im vielfältigen Interessengeflecht atlantisch-europäischer Akteure – von deutscher Seite überhaupt Einfluss auf den Fortgang des Krieges, mit dem Ziel möglichst baldiger Beendigung, zu nehmen sei. Ein einseitiger Vorstoß aus Berlin triebe die Deutschen unverzüglich in die politische Isolation. Zum anderen ginge es darum zu fragen, ob und wie die beiden Kriegsparteien, die je nach Stand der Dinge ihre eigenen militärisch-strategischen und politischen Chancen kalkulieren, zu einem Waffenstillstand und am Ende gar zu einem erträglichen Frieden zu bewegen seien.
Es handelt sich um Fragen, die in den Raum der Realpolitik verweisen. Der Anstoß zu ernsthaften Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien müsste aus Washington kommen. Dafür gibt es derzeit weder bei dem demokratischen Präsidenten Biden noch bei den oppositionellen Republikanern irgendwelche Anzeichen, was die veröffentlichte Meinung hierzulande mit Genugtuung erfüllt. Vehemente Kritik schlägt stattdessen dem Politkwissenschaftler John Mearsheimer entgegen, der als ›Realist‹ und Theoretiker ›amoralischer‹ Machtverhältnisse den Westen als Mitverursacher von Putins Krieg betrachtet. Mearsheimer kann sich auf George F. Kennan berufen, der anno 1997 vor der NATO-Osterweiterung warnte oder auf Zbigniew Brzezinski, der im gleichen Jahr in seinem Buch The Grand Chessboard die Ukraine als geopolitische Schlüsselregion auf dem eurasischen Kontinent kennzeichnete.
Zuletzt, mit seinem Video-Beitrag auf dem Weltirtschaftsgipfel in Davos, erntete der 99jährige Henry Kissinger Entrüstung mit seinem Vorschlag, der Ukraine als Preis für eine Friedenschance mit Putin den Verzicht auf den Donbass (und implizit auch auf die Krim) zuzumuten. Ob Putin, dessen Armee trotz aller technischen Schwächen die gesamte Schwarzmeerküste einschließlich der Stadt Cherson okkupiert hat, sich auf solche Konzessionen noch einzulassen gedenkt, steht auf einem anderen Blatt.
Wer in Deutschland derartige Analysen und – hypothetischen – Konzepte der Konfliktlösung ins Spiel bringt, begibt sich ins politisch-mediale Abseits. Mit seinen Einwänden gegen historische und politische Einseitigkeit zog der Sozialdemokrat Klaus von Dohnanyi denunziatorische Anwürfe als ›Putin-Versteher‹ sowie – im hämischen Jargon der ›woken‹ Moral – als ›alter weißer Mann‹ auf sich. Selbst Bundeskanzler Scholz, der offenbar anders als seine Außenministerin Baerbock oder der CDU-Oppositionsführer Merz bei Panzern und schwerem Gerät noch Zurückhaltung empfiehlt, wird in den Qualitätsmedien bereits ob seiner zögerlichen Haltung kritisiert.
Man kann derlei – politisch wirksame – Emotionen auf drei Ursachen zurückführen: erstens auf die aus der deutschen Vergangenheit erwachsenen, politisch abrufbaren Schuldgefühle, zweitens auf die ideologischen Maßgaben im demokratischen Zeitalter, in denen es – wie drittens allgemein in Kriegszeiten – nur um die eine Frage geht: Wer sind die Guten, wer die Bösen? Entsprechend der Dichotomie geht es danach nur noch um den Sieg über das Böse. Mit seinem – weder zu rechtfertigenden noch zu verharmlosenden – Angriff auf die Ukraine, mit der Art der Kriegsführung, erst recht angesichts der Massaker von Butscha, erscheint der KGB-Mann Putin als Protagonist des Bösen. Der als Experte aufgerufene Osteuropa-Historiker Timothy Snyder bringt das Böse auf den politisch zeitlos gültigen Begriff: Putin ist ein Faschist.
Ungeachtet solch geistiger Gewissheit zieht sich der Ukraine-Krieg in noch ungewisser Länge hin. Mehr noch: Es gibt Stimmen, die – entgegen aller moralisch motivierten Parteinahme für die Ukraine – eine Niederlage des Landes vorhersehen. Zu ihnen gehört hierzulande der emeritierte Politikwissenschaftler und Machiavelli-Experte Herfried Münkler. Für die Ukraine bedeutete selbst ein beide Seiten erschöpfendes Patt eine Niederlage. Denn aller Wahrscheinlichkeit nach wird Putin die von ihm okkupierten Gebiete in der Ostukraine, die breite Landbrücke von Noworossija zur Krim, am Ende dieses Krieges nicht mehr herausgeben.
All das mag unsere Vorstellungen von Gerechtigkeit und politischer Moral verletzen, ändert indes nichts an den Bedingungen und Spielregeln der politischen Realität. Anders als die Deutschen im II. Weltkrieg erfahren mussten, ist die Weltgeschichte nicht das Weltgericht. Diese – nicht nur im Hinblick auf die Ukraine unbequeme – Einsicht wäre in ahistorischer Gegenwart in deutschen Schulen, Seminaren, auch in den sich leerenden Kirchen zu vermitteln. Sie zwingt zum tieferen Nachdenken, steht indes im Widerspruch zu einfachen Kategorien von Politik und Moral.