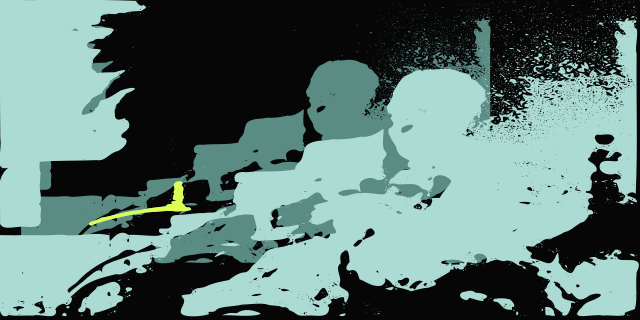von Herbert Ammon
I.
Am Freitag, den 11. Juli 2025, wurde auf der Bühne im Bundestag ein politisches Lehrstück aufgeführt, welches von der Regie – den Parteispitzen der Regierungskoalition – im Spielplan so nicht vorgesehen war. Noch in der Woche zuvor hatte der Richterwahlausschuss des Bundestags dem zwischen CDU/CSU und SPD ausgehandelten Dreiervorschlag – zwei SPD-affine Juristinnen, der Arbeitsrechtler Günter Spinner als Kandidat der CDU – für drei vakant werdende Sitze am Bundesverfassungsgericht zugestimmt.
Als in rechtskonservativen Medien Kritik an den beiden SPD-Kandidatinnen, insbesondere an Positionen mit verfassungsrechtlicher Tragweite der Potsdamer Juraprofessorin Frauke Brosius-Gersdorf, laut wurde, verteidigte der Landesgruppenchef der CSU-Bundestagsfraktion, Alexander Hoffmann, noch die Absprache. Er rief dazu auf, die Wahl von Brosius-Gersdorf zu unterstützen. Wichtiger als alle Bedenken gegen die Kandidatin sei »ein geschlossenes Votum der Parteien der Mitte«. Das »rechte«, der AfD zupass kommende Störmanöver im Bundestag schien ohne Folgen zu bleiben.
Am 11. Juli, dem letzten Tag vor der Sommerpause, sollten die hohen Ämter durch Wahl des Parlaments besetzt werden. Doch am Tag vor der Abstimmung tappte Bundeskanzler Merz in eine rhetorische Falle, die ihm die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch zum Thema »Menschenwürde und Abtreibung« gestellt hatte. Nunmehr regte sich, zuletzt noch angespornt von katholischen Bischöfen, bei einer relevanten Anzahl von Abgeordneten der CDU/CSU, das Gewissen und der Anspruch auf ihr freies Mandat. Die für die Wahl der Verfassungsrichter erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit war danach für Kanzler Merz und den CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn nicht mehr durchzusetzen.
Es drohte ein Eklat im Bundestag sowie ein Koalitionskrach. Schließlich tauchte ein Plagiatsvorwurf auf, der Merz vor Sitzungsbeginn als Vorwand diente, die Richterwahl abzusagen. Die SPD, mit ihrer Strategie zur Etablierung eines »progressiven« Verfassungsgerichts vorerst gescheitert, zeigte sich mehr als überrascht. Am Ende setzte die Koalitionsmehrheit im Bundestag – begleitet von zielgruppengerechter Empörung der Grünen und der »Linken« – die Richterwahl von der Tagesordnung ab. Die Wahl zum Verfassungsgericht wurde auf die Wiederkehr des Parlaments im September vertagt. Bis dahin wird das Thema »Richterwahl im Bundestag« das Sommerloch in den Medien füllen. Immerhin hat die SPD-Führung bereits angekündigt, an ihren Kandidatinnen festzuhalten.
In dem an ihrer Person entbrannten Parteienstreit hat sich Brosius-Gersdorf selbst als Vertreterin der »demokratischen Mitte« vorgestellt, obgleich die von ihr vertretenen Positionen durchaus dem Spektrum der politischen Linken zuzuordnen sind. Sie befürwortet die Streichung der Kompromissformel »rechtswidrig, aber straffrei« im Abtreibungsparagraphen 218, Gendern im Text des Grundgesetzes, geschlechterparitätisch (offenbar ohne Berücksichtigung der Kategorie »divers«) zu besetzende Wahllisten, die Neudefinition des Familienbegriffs samt Leihmutterschaft sowie Vermögensumverteilung im Sinne »sozialer Gerechtigkeit«.
Mit »demokratische Mitte« verwendet die vorerst gescheiterte Kandidatin den mit politisch-moralischem Gütesiegel erhobenen Begriff, der in letzter Zeit von fast allen Protagonisten »unserer Demokratie« gegen die AfD ins Spiel gebracht worden ist. Er bedarf vermeintlich keiner weiteren Interpretation. In Wirklichkeit ist die Bestimmung der »Mitte« eine Frage der Perspektive. Entsprechend scheiden sich im eigenen Anspruch auf die ubiquitäre Mitte die Geister.
II.
Was auf den ersten Blick als parteipolitisches Spektakel erscheinen mag, wirft grundsätzliche Fragen zu Theorie und Praxis der res publica auf. Es geht um Begriff und Inhalt der im Parteienstaat von allen Parteien – von der AfD bis zur Partei »Die Linke« - beschworenen und für sich (»unsere«) reklamierten Demokratie.
Zu Recht weisen seit je Verfassungsrechtler, Staatstheoretiker sowie Historiker die im »Volk« - immerhin laut Theorie und laut Artikel 20,2 GG der alle Staatsgewalt legitimierende »Souverän« - verbreitete naive Vorstellung von »Volksherrschaft« zurück. Die für die Bundesrepublik relevante Definition ihrer 1949 im Grundgesetz mehrfach betonten »freiheitlich-demokratischen Grundordnung« wurde 1952 vom Bundesverfassungsgericht anlässlich des Verbots der NSDAP-Nachfolgeorganisation SRP formuliert. Im Verbotsverfahren gegen die neonazistische NPD 2017 wurde dieser Begriff vom Verfassungsgericht noch einmal spezifiziert. Demnach beruht die freiheitlich-demokratische Grundordnung – ehedem, in den Jahren um 1968, von der neuen und nicht mehr so neuen Linken als FDGO persifliert – auf den Prinzipien der Menschenwürde (Art. 1,1 GG), der Demokratie (im Sinne der institutionalisierten Volkssouveränität) und des Rechtsstaats.
Die Grundlage des Rechtsstaats ist die Gewaltenteilung oder Gewaltentrennung, welche die Unabhängigkeit der Justiz von politischer Einflussnahme sichern soll. Man könnte die Judikative, die »dritte Gewalt«, sogar als das wichtigste Element in einem freiheitlichen Staatswesen bezeichnen, denn sie wirkt als Garantin der Grundrechte und schützt die Freiheitsrechte der Staatsbürger vor Anmaßungen der Exekutive sowie die Verfassung selbst vor politisch und/oder politisch-ethisch fragwürdigen Entscheidungen von Regierung und Parlament.
Soweit das dem demokratischen Rechtsstaat zugrundeliegende Verfassungsideal. Anders steht es um die Verfassungswirklichkeit. d.h. die politische Realität, wie sie im Streit um die Kandidatin Brosius-Gersdorf hervortritt. An ihr werden drei Aspekte des Politischen sichtbar:
Erstens: Die Metaphysik des Grundgesetzes ist nicht widerspruchsfrei. Gerade in der Selbstinterpretation ihrer Aussagen verweist Brosius-Gersdorf – »als Wissenschaftlerin« – auf die Diskrepanz zwischen »Menschenwürde« (Art. 1,1) GG) und Lebensschutz (Art. 2,2 GG). Sie hält – in Abwehr der von »rechts« vorgetragener Polemik – an der Zwölfwochenfrist für Schwangerschaftsabbrüche fest, spricht menschlichem Leben »Würde« hingegen erst von der Geburt an zu. Den – aporetischen– Widerspruch zwischen dem in der Kompromissformel zu § 218 gesicherten Freiheitsrecht (»Selbstbestimmung der Frau«) und dem staatsethisch fundierten »Recht auf Leben« überspielt die Juristin mit der apodiktischen Formel »biologistisch-naturalistischer Fehlschluss«.
Zweitens: Das Verfassungsprinzip der Gewaltenteilung wird im ideologisch aufgeladenen Parteienstreit um die Besetzung der Richterämter ausgehöhlt. Solange in den zurückliegenden Jahrzehnten die – laut Art. 22,1 GG an der politischen Willensbildung »mitwirkenden« Parteien sich im Sinne eines Grundkonsenses über die Besetzung des Karlsruher Gerichtes einigen konnten, blieb die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts gewahrt.
Unbeschadet einiger weniger »umstrittener« Entscheidungen – wie 1973 der Bekräftigung des deutschen Einheitsgebots unter Bezug auf die Grenzen von 1937 – blieb das institutionelle Fundament der Verfassung stabil. Wenn heute jedoch die – laut Wahlergebnissen nur Minderheiten repräsentierenden – Parteien SPD, Grüne sowie »Die Linke« ideologische Konzepte forcieren und/oder Strategien zur Durchsetzung ihrer Positionen qua Ämterbesetzung verfolgen, nähren sie Zweifel an den Institutionen des demokratischen Rechtsstaates. Zumal in Zeiten krisenhafter Ungewissheit schwindet das Vertrauen der Bürger in Staat und Regierung.
In der Öffentlichkeit erregte die Besetzung der Richterposten in den zwei Senaten zu Karlsruhe bislang kaum Aufsehen. Als höchste Institution staatlicher Gewalt erfreute sich das Verfassungsgericht laut Umfragen der höchsten Wertschätzung der Bürger. Anders als in den USA, wo in den Kontroversen um die Besetzung des Supreme Court die innere Spaltung des Landes sichtbar wird, blieb in Deutschland das höchste Verfassungsorgan von Streit verschont. Nun aber treten im Parteienstreit um die SPD-Kandidatinnen Brosius-Gersdorf und Ann-Katrin Kaufhold Parallelen zu dem in den USA seit langem stattfindenden Kulturkampf hervor.
Drittens: In einer politischen Gesellschaft, geprägt von gegensätzlichen Interessen, erscheint vollständige Ideologiefreiheit – im Sinne philosophischer Wahrheitssuche – eine realitätsferne Wunschvorstellung. Die Konkurrenz von Wertvorstellungen gehört zur pluralistisch- freiheitlichen Demokratie, in deren Rahmen Parteien um Wählerstimmen konkurrieren. Nichtsdestoweniger ist die ideologiefreie Besetzung der Ämter, insbesondere der Verfassungsgerichte in Bund und Ländern, im Hinblick auf die Neutralität der Rechtsprechung anzustreben. Die Politisierung des Justizwesens ist Gift für den Rechtsstaat.
III.
Wie immer die Kontroverse um die Kandidatin Brosius-Gersdorf ausgehen wird, sie macht deutlich, dass bei der Besetzung des Verfassungsgerichts das Gebot parteipolitischer Neutralität missachtet wird. Dass »das Verhalten der Union ... die bisher stabil geglaubten Grundfesten unserer demokratischen Grundordnung [erschüttert]«, wie die Grünen-Abgeordnete Karin Göring-Eckardt entrüstet kundtut, fällt unter die Rubrik parteipolitischer Polemik.
Falls der – derzeit in den Medien betriebene – Streit nach der Sommerpause in der Koalition sowie im Bundestag fortgeführt werden sollte, dürfte die Richterwahl in den Bundesrat verlegt werden, wonach sich die Gemüter wieder beruhigen dürften. Nichtsdestoweniger tritt im derzeitigen Parteienstreit um die »richtigen« Richter (und Richterinnen) in Karlsruhe eine Schwachstelle im Gefüge der sich als »Demokratie« bezeichnenden res publica hervor. Sie liegt in der Herausbildung eines politischen Systems, in dem Parteien »sich den Staat zur Beute gemacht haben« (Richard von Weizsäcker). Geht es nach den Absichten ideologisch gesteuerter Parteifürsten, gehören zur Beute auch die Institutionen der Judikative.