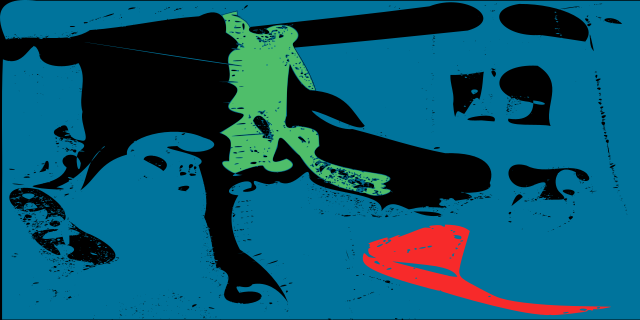von Ulrich Schödlbauer
Der Ausdruck dishonest – ›unehrlich‹ – hat im US-Wahlkampf, weitgehend unbeachtet vom deutschen Publikum, eine gewisse Rolle gespielt: »These are dishonest people« – so die stehende Wendung, mit der Donald Trump seine speziellen Gegner – die Hillary Clintons Team zuarbeitenden Medienleute samt ihren verborgenen Auftraggebern – bei den eigenen Anhängern markierte. Mit einigem Erfolg, wie man bei der Stimmenauszählung erfuhr.
›Unehrlich‹? Das Wort grenzt im Deutschen einerseits an die einfache ›Ausrede‹, andererseits an die irgendwann nicht mehr zu übersehende ›Unehrenhaftigkeit‹, vulgo Ehrlosigkeit dessen, der sich notorisch unwahrhaftig benimmt: eine Unehrlichkeit gibt die nächste. Shakespeares Englisch kommt zu vergleichbaren Ergebnissen: For Brutus is an honourable man; So are they all, all honourable men. In einer Einwanderungsgesellschaft, die um des Friedens willen zu Unehrlichkeiten tendiert, laufen vielerlei Ehrbegriffe nebeneinander her, hin und wieder kreuzen sich ihre Bahnen und es wird unerfreulich, gelegentlich kriminell. Dennoch dürfte, was Trump andeuten wollte, von den meisten Amerikanern ohne weitere Probleme verstanden worden sein. Das gilt auch für den unterlegenen Gegner. Jedenfalls wurden keine Versuche bekannt, den Vorwurf mit stichhaltigen Gründen zurückzuweisen. Stattdessen scholl es munter zurück: He is a liar. Aus irgendwelchen Gründen erfreute das die Deutschen. Tatsächlich imponiert das im Wahlkampf aufgebotene Maß an Ehrabschneidung ihnen noch immer und viele, bezahlt und unbezahlt, plappern ungefragt im Jargon der Abschneider weiter. Wie kommt es, dass eine Nation sich das Wort verbietet und die Sache mit soviel Inbrunst betreibt? Vielleicht gerade deshalb, weil ihr mit dem Wort das Bewusstsein der Grenze fehlt, jenseits derer sich der angegriffene Mensch verbirgt oder wie ein grimmiges Tier zurückschlägt? Das wäre zweifelsohne ein Makel, den, falls er existierte, viele zu teilen scheinen – unehrliche Leute eben, die das Ergebnis ›eher nicht‹ interessiert oder gerade deshalb, weil es den Aufmerksamkeitspegel beim Publikum nach oben treibt.
Ehre wem Ehre gebührt – wem gebührt sie, die Ehre, wenn nicht dem, der sich in seiner Ehre verletzt fühlt? Hat Trump die Ehre der amerikanischen Frau oder des weiblichen Geschlechts im Allgemeinen verletzt, als er sich seiner Gegnerinnen schonungslos annahm oder als eine indiskrete Aufzeichnung den Weg in die Öffentlichkeit fand und dort weidlich ausgeschlachtet wurde? Die amerikanische Sprache bevorzugt in einem solchen Fall das Wort ›decent‹, das an Prägekraft das schwächliche deutsche ›dezent‹ weit übertrifft. Nein, Trump war nicht dezent, er war auch nicht decent, er war es so wenig wie sein Gegenspieler Obama, der ihm mangelnde decency vorwarf und selbst dabei – wie heißt es im Deutschen? – ganz schön holzte. Zweifellos konnten sich Angehörige der amerikanischen Mittelklasse, die Hillary Clinton als deplorables und einige ihrer weniger einfühlsamen Mitstreiter als white trash bezeichneten, in ihrer Ehre verletzt fühlen, und zwar entsprechend den von beiden Seiten geteilten Maßstäben einer Gesellschaft, in der Stolz auf das im persönlichen Leben Erreichte als Nonplusultra gilt. Wahrscheinlicher ist, dass sie einfach begriffen: Not my candidate.
Es fällt nicht ganz leicht, die Ehre von Kollektiven zu treffen, deren Angehörige sich untereinander vor allem als divers wahrnehmen und empfinden. Leichter fällt es, eine Fahne zu entehren – wie dies nach der Wahl aus vermutlich unterschiedlichen Gründen Demonstranten in Oakland und Athen taten – als ›Amerika‹ oder ›die Frauen‹, – schon gar nicht die Ehre der Männer, denn seine männliche Ehre, das weiß man, verteidigt jeder für sich allein. Diese Diversität der Individuen vor jedem Kollektiv und vor jeder biologischen Zuschreibung ist etwas so zutiefst Menschliches, dass man sich wundert, warum das demokratische Wahlkampfteam auf die Idee kommen konnte, einen Entehrungs-Wahlkampf zu führen, der bei keiner der nacheinander angepeilten Wählergruppen – Latinos, Schwarze, Frauen – zum gewünschten Erfolg führte. Der Grund ist einfach, aber er muss auch benannt werden: Parteien, die vor allem, wie Clintons Demokraten oder die europäische Linke, auf Minderheiten und Kollektive mit Emanzipationsbedarf setzen, laufen Gefahr, die Mentalität von organisierten Aktivisten auf die gesamte Gesellschaft zu übertragen. Das geht schief, das muss schiefgehen, das ging auch in diesem Fall schief.
In Kampfbünden spielt die Ehre seit altersher eine wichtige Rolle – nicht, weil ihre Mitglieder mit so überaus empfindlichen Gemütern ausgestattet wären, sondern weil es schön und motivierend zugleich ist, wenn Kollektiv und Einzelner sich an einem Punkt angegriffen fühlen dürfen: Einer für alle, alle für einen. Im Zeitalter von Twitter und Facebook lassen sich Empörungsstürme lostreten, vor denen die unerschrockensten Feldherrn vergangener Epochen bleich ins Glied zurückgetreten wären, sie haben aber wenig oder nichts zu bedeuten. Vielleicht doch, wenn man auf die Umfrageergebnisse blickt, von denen sich Wahlkampfmanager und Sympathisanten – angeblich – in die Irre führen ließen. Dass hier Grenzverwischungen entstehen, konnte man schon vor der Wahl auf einschlägigen Portalen nachlesen. Danach waren die entschiedenen Trump-Wähler zwar deutlich geringer an Zahl, aber dafür entschlossener, ihren Kandidaten auch wirklich zu wählen. Wer daraus die Konsequenz zog, das Trump-Lager sei zwar geschlossen, aber wenig attraktiv für Unentschlossene, lag nicht nur falsch, sondern analysierte auch falsch: die Hürde, sich in Umfragen zu Trump zu bekennen, lag höher, es war nicht chic, es galt als unfein, man konnte dem Gefühl nicht entgehen, zu den bösen Buben zu zählen oder als Verräterin durchzugehen. Die Hürde entfiel in der Wahlkabine und das Ergebnis korrigierte die falschen Erwartungen.
In der Intimität der Wahlkabine schlägt die Stunde der Wahrheit. Das sollte aufrechte Demokraten, gleichgültig welcher Partei, aufrichtig freuen. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Die Idee, man dürfe den Wähler nicht unbeaufsichtigt in die Kabinen entlassen, könnte jedem Vertreter zur Zierde gereichen, dem gerade ein fetter Auftrag davonschwamm. Demokratischer Gewahrsam, in welcher Form auch immer, scheint vielen als Gebot der Stunde durch den Kopf zu geistern. Der Gedanke, Demokrat sei, wer die eigenen Präferenzen teilt, geistert mit, er zeigt, dass weite Teile der Gesellschaft wieder geneigt sind, Hexenmeistern wie Teufelsaustreibern auf den Leim zu gehen. Wer das gut findet, sollte bedenken, dass in Ländern, in denen diese Praxis, unter der Fahne welcher Religion auch immer, fest etabliert ist, fast alle Versuche, demokratisches Denken und ein demokratisches Regime dauerhaft zu verankern, bislang gescheitert sind. Gibt es demnach eine Ehre der Demokraten? Wer verletzt sie, wer kündigt sie auf, wer verhält sich unehrlich? Das sind Fragen, mit denen man sich, angesichts der nächtlichen Bilder von Amerikas Straßen, einmal beschäftigen müsste.