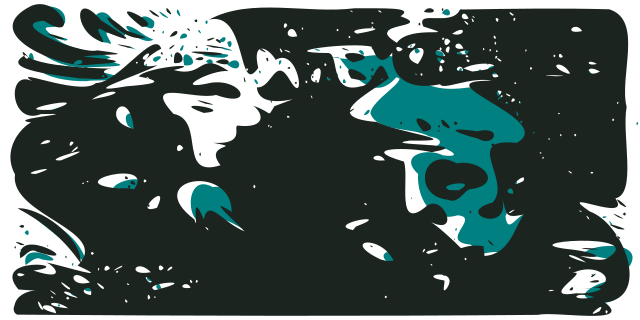Zum Tode von Paul Mersmann
von Ulrich Schödlbauer
Der Surrealismus, die europäische Sprachschule der Zwischenkriegszeit, ist nicht tot. Er hat die leichtgewichtigen Werke Bretons und Aragons überlebt, das Ende der Ismen und den neuen Verismus, weil er in der Werbung und der Politik mächtige und prinzipiell unabschaffbare Verbündete besaß. Er musste sie nicht erst lang überzeugen. In ihm fanden sie willkommene Werkzeuge ihrer Überzeugungsarbeit. Der elitäre Kommunarismus, der massendemokratische Elan, der jede einzelne Handlung mit einer Zukunft verbindet, die weiß und offen in einem kochenden Weltall schwebt – Blochs Feuertopf (»Die Materie ist ein Feuertopf«) mitsamt dem rituellen Kopfschütteln, das er hervorruft, ist sein Erzeugnis. Der Surrealismus der Tat scheut die Macht, die er sucht. Er sucht nicht ihre Nähe, sondern sie selbst, er will sie, aber im Modus des Nichtbesitzens. Er will nicht als ihr Inhaber gelten, sondern als ihr Zerstäuber. Dazu bedarf es einer Gesellschaft von Gleichgesinnten, die es nicht gibt, die sich von Fall zu Fall erfinden muss, um den, der die Gunst der Stunde nützt, um sich in den Besitz des Zaubermittels zu setzen, wieder zu entzaubern und, wenn möglich, von der Bühne zu vertreiben.
Der Surrealismus hat etwas geschaffen, in dem sich die heutigen Generationen mit einer Selbstverständlichkeit bewegen, als sei es unmittelbar dem Garten Eden entsprungen: die Welt des Designs, in der Politik und Werbung eins sind. Propagandisten haben immer von der Einheit geträumt und konnten sie nicht erreichen, weil sie glaubten, für die Politik – oder den Verkauf von Büstenhaltern – trommeln zu müssen. Diese Baalstrommeln, die von allen vernommen wurden, deren Lebensgeschichten in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts zurückreichen, und allen in den Ohren klingen, die mit dem Wort ›Leichenhaufen‹ nicht nur die Erinnerung an Kinoabende verbinden, werden immer verhindern, dass ›die‹ Menschen zueinander finden. Dass sie das Design nicht zu verhindern vermochten, ist vielleicht der Leidenschaft für Stereoanlagen und schnelle Autos zuzuschreiben, mit der die Konsumgesellschaft in die Herzen der ehemals Progressiven Einzug hielt. In der Welt des Designs, in der alles an alles erinnert oder erinnern könnte, der Welt des Un-Sinns und der Hermeneutik für jedermann, der Baudrillards und der Sloterdijks, gilt, wie bekannt, das Fortkommen als Maß aller Dinge – zu Wasser, zu Lande und durch die Luft, per Kabel oder im Weltraum. Wer fortkommt, darf sich Hoffnungen machen, er darf es selbst, ein einsamer Wilder an seiner Feuerstelle, die Skalps seiner Gegner klingen wie Glöckchen im Gebüsch seiner Wünsche, er setzt den Fuß auf den Nacken des Gestern und fordert von ihm die 50 Cent zurück, die er seinerzeit investiert hat, dies alles, wohlgemerkt in voller Fahrt.
Es gibt einen Surrealismus des Designs und es gibt den Surrealisten, dem die Zigarre nicht ausgeht. Zwischen Dada und dem da klafft eine Lücke, die letzterer mühelos mit seiner von niemandem bemerkten Anwesenheit füllt. Der Surrealist hat überlebt. Das ist mehr, als man erwarten konnte, und es ist sein ganzes Geheimnis. Keine Geheimnisse haben, Oberfläche sein, ganz Oberfläche sein, dieser surrealistische Ehrgeiz lässt sich auf zweierlei Weise erfüllen. Im Design hat sich die Oberfläche von der Person emanzipiert. Sie ist erwachsen geworden und benützt die Personen als Spiegel. Im Spiegel der menschlichen Natur zeigt sich das Rasierset als das, was es ist: als ruhige Gegenwart der Form, der immateriellen Materie, der impersonalen Substanz und der in sich zurückgekehrten Funktion. Die Oberfläche des Surrealisten bleibt stets immateriell, die von ihm veranlassten Materialisationen sind Exempel, mit denen er nur beweisen möchte, dass es geht. An dieser knappen, fast schroffen Geste des »Geht doch!« erkennt man ihn. Abgeschaut hat er sie den Klempnern im Augenblick ihres Triumphes, wenn sie den Hahn aufdrehen und der Wasserstrahl gurgelnd im Abfluss verschwindet. Der Theaterklempner Heiner Müller, in dessen abgewetzter Handwerkertasche zuguterletzt der Schrott ganzer Jahrzehnte klapperte, verdankt seinen späten Medienruhm dieser im leeren Raum ausgeführten Bewegung. Ein anderer Surrealist, Michel Houellebecq, hat die Sparsamkeit der Mittel in einer anderen Richtung perfektioniert. Ein ums andere Mal führt er die nicht vorhandene Zigarre an das Lippenpaar, das nicht aufhört, sich zu knutschen, aber dabei vergisst, dass es sich eigentlich öffnen wollte.

Auch Paul Mersmann hat überlebt. Das ist umso verwunderlicher, als er kein Surrealist im Wortsinn genannt werden kann. Zwar verweist er jeden, der es verdient, auf seine Übungen in der écriture automatique. Doch abgesehen davon, dass sie ein knappes Menschenalter zurückliegen, eignen sie sich vor allem dazu, ihn zu widerlegen. Das automatische Schreiben ist kein Kennzeichen des Surrealismus, eher ein Merkzeichen seiner Ignoranz. Mersmann ignoriert den Surrealismus durch Nähe. Vielleicht wäre er Max Ernst geworden, wenn er nicht Mersmann hätte werden müssen. Durch ihn erleidet Max Ernst das schwere Schicksal dessen, der zu früh kam. Erst Mersmann ist es vergönnt, die richtigen Schlüsse aus dem Scheitern des automatischen Schreibens zu ziehen, das der Aushebelung des Denkens dient und daher zwangsläufig einen falschen Begriff des Denkens transportiert – dieses alberne Bennsche Bild der übergestülpten Großhirnrinde, die denkt und denkt und denkt, lauter Rationales, jedes davon ein widerlicher kleiner Unterdrücker des Irrationalen, mit dem es verheiratet ist und dem er den Zugang zum Markt der Deutungen versperrt. Oder, wie Bruno Latour zu schreiben pflegt: der Geist in der Flasche, der sich ein Gegenüber verschafft, um es zu beschreiben, zu erforschen und zu beherrschen. Dieser blühende Unsinn ist die Grundlage des ignoranten Surrealismus, des Surrealismus, dessen Befreiungsphantasien die Pol Pots vielleicht stärker motiviert haben als alle nachgeschobenen Marxismen.
Mersmanns A.B.C.-Bücher sind nicht automatique, sie sind autopoetisch. In ihnen ernährt sich die Poesie aus sich selbst. Sie ernährt sich mittels Reminiszenzen gemäß den Vorstellungen der Chirico-Brüder vom Erinnerungsraum der Kulturen, in dem das Kunstwerk aus der Taufe der Emotion gehoben wird, als sei es nunmehr neu, obgleich es doch ganz das alte ist, versehen mit einem neuen Leben, einer vita nova – auch das eine nicht ganz neue Vorstellung, wie überhaupt des Denken des Neuen auf Ladenhüter angewiesen bleibt. Giorgio de Chirico kommt in Mersmanns Denken die Rolle des Türöffners zu. Der leichte Hauch, der nach einem halben Jahrhundert noch immer von der wundersam aufgetanen Pforte herstreicht, flüstert den Namen in mancherlei Modulationen, eine schmeichelnder als die andere. De Chiricos weitgehend unbekannt gebliebenes Verdienst ist es, Mersmann ermöglicht zu haben, vielleicht die einzige metaphysische Tat, die er in seinem Leben begangen hat, jedenfalls die einzige, die es ihm erlaubt hätte, Theorie und Praxis in Übereinstimmung zu bringen. Denn er konnte den jungen Mann, den auf den Weg zu bringen er im Begriff stand, nicht unterscheiden: nicht von dem Landsknecht, der sich im Sacco di Roma durch besondere Grausamkeit auszeichnete, nicht von einem vorbeiziehenden Bewunderer Mussolinis, der sich zu tarnen gelernt hatte und und im Gewand transalpiner Beflissenheit die Tapisserie des Abendlands ausschritt, nicht von irgendeinem südlich bewegten Pinselschwinger, dem die Formen des Nordens zu unklar und seine Farben zu verwaschen vorkommen und der deshalb dem Himmel Cherubinos eine Flasche Chianti nachkippt. Er konnte ihn nicht unterscheiden. Die spontane Geste, die er ausführte, um dieses Leben zu entscheiden, und die so, wie sie geschah, vielleicht in keines Menschen Gedächtnis mehr zu finden ist, da Mersmann, der sich erinnern könnte, erst in diesem Augenblick zur Welt kommt, diese Geste ist weder absurd noch beliebig; sie ist ›metaphysisch‹, i.e. surreal in dem Sinn, in dem sie auf einem der Bilder de Chiricos erscheint: leere Geste einer Statue, die das Meer veranlasst, in der Bewegung innezuhalten, und das Rauschen im Ohr des Betrachters verstärkt.
Wer Mersmann sieht, bekommt es mit Texten, wer ihn liest, mit Bildern zu tun. Das ist ganz normal, aber es verstärkt sich mit den Jahren, es verstärkt sich mit dem Schwinden seiner Ansprüche auf die Art von Anerkennung, die auf Geltung beruht, also die Art von Anerkennung, die die liberale Gesellschaft dem Einzelnen beharrlich verweigert. Der Name Mersmann steht hier als bloße Metapher eines Prozesses, das durch das Hochglanzelend der Kunstdruckerei, an der sich die Studenten delektieren, nur notdürftig kaschiert wird. Was damals inmitten der Gesellschaft, in einem Gemisch aus Erleichterungs-, Aufbruch-, Wieder- und Neugewinnungsphantasien, als Wille zur Zivilisiertheit nach dem Ende der Barbarei beginnt, diffundiert rasch oder langsam, je nach Blickwinkel, in der sich durchsetzenden Kraft-durch-Freude-Community, die sich als die wahre weltumspannende Zivilgesellschaft begreift und in den ehrbaren Parteigängern Richard Rortys ihre hingegebensten Herolde findet. Bretons in den Sechzigern aufgewärmte These von der Vorläuferschaft der Kunst, die honorige, leider falsche Vorstellung, dass das, was bisher notwendig Kunst war, ab hier und heute gelebt werden müsse, kratzt die Kunstwerke wenig, sie verstört – oder befreit – die Kunstvertreter, die Künstler, die Kunsthändler, die Museumsleute, alle, die sich was einfallen lassen müssen, um in der funktional differenzierten Gesellschaft auch funktional zu überleben. Wer macht sich um das Überleben der Kunst Gedanken, derweil das eigene Gefahr läuft, den Anschluss zu verpassen? Der Anschluss, der berühmte Anschluss... Das Streben nach Anschlussfähigkeit in einem nicht endenden Blitz-Nachkrieg verwandelt Künstler in Wühltischkonkurrenten, die an der Gier der anderen den Wert der Fetzen abzulesen versuchen, die sie sich ergattern, um darin zu paradieren. Der umfassende Witz dieser Jahre ist die ›legitime Moderne‹. Kaum in Freiheit gesetzt, in diese umfassende Freiheit, die sie sich selbst unter dem Titel der Moderne attestiert und erkämpft haben, legen sich die Künste in ein Prokrustesbett aus Ängstlichkeiten und Animositäten, begeben sich an einen Ort handwerklicher Scheu und ideologischer Großsprecherei, wo alles, was sie noch dürfen, sich in unsichtbare Arbeit verwandelt: Arbeit am gesellschaftlichen Fortschritt, Arbeit an der Selbstverwirklichung, Arbeit an Räumen, mit Sensibilität gefüllt bis zum Erbrechen, Arbeit an interkulturellen Tunnelsystemen, in denen in einer nicht auszumachenden Zukunft U-Bahnen verkehren sollen, Arbeit an der Reduzierung des Suchtproblems und der Legasthenie, Arbeit am Verstehen des Anderen (eine umfassende Tätigkeit, deren Resultate mittels eines ausgeklügelten Drainagesystems ins kulturelle Gedächtnis abfließen, an dem schließlich auch gearbeitet wird) – der ganze absurde Potlatsch, von Menschen bestritten, die sich davon irgendeine Art von Alltagsresistenz versprechen, und der ohnehin nur existiert, weil Kultur aufgrund irgendwelcher peinlicher Verwechslungen als Standortvorteil gilt und ausgewiesene Kulturstaaten ein Taschengeld für sie abzweigen – unter der Voraussetzung, dass das Marketing stimmt und wir alle etwas davon haben.
Einer, der nichts davon hat, unter allen Umständen nichts davon hat, kommt entweder mit zugenähten Taschen auf die Welt oder man hat versäumt, ihn im Gebrauch von Schultern und Ellbogen einzuweisen. Ein weises Versäumnis, wenn man bedenkt, dass der Gebrauch der Ellbogen kontraproduktiv für jemanden ist, dessen Aufgabe darin besteht, Lösungen zu finden wie das Wasser, das seinen Weg durchs Gelände findet, in Bewegungen, die als Suchbewegungen interpretiert werden können, deren jede aber eine Findung bedeutet, etwa wie man sich genetische Veränderungen vorstellt, die durch kein Suchen und Wollen präformiert sind. Ein solcher, sagen wir: Poet steht immer richtig, auch mit dem Rücken zur Wand und selbst mit dem Gesicht... aber diese Assoziation sollte man rasch vergessen, wenngleich es durchaus richtig ist, dass eine blödsinnige Kulturkritik eine Zeitlang nicht müde wurde, Ballettmusiken und Gedichte für die Taten von Massenmördern haftbar zu machen und mit Berufsverbot zu belegen. Die figurale Kunst, die in den Lautsprecherkrieg zwischen Ost und West geriet, könnte, wenn sie ins Erzählen geriete, so manche Schnurre erzählen. Zum Glück sind Leinwände stumm, an den offiziellen Ausstellungsorten stehen sie in scharfer Konkurrenz zu anderen, weniger überkommenen, dafür bereits herunterkommenen Kunstformen, was sie naturgemäß zusammenrücken lässt. Wir, die wir auftauchen aus der Flut, um sogleich in der nächsten zu versinken, zählen die Köpfe: es sind erstaunlich wenige.
Die neue Barbarei trifft den, der der alten mit Mühe entronnen ist, verständlicherweise hart. Umso härter, je unverständlicher sie ihm sein muss, da die Arbeiten dessen, an den er sich anschließt, ihm wie das Werk der Lauterkeit selbst vorkommen. Weit gefehlt – de Chirico gibt in den Kunstübersichten der Zeit die Dame ohne Unterleib, das Exempel eines entzweigeschnittenen Oeuvres, von dem nur die eine Hälfte bekannt ist und gilt, während die andere, die ›fette‹ Malerei, wie Mersmann sie nennt, schamhaft versteckt und schamlos denunziert wird. Die saubere Hälfte liegt in den fernen, unerreichbaren Zwanzigern, sie bietet nichts, woran sich anknüpfen ließe, dafür lässt sie sich mühelos bestehlen, was auch geschieht. Ein frühes Mersmann-Bild zeigt den Künstler als Christusfigur mit grünem, fliehendem Haupt, die Hand an sich legt ›in memoriam Francesco Borromini‹ – wer so malt, stiehlt nicht, er will eine Nachfolge antreten, legitim oder nicht, transalpin oder transversal. Nachfolge aber ist in jenen Jahren des Wiederaufbaus, der Wiedereinsetzung, der simplified versions, der Duplikate und Fälschungen nicht zu erlangen, auf alle Fälle nicht durchzusetzen, wer sie ertrotzt, bekommt ein Pflaster aufs Maul und darf das Klassenzimmer verlassen. Mersmann malt, er ist ein glücklicher Mensch. Er schreibt auch, glücklich der Mensch, dem die Wörter seiner Sprache zu Hand gehen, kein größeres Unglück als die Sprachlosigkeit der Pinsel und der wirre Umriss von Halbgedanken, der Geld und Ausstellungen einbringt.
Wer zu sehen gewillt und fähig ist, findet in Mersmanns A.B.C.-Büchern eine Abbreviatur der europäischen Malerei, keine tour de force, sondern eine dem aufblitzenden Wiedererkennen vorbehaltene Folge winziger Überblendungen und komisch-bizarrer Konfrontationen. Wer lesen mag, der findet in ihnen Landschaftserzählungen, wie sie seit Arno Schmidt nicht mehr versucht wurden. Aber das ist eine Nahperspektive, die nicht hergibt, aus welchen Quellen diese Poesie ohne Dichtung sich bedient. Ohne Dichtung deshalb, weil sie nicht dem Unbewussten, sondern der detailbeladenen Sprache folgt, dem Formelwesen des Wissens und der Überlieferung, nicht zu knapp dem zigmal gefilterten Pseudowissen der Anekdotenjäger und -sammler, mit den Nachschlagewerken in der Hand oder hinter dem Schreibtisch. Zu sagen, sie beginnt immer mit der Erschaffung der Welt, wäre so etwas wie ein Fauxpas, weil es das Thema ist, das in ihnen zirkuliert. Die Teufel- und Tölpelei der Welterschaffung dringt in die kleinsten Poren der Geschichte ein und lässt sie Gesichter schneiden. Das alt-grausige Gott ist tot lautet in Mersmanns Übersetzung La doux Marmelade, das süß' Marmelad. Er hat ihm eines der Bücher gewidmet, das lesens- und sehenswert ist, weil es das Leben als eine Nuance des Todes begreift oder besser umgreift wie eine Pflaume oder eine Kirsche, mit dem ganzen Widerwillen des Hungers, der seine Sättigung voraussieht und flieht.
Europas Gedächtnis ist kurz, es reicht nicht weiter als bis zum letzten Sieg oder zur letzten Niederlage, alles andere ist sorgfältig parzellierte Vorwelt. Wer ›Wir Europäer‹ sagt, ist ein Heuchler oder ein Schwätzer. Die Europäer, das kennt man, sind Leute, denen man gern nach Europa verhelfen würde, aber ihre Aufnahme scheitert an Sichtvermerken und kleinen Unregelmäßigkeiten, die sie sich leisten, als wären sie Anfänger, es sind aber Routiniers. Europa verfehlen ist eine große Aufgabe, der sich niemand entziehen darf, der Europäer sein will. Vermutlich ist die größte Gefahr, die von der Einwanderung ausgeht, dass aus ihr eine Klasse von Europäern entstehen könnte, von Leuten, die in London oder Berlin in gleicher Weise zuhause sind wie in Prag oder Lissabon. Europa wird Mittel und Wege finden, das zu verhindern, und eines dieser Mittel ist die Kunst. ›Wie befinden Sie sich?‹ lautet die Frage, mit der man einen Erdteil in Sektoren aufteilt, mit Passierscheinen und Schießbefehl in der einen, mit billigen Zukunftsoptionen in der anderen Hand. Das ist die Domäne der Kunst, der Kunst als immerwährender Bergpredigt, während der man sich bückt und den Tauben die Giftkörner hinstreut, auf dass sie unauffällig verrecken. Was Europa eint – neben der Währung, die es trennt, und der Technik, die es gefährdet –, ist die Überzeugung von der überwölbenden Einfalt der Kunst, die auf allen Knien etwas anderes lallt. Das deutsche Lallen ist jenes erwähnte Wir Europäer, vor dem die anderen stets einen Schreck bekommen, obwohl sie sich gleichzeitig den Bauch halten vor Lachen. Das andere Europäertum der Kunst ist hier wie allenorts in die Hände von Spezialisten gelegt. Sie halten Kongresse ab und organisieren Ausstellungen, die in der Regel gut besucht werden, denn das Publikum ist dankbar, wenn es etwas über die Vorwelt erfährt. Den Kunstzirkus geht das nichts an. Da er sich dauernd auf Reisen befindet, hält er den Proviant klein und verlässt sich auf ein System von Stützpunkten, die rund um die Welt dafür sorgen, dass ihm nichts abgeht.
Ist Mersmann ein Europäer? Ist Mersmann ein ›guter‹ Europäer? Solche Fragen stellt man besser nicht ohne Anlass und die Szenekunst bietet keinen Anlass, denn sie ist Oberfläche – die Oberfläche der Welt. Die imaginäre Oberfläche der Kunst ist die Oberfläche einer anderen Welt, einer Welt aus untergegangenen Dingen, einer Welt des Gedächtnisses, nicht des Gedenkens, der Denkmäler und der Witzblätter, die sich an ihnen mästen. Ob Mersmann ein guter Europäer ist, entschiede sich daran, ob diese Oberfläche bei ihm vorhanden, ob sie ausgebreitet genug, ob sie europäisch genug ist, ob sie hinreichend über Europa hinausreicht, um europäisch genug zu sein, ob sie in Funktion, das heißt aufnahmebereit ist, ob sie atmet. Das Elefantengedächtnis der Kunst ist nicht allein gut organisiert, es ist dicht: wer Reihen auslässt oder unterschlägt oder willkürlich überspringt, treibt sie unweigerlich in die Wälder und in den Schwachsinn. Die Idolatrie des Neubeginns, die deutsche Schwäche, das Abonnement auf eine Moderne, die sich jenseits der Sprachgrenze in Moden verflüchtigt und eher einem ästhetischen Zwangsbewirtschaftungssystem ähnelt als einem offenen Austausch, die leere Hoffnung auf eine neue Mythologie, die aus Lucky Luke einen ästhetischen Frondeur gemacht hat und aus dem spöttischen Einfall der Brillo Box ein trostlos heroisches Nevermore der Kunst, hat sehr wenig von Europa, sie hat nur Geld. Überdies macht sie, wie jede Droge, abhängig – in diesem, in unserem Fall von einem eingebildeten, bis an die Grenzen des Lächerlichen aufgeblasenen Amerika, in dem all das Neue wirklich sein soll, das man sich hierzulande als Norm auferlegt.
Mersmanns Bibel-Blättern liegt ein grandioser Einfall zugrunde: Was wäre, wenn die Durchlässigkeit dieser Erzählungen, ihre unbegrenzte Aufnahmefähigkeit für alle folgenden, diese auffallend heilsame und vielleicht letzte Transparenz der auf die westliche Moderne fokussierten Geschichte, sich als Fälschung erwiese? Wenn die Fremdheit zwischen der Bibel und uns letztlich unaufhebbar bliebe? Und: wenn wir nicht imstande wären, diesen Gedanken trennscharf durchzuführen? Wären dann unsere Geschichten gefälscht oder die biblischen? Eine unentscheidbare Frage, doch nicht weniger plausibel als die, welche Kafkas Mann vom Lande in Vor dem Gesetz am Ende zu stellen wagt. Immerhin ist es ein und dieselbe Frage, nur einmal zu Ende gedacht. Wie alle Bücher wird die Bibel von Leuten abgeschrieben und ›reproduziert‹, die sich und ihre plumpen Gedanken in sie eintragen. Das Weitertragen und das Sich-Eintragen ist derselbe Vorgang, getragen vom Willen zur Selbstauslegung, zur Schriftförmigkeit des eigenen Geschicks. Ist die Fälschung einmal erkannt, dann herrscht Krieg zwischen den haltlos aufeinander zufallenden Instanzen: ein Sammelsurium der Bilder und Anspielungen, der aufgeknüpften Gedanken und der sich gleichmütig im Fluss des Absurden wiegenden Betrachtungen. Als letzte und zweckloseste aller Verknüpfungen bleibt dem Maler-Kommentator die Kapiteleinteilung. Sie gilt als sakrosankt, als kulturelle Leitnorm lebt der Abzählzwang fort und fort.
Mersmann beginnt zu schreiben, als mit dem Begriff des Geistes auch die Kunst von den Radarschirmen der westlichen Welt verschwindet und die Straßenbahnhaltestelle an ihren Platz tritt. Im Grunde hat er immer geschrieben, in weiser Voraussicht, voller Nachsicht sich selbst und anderen gegenüber und voll Vertrauen in die unzerstörbare intellektuelle Substanz des Wortes. Er hat weitergeschrieben, wie es sich für einen Nachfahren der Argonauten gehört, der einmal aus Versehen ein paar Wikinger gebeten hat, ihm Platz zu machen. Im Weiterschreiben enthüllt sich die Welt, aber sie verhüllt sich auch. Ein solches Schreiben ist kaleidoskopisch. Es wirft sich nach vorn, es weckt die Erwartung, dass es sich einmal stellt: die großen Linien treten hervor, die Rosette glüht, das Licht wandelt sich in Erscheinung und wird zum Brot der Gläubigen, die in der Kathedrale des Buches ausharren, obwohl der Altar nur ein billiges Replikat des bei einem Bombenangriff zerstörten Originals ist, obwohl die Zentralheizung unter den Bänken den letzten Funken Frömmigkeit in ästhetisches Behagen verwandelt hat, obwohl die Knochen der Heiligen in ihren Blechbüchsen den Karbontest nicht überstanden haben. Eine solche Erwartung ist, wie auch das Wort, nicht zu entwerten. Als der Malerfürst Immendorf tot ist, bemerkt Mersmann: »Er war ein schlechter Maler, aber rechtfertigt das so ein Leben?«