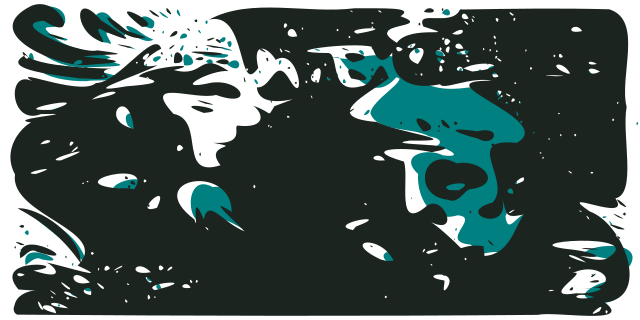von Moshe Zuckermann
Oft ist bereits eingehend dargelegt worden, warum Judentum, Zionismus und der Staat Israel als Kategorien auseinanderzuhalten seien. Weil nicht alle Juden Zionisten, nicht alle Zionisten Israelis und nicht alle Israelis Juden sind, geht die pauschal identifizierende Gleichsetzung dieser Kategorien miteinander grundsätzlich fehl, was zwangsläufig mit sich bringt, dass auch die sich von ihnen ableitende Gleichsetzung von Antisemitismus, Antizionismus und Israel-Kritik irrig sein muss. Das besagt nicht, dass Juden keine Affinität zu Israel empfinden, selbst dann, wenn sie nicht in Israel leben.
Das besagt auch mitnichten, dass man als Jude nicht den Staat Israel bzw. seine schiere Existenz unterstützt, obgleich man sich nicht als erklärten Zionisten ausweisen möchte. Israel kann durchaus einen Teil der Identität eines außer Israel lebenden Juden ausmachen, ohne dass er sich deshalb einer vollen Gleichsetzung besagter Kategorien verpflichtet weiß. Als gravierender in diesem Zusammenhang darf indes gelten, dass ein Jude durchaus kein Zionist zu sein braucht, auch dann nicht, wenn er das Existenzrecht Israels nicht infrage stellt (wie es im Falle eines orthodoxen Juden oder eines jüdischen Kommunisten ist); dass ein Jude Zionist sein kann und dennoch eine radikale Kritik an Israels Politik und an der Entwicklung der israelischen Gesellschaft ausüben zu sollen meint (wie es bei nicht wenigen israelischen Staatsbürgern der Fall ist); dass ein Jude weder mit dem Zionismus noch mit Israel etwas am Hut haben kann, ohne dabei irgendjemandem zu gestatten, sein Judensein infrage zu stellen (wie es für viele Juden außerhalb Israels gilt, die dafür weder religiös orthodox oder Kommunisten sein müssen). Entsprechend mag auch festgestellt werden, dass ein Nichtjude ein Juden-, Zionismus- und Israel-Freund sein kann; dass ein Nichtjude ein Zionismus-Gegner, Israel-Hasser und Antisemit sein kann; dass ein Antisemit den Zionismus und Israel befürworten kann, und sei es, damit die Juden aus seiner Gesellschaft verschwinden; dass ein Nichtjude Kritik an Israel aus antisemitischen Gründen ausüben kann, aber auch – was wohl öfter der Fall sein dürfte – dass er Kritik an Israel üben kann, ohne Antisemit, ja nicht einmal Antizionist oder Israel-Gegner zu sein. Viele Konstellationen sind denkbar, eben weil Judentum, Zionismus und Israel und entsprechend auch Antisemitismus, Antizionismus und Israel-Kritik nicht kongruent sind.
Mit solch differenziertem Repertoire hat sich die politische Kultur Deutschlands seit der Nachkriegszeit stets schwergetan. Das gilt für die politische Kulturen beider nach dem Zweiten Weltkrieg errichteten deutschen Staaten, wobei allerdings die je eigene Auseinandersetzung damit einer entsprechenden ideologischen Eigenlogik unterlag. In der DDR spielte das ›jüdische Problem‹ insofern keine Rolle, als in ihr wenig Juden lebten und unter ihnen nicht wenige gerade Eingang ins kulturelle und politische Establishment des ostdeutschen Staates fanden (ganz abgesehen davon, dass sich die offizielle Staatsgesinnung dieses sich als das ›andere‹ verstehenden Deutschlands einer antifaschistischen, mithin antinazistischen, somit also auch anti-antisemitischen politischen Tradition verpflichtet wusste). Weil aber die DDR sich im Blocksystem und im Rahmen des dieses System bestimmenden Kalten Krieges mehr oder minder moskauhörig verhielt, eignete sie sich die zionismus- und israelkritische Haltung der UdSSR an, welche sich ihrerseits von den durch den Kalten Krieg geprägten geopolitischen Interessen der Sowjets im Nahen Osten ableitete. Dass die antizionistische Gegnerschaft zu Israel antisemitisch motiviert sei, darauf wäre selbst in Israel kaum jemand gekommen – zumal die UdSSR zu den ersten Staaten gehörte, die für die Gründung des Staates Israel votiert hatten; erst als Israel zu Beginn der 1950er Jahre sich politisch aufseiten des kapitalistischen Westens schlug, geriet es in sowjetsche Ungnade (und somit also auch in die der DDR).
Anders verhielt es sich mit der alten BRD. Vor allem die geopolitische Konstellation dieses Staates in der unmittelbaren Nachkriegszeit brachte es mit sich, dass er die Nachfolge des zusammengebrochenen NS-Staates anzutreten, mithin das Erbe der NS-Zeit zu bewältigen sich genötigt sah, was zur Folge hatte, dass er in eine direkte Beziehung zum zur gleichen Zeit gegründeten Staat Israel trat. Denn im Blocksystem fand sich die BRD dem westlichen Lager des Kapitalismus einverleibt, dessen führende Macht, die USA, einen starken westdeutschen Staat gleichsam als Bastion gegen den aus dem Osten sich verbreitenden Sowjet-Kommunismus brauchte und entsprechend mit Vorbedacht aufbaute. Die sogenannte Rückführung der Deutschen in die Völkergemeinschaft war durch die (geo)politische Westintegration bedingt, mit pauschal verabreichter »Entnazifizierung« abgesegnet und – nicht minder bedeutend –mit einer »Wiedergutmachung« an den Juden sozusagen staatlich formalisiert. Dass dabei die (zumindest auf deutscher Seite) unter diesem Namen zwischen Israel und der BRD im Jahre 1952 unterzeichneten Abkommen auf eine Materialisierung der Sühne hinausliefen, wurde von beiden Seiten gewollt. So beschwerlich wirtschaftlich, war doch diese sofortige, mess- und begrenzbare Entschädigung für die verbrochene Monstrosität leichter zu bewerkstelligen als die ganz andere Ressourcen und langwierige, von Widerständen und Ambivalenzen durchsetzte, Prozesse erfordernde Bewältigung der Vergangenheit. Auf israelischer Seite hatte diese Materialität Priorität vor moralischen Erwägungen; es galt, den Ausbau der Infrastruktur des jungen Staates, der sich vor die Herausforderung massiver Einwanderungswellen gestellt sah, schnellstmöglich zu garantieren. Es handelte sich auf beiden Seiten um eine zweckrationale Interessenlage, die wenig mit einer realen Durchdringung des von Deutschen an Juden Verbrochenen zu tun hatte. Dafür mag es damals noch (ebenfalls auf beiden Seiten) zu früh gewesen sein. Was sich indes schon seit diesem interessengeleiteten Anbeginn herausbildete und schnell genug verfestigte, war die im Sinne besagter Interessen generierte Matrix der Beziehung zwischen beiden Staaten: Israel als nationaler Vertreter der Juden ging davon aus, dass sich die BRD – über die materiellen Leistungen der »Wiedergutmachung« hinaus – stets seinen Interessen, nicht zuletzt in Belangen des Nahostkonflikts, verpflichtet weiß, mithin ihnen auf keinen Fall dezidiert zuwiderhandelt. Die BRD ihrerseits unterwarf sich willens diesem moralischen ›Diktat‹, eignete sich das Postulat an, Israel als Vertretung der ›Juden‹ anzusehen, und tabuisierte die Kategorie ›Juden‹ als präsent-abwesenden Faktor ihrer sich allmählich formierenden politischen Kultur. Die Tabuisierung verlief als abstrakte Reglementierung, denn in der BRD der Nachkriegszeit lebten Juden als eine verschwindende Minderheit, die mit Deutschland kaum etwas im Sinne hatte, wie denn das bundesrepublikanische Deutschland kaum nennenswerte institutionelle Beziehungen zu ihr unterhielt.
Das bedarf der Erläuterung. Die in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg lebende jüdische Gemeinde setzte sich zum allergrößten Teil aus Familien von Shoah-Überlebenden osteuropäischer Provenienz zusammen, deren Anzahl bis 1990 kaum je die 35.000 überschritt. Bekannt war ihr Motto, sie säßen »auf gepackten Koffern«, welches sich späterhin bei den allermeisten von ihnen als Lebenslüge erweisen sollte und dennoch auch wahrhaftig war. Denn das Leben in Deutschland galt ihnen auf lange Sicht als unvorstellbar, offenbar auch von einem Schuldgefühl mitgetragen: Was hatten sie in dem Land verloren, von dem die Katastrophe ihres Volkes, mithin ihr eigenes familiengeschichtliches Unglück ausgegangen war? »Auf gepackten Koffern sitzen« indizierte etwas Temporäres, was damit einherging, dass man sich aller Handlungen, die auf Integration (also auf Bleiben) hinausliefen, enthielt. Selbst als sich nach und nach herausstellte, dass man blieb – man war geschäftlich involviert, man schickte die Kinder auf deutsche Schulen, man richtete sich wohnlich ein –, legte man die mentale Folie des Zwischenstationären nicht ab. In dieser Ambivalenz lag der Wahrheitskern des von ›Umständen‹ bestimmten Nichtgewollten , aber eben doch real Gelebten. Was indes strikt eingehalten wurde, war das Nicht-involviert-sein – man lebte mit und unter den Deutschen, hatte aber (zumindest, was die erste, also die Shoah-Generation anbelangte) nichts mit ihnen sozial zu schaffen. Das hatte einiges mit dem traditionellen osteuropäisch-diasporischen Nicht-auffallen-Wollen zu tun, war aber durchaus auch bewusste ideologische Haltung. Die zweite, großteils bereits in Deutschland geborene und aufgewachsene Generation war von dieser mentalen Haltung deutlich affiziert, obgleich das in ihren Alltagspraktiken weniger deutlich zutage trat; man ging eben auf deutsche Schulen, hatte deutsche Freunde, erlebte mit Deutschen die florierende neue Jugendkultur der 1960er Jahre. Das galt später auch für die aus dieser Generation hervorgegangenen jüdischen Intellektuellen, die sich in Deutschland einen Namen machten, sich jedoch bei aller politischen, kulturellen und wissenschaftlichen Involviertheit nie wirklich als Deutsche zu fühlen vermochten. Und selbst als Mitte der 1980er Jahre Ignatz Bubis, der damalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, mit dem Tabu brechenden Postulat hervortrat, jüdisches Gemeindeleben möge in Deutschland wieder erblühen, zeitigte er unter den in Deutschland lebenden Juden (denen seiner Generation zumal) keine allzu begeisterte Resonanz. Wie viele verstorbene Juden der ersten Generation, die nach dem Krieg in Deutschland gelebt haben, ist auch Bubis in Israel begraben.
Komplemetär dazu (und letztlich in gleichem Sinne) gestaltete sich der Zugang des deutschen Establishments und der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit zu den jüdischen Mitbürgern der Nachkriegszeit. Dies ist insofern nachvollziehbar, als die osteuropäischen Juden den Deutschen fremd vorkommen mussten: Sie hatten mit dem alten deutsch-jüdischen Bürgertum der Vorkriegszeit herzlich wenig gemein; sie waren in einer verschwindend kleinen Anzahl präsent; sie repräsentierten, ohne auffällig zu sein, das in der jüngsten Vergangenheit von Deutschen verbrochene große »schwarze Loch Auschwitz« – sie waren für die deutsche Nachkriegsbevölkerung das, was Freud als das Unheimliche apostropiert hatte. Aber sie waren es eben abstrakt. Gerade weil man die reale, materialisierte Beziehung zu den Juden an das ferne, unbekannte Israel deligierte und die unter den Deutschen lebenden Juden gleichsam unsichtbar waren, mutierten damals die Juden in Deutschland zu einem Abstraktum. Dieser Umstand war es, der die Grundlage für die spätere Entwicklung der Beziehung zwischen ›Deutschen‹ und ›Juden‹ bildete – eine die Juden ihres konkreten Daseins enthebende Beziehung, wie sie sich im großen Ganzen bis zum heutigen Tag erhalten hat.
Mit einer Einschränkung freilich. Denn was sich zunächst noch als ›Unbeholfenheit‹ der Deutschen angesichts der schweren Last der deutsch-jüdischen Geschichte im 20. Jahrhundert ausnehmen mochte, gerann nach und nach zur Ideologie. Psychisch, auch kollektiv-psychisch, kann man die damalige, von Schuldgefühlen und Scham, von narzisstischer Kränkung, Verdrängung und Tabuisierung geprägte Scheu vor der Berührung mit Juden nur zu gut verstehen. Dass diese Scheu dunklen Abgründen entstammte, diagnostizierten seinerzeit Margarete und Alexander Mitscherlich als »die Unfähigkeit [der Deutschen] zu trauern«. Es gab also ›gute Gründe‹, die ohnehin kaum präsenten, aus dem realen Leben der Deutschen verschwundenen Juden zu scheuen. Darum geht es aber im hier erörterten Zusammenhang nicht. Vielmehr ist zu beachten, wie dieser Mangel an realer Berührung sich allmählich in eine Ideologie der ›Unberührbarkeit‹ transformierte. Die Tabuisierung vollzog sich gleichsam als ein Akt des Realitätsersatzes: Was man nicht mehr kennen konnte, weil es nicht mehr da war, konnte mit Attributen besetzt werden, die beides ermöglichten – sowohl das Ausweichen vor der Auseinandersetzung mit dem Konkreten (als dem Unbekannten) als auch die psychisch-mentale ›Wiedergutmachung‹ am Abwesenden (als dem abstrakten Vergangenen). Ähnlich wie für orthodoxe Juden die Shoah-Ermordeten, ungeachtet dessen, was und wie sie im Leben gewesen waren, allesamt zu »Heiligen« (kedoschim) gerannen, verwandelten sich ›Juden‹ zur Projektionsfläche für allerlei deutsche Gesinnungen und Befindlichkeiten, wobei das Unberührbarkeitsgebot, mithin der tabuisiert-abstrakte Umgang mit ›Juden‹ zeitgeistgemäße Idealisierungen zeitigte, die aber vom ressentimentgeladenen Impuls her ehemaligen (durchaus auch fortwirkenden) antisemitischen Verteufelungen verschwistert waren.
Das Bedenkliche an dieser ideologisierten Tabuisierung sollte sich zunehmend darin erweisen, dass Juden für Deutsche durch die (mit der Tabuisierung einhergehende) Abstraktion der Juden nicht nur zu ›Opfer-Heiligen‹ (bzw. verteufelten ›Dämonen‹) avancierten, sondern dass die offizielle politisch-soziale Brandmarkung jeglicher antisemitischen Manifestationen sich selbst in eine Art ideologischer Kulthandlung verwandelte. Weil Deutsche an Juden Monströses verbrochen hatten, nahm sich alles, was an dies Monströse gemahnen mochte (dem »Wehret den Anfängen«-Postulat folgend) als eine Monstrosität aus, die es zu eliminieren galt. Das war auch insofern angebracht, als es sich um immer wieder zutage tretende Manifestationen eines gewissen, nie aus der deutschen Gesellschaft ganz verschwundenen Bodensatzes von Antisemitismus handelte. Ihre Desavouierung korrespondierte mit der seit den 1960er Jahren sich gesteigert vollziehenden »Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit«, die in Deutschland in der Tat rigoroser betrieben wurde als bei anderen europäischen Nationen (wobei es freilich in Deutschland einiges mehr als andernorts aufzuarbeiten gab). Was indes als positiver kritisch-emanzipativer Impuls begann, verselbständigte sich bald genug unter den beschriebenen deutsch-jüdischen Verhältnissen und verkam zu einem Ideologem, bei dem das, was als antisemitisch apostrophiert wurde, nach und nach einer gewissen unbeschwerten bzw. gerade ideologisch beschwerten Beliebigkeit unterworfen wurde. Denn zwar lebten in der frühen Nachkriegszeit noch genügend ehemalige Nazis in der BRD, von denen angenommen werden durfte, dass sie sich von der Grundmatrix ihrer ressentiment- oder gar hassbesetzten Ausrichtung auf ›Juden‹ kaum befreit hatten, aber sie entbehrten im großen Ganzen (gemessen an den etablierten Parteien Deutschlands) einer realen politischen Wirkmächtigkeit. Selbst als Neonazis in den 1960er Jahren sich im Rahmen der NPD formierten, nahm man zwar bestürzt zur Kenntnis, dass sich Nazis in Deutschland überhaupt wieder hervorwagten, aber man ging zurecht davon aus, dass sie keine reale politische Gefahr bildeten. Dieses Grundverhältnis änderte sich späterhin nicht wesentlich – was sich aber veränderte, war die zunehmende Hypostasierung der Gefahr, die sich früher oder später zum polemischen Schlagwort verdinglichen sollte.
Dies bedarf wiederum der Erörterung, die hier an der Kategorie des Antisemitismus vorgenommen sei. Der Begriff des Antisemitismus bezeichnet eine gegen Juden als Juden gerichtete Gesinnung bzw. performative Haltung. Es handelt sich um einen relativ spät, erst am Ende des 19. Jahrhunderts aufgekommenen Begriff, der als solcher eine Abgrenzung gegenüber dem traditionellen, religiös begründeten Judenhass markierte. Der Antisemitismus mochte sich des religiösen Ressentiments gegen Juden bedienen, war (und ist) aber im wesentlichen säkularen Charakters, was nicht zuletzt darin begründet ist, dass er sich parallel zu Emanzipationsbestrebungen der Juden innerhalb der sich im 19. Jahrhundert entfaltenden bürgerlichen Gesellschaft Europas herausbildete. Gerade die Loslösung der Juden von ihren alten Ghetto-Lebenswelten rief aversive Reaktionen in ihren Residenzgesellschaften hervor: weil sie nach liberal-bürgerlichem Verständnis formal zwar dazugehörten, aber fremd anmuteten; weil sie eine Minorität darstellten, aber – alte historische Defizite kompensierend – besonders strebsam waren und sich entsprechend in vielen Bereichen des wirtschaftlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Lebens hervortaten, mithin gerade deshalb negativ auffielen; und weil sie zudem als assertive Konkurrenz eine im Innern wirkende ›von außen‹ kommende Bedrohung darstellten. Man lese Richard Wagners Darstellung von Felix Mendelssohn Bartholdy in Das Judentum in der Musik, um zu begreifen, welcher Neid bei dieser Wahrnehmung erfolgreicher assimilierter Juden mit im Spiel war. Von selbst versteht sich, dass das antijüdische Ressentiment sich besonders eignete, um die objektiven sozialen Widersprüche und ökonomischen Diskrepanzen innerhalb der sich formierenden bürgerlichen Gesellschaft ideologisch zu verbrämen und den von diesen herrührenden möglichen Volkszorn mittels bewusst geschürter Sündenbock-Affekte zu kanalisieren. Dieses politischen Instruments bedienten sich Machthaber bereits in vormodernen Zeiten, aber erst in der Moderne war die säkulare ›Handhabe‹ dafür gleichsam strukturell angelegt.
Hinzu kam in der Moderne eine Komponente auf, die dem Antisemitismus eine neue, determinierende Dimension gab. Denn während der religiös begründete Judenhass der Vormoderne und der den Sozialneid funktionalisierende Antisemitismus der bürgerlichen Gesellschaft die grundsätzliche Möglichkeit der Reversibilität (sei es durch Konversion, sei es durch assimilierende Akkulturation) aufwies, betrat der Antisemitismus in der Phase seiner rassistischen Begründung den historischen Pfad der pseudobiologisch fundierten Unumkehrbarkeit. Der rassenantisemitische Wahn der Nazis war insofern hermetisch verfestigt, als er ›den Juden‹ nicht mehr als historisch transformierbare Figur begriff, sondern als Exponenten einer im Wesen unentrinnbaren minderwertigen Rasse. Das Eliminatorische dieses Antisemitismus stellte eine neue Dimension des Judenhasses dar, da es ihm nicht mehr ›nur‹ um Beschämung, Ausgrenzung, Verfolgung und Vertreibung eines ethnisch geprägten Kulturellen ging, sondern (spätestens seit dem Beschluß der »Endlösung«) um die physische Vernichtung des Juden, um seine Ausmerzung aus der Welt. Für den hier erörten Zusammenhang ist dabei von besonderer Bedeutung, dass durch das welthistorisch bedeutsame Geschehen von Auschwitz die radikalste Form der Verfolgung, die industriell betriebene Massenvernichtung der Juden, nicht nur alle anderen (moderateren) Formen der antisemitischen Verfolgungspraxis überschattete, sondern nachgerade zum Kriterium ihrer Bewertung avancierte, zum Maßstab der Wahrnehmung jeglicher antisemtischer Erscheinung.
Das mochte zum einen insofern seine volle Berechtigung haben, als man früher oder später begann, Auschwitz auch in Kategorien seiner Vorgeschichte zu ergründen. Das entsetzte »Wie konnte es dazu kommen?« zwang in der Tat die Erörterung dessen auf, was zur Katastrophe geführt hatte. Die finalistische Sicht des Gesamtphänomens des eliminatorischen Antisemitismus ergab sich dabei zwangsläufig aus der Not, etwas ergründen zu wollen, wofür die Mittel der rationalen Ergründung nicht zur Verfügung standen. Die historischen Stationen auf dem Weg nach Auschwitz gaben keinen zwingenden Aufschluss über das Ende dieses Weges – die Vernichtungstat: 1933 (Hitlers Machtübernahme) rückt im nachhinein Auschwitz als geschichtliche Möglichkeit näher, ist aber noch nicht Auschwitz; 1935 (die Nürnberger Rassegesetze) rückt Auschwitz noch näher, ist aber auch noch bei Weitem nicht Auschwitz; 1938 (Reichspogromnacht, mithin die im Deutschland der Moderne eher ungewöhnliche physische Gewaltanwendung gegen Juden) rückt Auschwitz noch sehr viel näher, und doch ist die reale Möglichkeit von Auschwitz noch nicht in Sicht, selbst unter den radikalsten Nazis nicht. Es musste Auschwitz erst in die Welt kommen, damit es für Menschen überhaupt denkbar wurde, mithin eine ›Vorgeschichte‹ erfordern und bekommen konnte. Aber gab es auch eine prästabilisierte Zwangsläufigkeit der Entwicklung auf Auschwitz zu? Hätte die Shoah der Juden sich ereignet, wenn Hitler noch in den 1930er Jahren bei einem Attentat ums Leben gekommen wäre? Es lässt sich begründen, warum es wohl in diesem Fall dennoch zum Weltkrieg gekommen wäre. Aber auch zum Holocaust? Und doch war das schiere Ereignis von Auschwitz so monströs im welthistorischen Maßstab, dass es das ihm Vorangehende in den Schatten stellte, zugleich aber eben als ›Vorgeschichte‹ auch einschloss.
So ist auch Adornos Diktum aus dem Jahr 1966 zu verstehen:
»Man spricht vom drohenden Rückfall in die Barbarei. Aber er droht nicht, sondern Auschwitz war er; Barbarei besteht fort, solange die Bedingungen, die jenen Rückfall zeitigten, wesentlich fortdauern. Das ist das ganze Grauen Der gesellschaftliche Druck lastet weiter, trotz aller Unsichtbarkeit der Not heute. Er treibt die Menschen zu dem Unsäglichen, das in Auschwitz nach weltgeschichtlichem Maß kulminierte.« (Adorno 1969, 85)
Auschwitz war der Rückfall in die Barbarei; wir leben also in einer Welt, in der Auschwitz (Rückfall in die Barbarei) möglich geworden ist. Die Bedingungen für die Verwirklichung einer solchen Möglichkeit liegen im Gesellschaftlichen bzw. im »gesellschaftlichen Druck«. Der gesellschaftliche Druck indiziert eine Tendenz, die im Auschwitz-Unsäglichen kulminieren könnte. Auschwitz ist also das Kriterium für die reale Möglichkeit eines geschichtlichen Zustandekommens des Unsäglichen, mithin permanent mahnendes Warnsignal vor der Tendenz der Gesellschaft. Und darum geht es Adorno letztlich: Wie ließe sich eine Gesellschaft denken, in der Auschwitz nicht mehr möglich wäre? Wie immer die Antwort darauf ausfallen mag, sie müsste eine wesentliche Umgestaltung der Gesellschaft zum Inhalt haben. Zwar bezieht sich der berühmte neue kategorische Imperativ (das »Denken und Handeln [der Menschen] so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe«) auf die Menschen »im Stande ihrer Unfreiheit«, also in einer Gesellschaft, in der die potenzielle Verwirklichung einer auf Auschwitz hinauslaufendenTendenz noch immer real möglich ist, aber das kann nur als »Zwischenlösung« gelten, die als solche die prinzipielle Möglichkeit eines Rückfalls in die Barbarei mitnichten überwunden hat. So stellt sich denn die Frage, was es mit dieser »Zwischenlösung« auf sich habe. Was gibt sie praktisch an? Wie soll man das Postulat des neuen kategorischen Imperativs befolgen?
Eine (in Adornos Sinne liegende) Möglichkeit begreift Auschwitz als zivilisatorisches Paradigma bzw. als Paradigma einer zivilisatorischen Gesamttendenz, welches den unablässigen Kampf um eine Gesellschaft, in welcher der potenzielle Rückfall in die Barbarei unmöglich geworden sein wird, zum Ziel seiner Ausrichtung erhöbe. Ein solcher Kampf verstünde sich wesentlich als sozialer, ökonomischer und politischer Kampf, der die radikal-emanzipatorische Umstrukturierung der Gesellschaft anstrebt. Das eigentliche Andenken an die Opfer des Holocaust bestünde, so besehen, in der Errichtung einer Gesellschaft, die keine Opfer mehr produziert, einer Gesellschaft, in welcher die Freiheit des Menschen das historische Veto gegen Auschwitz als Zivilisationsparadigma vollbracht hätte. Der abschließende Absatz von Ernst Blochs Das Prinzip Hoffnung fasst dieses Grundpostulat der Emanzipation in prägnanter Dichte zusammen:
»Der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte, ja alles und jedes steht noch vor Erschaffung der Welt, als einer rechten. Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende, und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, das heißt sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfasst und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat.« (Bloch 1973, 1628) Die andere Möglichkeit nimmt jenen Teil in Adornos Postulat ernst, der von den Menschen »im Stande ihrer Unfreiheit« spricht, also vom menschlichen Dasein in einer Gesellschaft, die sich noch nicht »an der Wurzel« gefasst hat. Diese Möglichkeit bezieht sich auf die notwendige Praxis angesichts der Tatsache, dass man in einer Welt ›nach Auschwitz‹ lebt, daraus aber nicht die emanzipatorische Konsequenz zu ziehen vermochte, nicht zuletzt weil die sozialen Strukturen, die repressive Entäußerung und Entfremdung zeitigen, geschichtlich noch nicht überwunden sind. Das Grundpostulat dieser Praxis zielt nicht nur auf die Verhinderung der Wiederholung von Auschwitz (und allem, was ihm ähnelt), sondern auch auf die Handhabung dessen, was man für den zentralen Faktor bei der Genese von Auschwitz erachtet: den Antisemitismus. Das ist ohne Zweifel eine nachvollziehbare, überaus honorige Schlussfolgerung: Wenn man der Opfer im Stande ihres Opferseins gedenken und das Gedenken selbst in eine politische Praxis umsetzen möchte, dann muss zumindest die Ideologie, welche die Opfer zu Opfern hat werden lassen, eben der Antisemitismus, in aller Rigorosität bekämpft werden. Dass dabei der Antisemitismus (neben Rassismus oder Fremdenhass etwa) nur eine der Formen repressiver gesellschaftlicher Praxis darstellt, muss nicht vom Bezug auf seine Spezifität ablenken: Zwar muss Rassismus und Xenophobie mit gleicher Verve bekämpft werden wie Antisemitismus, aber in der Bekämpfung des Antisemitismus, der durch Auschwitz zum Paradigma in welthistorischem Maßstab geronnen ist, werden unweigerlich Rassismus, Fremdenhass und jegliche Form der Verfolgung von Minderheiten mitbekämpft. Man kann nicht den Antisemitismus bekämpfen wollen und Rassist bleiben; man kann nicht Fremde ausgrenzen oder sonstwie verfolgen wollen, dabei aber in Anspruch nehmen, Antisemitismus zu bekämpfen. Wer dennoch meint, dies praktizieren zu können, muss sich Rechenschaft darüber ablegen, von welchem ideologisierten Ressentiment er bei seinen repressiven Praktiken, nicht minder aber auch bei seiner vermeintlich emanzipativen Bekämpfung des Antisemitismus, angetrieben wird.
Vor der Erörterung dieses spezifischen Aspekts sei jedoch auf den Zusammenhang von Erscheinungen des Antisemitismus und ihrer Bekämpfung (bzw. Handhabung) verwiesen. Denn dass Auschwitz den Umgang mit dem Antisemitismus nach 1945 wesentlich geprägt hat, wirft unweigerlich die Frage auf, wie auf ihn zu reagieren sei, wenn er in unterschiedlichen Kontexten zum Vorschein kommt. Um die Bedeutung des adäquaten Reagierens hervorzuheben, mag in Erinnerung gerufen werden, was Adorno über die Benennung der Shoah (bevor dieser Begriff sich ›einbürgerte‹) geschrieben hat: Klar war, dass ein Ausdruck für die Katastrophe gefunden werden musste, wofür man denn den englischen Begriff »genocide« (Völkermord) prägte. Aber diese Kodifizierung stellte, Adorno zufolge, ein Problem für sich dar, weil man mit dieser Namensgebung »das Unsagbare kommensurabel« gemacht hatte. Durch die Erhebung zum Begriff »ist die Möglichkeit gleichsam anerkannt: eine Institution, die man verbietet, ablehnt, diskutiert. Eines Tages mögen vorm Forum der United Nations Verhandlungen darüber stattfinden, ob irgendeine neuartige Untat unter die Definition des genocide fällt«. Man wird Adorno dabei keine Weltfremdheit vorwerfen wollen – er ist sich der Notwendigkeit der Benennung und des Begriffs völlig bewusst, und doch indiziert er auch die der Namensgebung innewohnende Gefahr der degradierenden Normalisierung dessen, was anormal, abartig zu bleiben hätte. Das selbstverständliche Reden über Völkermord, d.h. die durch die Redepraxis generierte Hinnahme dessen, was nicht hingenommen werden darf bzw. schockieren müsste, weil es notwendig anerkannt wird – anders gesprochen: die durch die schiere Benennung sich generierende Akzeptanz, dass man in einer Welt lebt, in der es ein Auschwitz geben konnte –, indiziert nicht nur, dass man Inkommensurables begrifflich zugänglich macht, sondern auch dass man durch die Kommensurabilisierung des Inkommensurablen wahrnehmungsmäßig abstumpft, sich übers Bedrohliche quasi ›beruhigt‹, mithin das geschichtlich Monströse trivialisierender Banalisierung anheimgibt.
Und so erhebt sich die Frage, wie man mit der Alltagserscheinung des Antisemitismus umgeht. Wenn man Juden pauschal der Geldgierigkeit bezichtigt, hat man sich schon des Antisemitismus schuldig gemacht? Die Frage muss bejaht werden, weil man damit ›die Juden‹ zur abstrakten Kategorie werden lässt, um sie mit einem pejorativen Attribut zu behaften. Ist damit aber auch schon eine Verfolgungsabsicht indiziert, die auf Vertreibung oder gar auf Eliminierung von ›Juden‹ (im Sinne der Auschwitz-Präzedenz) hinausläuft, angezeigt? Die Frage muss verneint werden, denn weder ist in dieser partikularen Äußerung diese Option als einzig mögliche angelegt, noch enthält sie eine konkrete Handlungsanweisung. Man trivialisiert die historische Katastrophe nachgerade, wenn man daraus schon das neue Auschwitz extrapoliert. Selbst wenn man »Wehret den Anfängen« postuliert, muss man sich darüber klar werden, wann man von »Anfängen« im Sinne von historisch realen Möglichkeiten sprechen darf. Allzu automatisch und häufig praktizierte Unkenrufe können sich als Verrat an dem erweisen, wovor sie zu warnen vorgeben, weil ihre unselektive Verwendung die nötige Wachsamkeit des Adressaten der Warnung früher oder später abflauen lässt. Wie verhält es sich mit der Behauptung: »Manche Juden sind geldgierig« – ist sie antisemitisch? Die Antwort darauf ist nicht eindeutig. Denn ohne Zweifel sind manche Juden (wie Angehörige anderer Menschengruppen auch) geldgierig. Wenn man sich also nur auf diese simple Feststellung beschränkt, kann sie nicht schon als antisemitisch gewertet werden – wobei man sich die Frage stellen mag, in welcher Absicht sind gerade die Juden in dieser Aussage mit dem Attribut der Geldgierigkeit in Zusammenhang gebracht worden. Es mag sich herausstellen, dass die kreierte Konstellation von der Absicht angetrieben war, Juden mit Geldgierigkeit assoziieren zu lassen. Von selbst versteht sich, dass diese in ihrer Absicht latent antisemitische Aussage von keinem ernstzunehmenden praktischen Belang für Juden ist. Es ließen sich viele Variationen solcher Testfälle für den Antisemitismus auflisten, aber sie würden alle darauf hinauslaufen, dass sie für Juden zwar verletzend sein können (oder auch nicht – denn welcher Jude würde sich ernsthaft vom Gegeifer eines Neonazis, den er für Abschaum hält, beleidigen lassen), aber nicht wirklich bedrohlich. Als Jörg Haider seinerzeit an merklicher politischer Macht gewann, mahnte man in Israel die in Österreich lebenden Juden an, dass es an der Zeit sei, die Koffer zu packen und nach Israel überzusiedeln. Soweit bekannt, blieben die österreichischen Juden von dieser Mahnung weitgehend unbeeindruckt.
Man kann das generalisieren: Selbst einzelne physische Angriffe auf Juden können nicht a priori zum Kriterium eines allgemein grassierenden, Juden als Kollektiv in ihrer Existenz bedrohenden Antisemitismus erhoben werden. Es ist nicht einfach, ein solches allgemein gültiges Kriterium aufzustellen. Aber eines lässt sich zumindest negativ bestimmen: Es gibt Antisemiten, die Pauschalisierendes über Juden zu verbreiten vermögen, dabei aber persönlichen Umgang mit Juden pflegen. Es gibt Antisemiten, die dem Juden nicht ins Gesicht sagen würden, was sie hinter seinem Rücken sehr wohl äußern. Es gibt in Deutschland und Österreich Antisemiten, die – in geschlossenen minoritären Gruppen formiert (Neonazis etwa) – Parolen grölen, die sie sich als Einzelpersonen in der Öffentlichkeit nie und nimmer von sich zu geben getrauen würden. Es gibt Antisemiten, die sich ihres Ressentiments Juden gegenüber gar nicht bewusst sind und in Abrede stellen würden, Antisemiten zu sein. Kurzum, es gibt allerlei so gearteter antisemitischer Erscheinungsformen, die aber alle eines gemeinsam haben: Sie stellen keine umgreifende Bedrohung für Juden dar, weder was soziale Ausgrenzung noch was politische Verfolgung und erst recht nicht, was die kollektive physische Existenz von Juden anbelangt. Dass das heute zumeist nicht in dieser realitätsadäquaten Weise wahrgenommen wird, hat zum einen mit dem großen, immerfort nachwirkenden Schatten von Auschwitz zu tun, zum anderen aber mit dem, was es nun ausführlicher im deutschen Kontext zu erörtern gilt.
Denn gerade die oben angesprochene Tabuisierung von Juden in Deutschland hat dazu geführt, dass das Verhältnis zu ihnen bzw. zum Antisemitismus von Grund auf ideologisiert wurde. Das erweist sich nicht nur daran, dass das Reden über Juden per se für viele Deutsche mit einem Grundgefühl der Beklommenheit einhergeht (die Juden sind ja, wie gesagt, kaum im deutschen Alltag präsent, sind also »unheimlich«), sondern vor allem daran, wie man im Hinblick auf den Antisemitismus aus jeder Mücke einen Elefanten macht. Das hängt damit zusammen, dass es zwischen Israel (als Staat der Juden) und Deutschland (als Nachfolgestaat der Täter) von Anbeginn eine stille Übereinkunft gegeben hat, namentlich, dass Israel stets Alarm schlägt, wo es Antisemitismus gewahrt, und Deutschland sich entsprechend immer alarmieren lässt. Was allerdings auf beiden Seiten auffällt, ist, dass die vermeintliche Bekämpfung des Antisemitismus durchweg instrumentalisiert wird: Israel braucht den Antisemitismus, um sich der Kritik gegen Israel zu erwehren, und Deutschland braucht Israel als jüdisch-institutionalisierte Moralinstanz der Anerkennung seiner vollends bewältigten Vergangenheit. Die instrumentalisierende Dimension dieser Verbandelung zeigt sich primär daran, dass es beiden Seiten nicht wirklich um den Antisemitismus und seine reale Bekämpfung geht, sondern um die Aufrechterhaltung der interessegeleiteten Verbandelung. Auf israelischer Seite liegt das Interesse hierfür klar auf der Hand (davon gleich mehr). Bezeichnend ist aber, wie sich die Verfolgung des Interesses auf deutscher Seite strukturell generiert hat: Eine eigentümlich zusammenwirkende Melange aus der offiziellen Israel-Politik Deutschlands, der sich in Bezug auf Israel und Juden selbst Grenzen setzenden medialen Welt (in welcher die Springer-Presse immer schon als wirkmächtiger Vorreiter fungierte), einer vom Antisemitismus-Tabu gebeutelten ›deutschen Öffentlichkeit‹ und der besonders abstrusen, von sogenannten ›Antideutschen‹ politisch praktizierten Ideologie hat dazu geführt, dass Juden, Zionismus und Israel jene einleitend thematisierte Gleichsetzung erfahren haben, aus der sich die Identifizierung von Antisemitismus, Antizionismus und Israel-Kritik ableitete, welche somit den ›Antisemitismus‹ zum schrittmachenden Schlagwort des deutschen öffentlichen Diskurses hat verkommen lassen.
Was Adorno noch in seiner Reflexion über die Benennung des Unsäglichen hat zögern lassen, ist in Deutschland inzwischen in einen solch inflationären Gebrauch gemündet, dass der Begriff des Antisemitismus mittlerweile als ausgehöhlt gelten darf. Denn wenn die Folie Auschwitz den Blick für den Stellenwert des allerkleinsten antisemitischen Vorfalls im Alltag zu trüben vermag, dann wird nicht nur das kleine Vorkommnis in grotesker Weise aufgebläht, sondern die Kategorie Auschwitz als Maßstab fürs weltgeschichtlich Katastrophische und als Grundtendenz der Zivilisation (wie sie Adorno noch verstanden wissen wollte) wird vollends entleert – wenn alles und jedes durch die Brille ›Auschwitz‹ angesehen wird, dann wird ›alles und jedes‹ als das unzulässig ins Monströse Gesteigerte ebenso irrelevant wie ›Auschwitz‹. Es handelt sich dabei um einen Vorgang, der in der Absicht, Gleichgültigkeit und Abstumpfung zu bekämpfen, eine in Indifferenz übergehende Bedeutungslosigkeit stetig befördert. Wie lässt sich dies erklären? Es kann ja nicht in Abrede gestellt werden, dass der ursprüngliche Impuls zur Bekämpfung des Antisemitismus einer anerkennenswerten emanzipativen Intention entstammt. Die Antwort darauf ist nicht einfach, man kann allerdings davon ausgehen, dass der emanzipative Impuls, sich verselbständigend, ideologisch verdinglicht worden ist, mithin den unmittelbaren Bezug zu dem, was seine historische Motivation im Ursprung angetrieben hatte, verloren hat. Es ist nicht ganz auszumachen, wie es dazu gekommen ist, denn das, was es zu bewältigen galt, war eindeutig, und selbst der neue kategorische Imperativ Adornos war in seiner (wie immer generellen) Handlungsforderung einigermaßen klar. Denn wenn es darum ging, dass »Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts Ähnliches geschehe«, dann betraf dies nicht jene Alltagsnichtigkeiten, die den gängigen Umgang zwischen dem ›normalen Antisemiten‹ und den ›normalen Juden‹ ausmachen. Weder hat jener ein neues Auschwitz im Sinn, noch fühlt sich dieser von der Möglichkeit eines neuen Auschwitz in der deutschen Zivilgesellschaft bedroht. Und doch übersetzte sich das große Postulat zunehmend in eine eklatant anmutende Fetischisierung des antisemitischen Phänomens, welche nun ihrerseits ideologische Handlungspraktiken zeitigte, die den ursprünglichen emanzipativen Impuls aufs Gröbste verraten.
Der Eingang individueller Befindlichkeiten in die Motivationsstruktur des politischen Akts bildete offenbar einen zentralen Faktor bei dieser Transformation. Zwar ist das bei jeder politischen Praxis nichts Außergewöhnliches, Affekte und Gefühlsregungen gehören stets dazu. Aber im Fall der Bekämpfung des Antisemitismus im deutschen Raum war die Befindlichkeitsmatrix sehr bald auch ideologisch mitgeprägt, und zwar in einer Weise, dass der Gegenstand des Kampfes zunehmend aus dem Blickfeld der politisch Agierenden geriet und heteronomen Projektionsbedürfnissen Raum machte. Gravierend war dabei die fremdbestimmte Identifizierung mit Juden, wiewohl sie im Hinblick auf die historische Genese des zu Bewältigenden nachvollziehbar war: Weil Juden durch Deutsche Monströses widerfahren war, wurden ›Juden‹ zu Objekten deutscher ›Wiedergutmachungs‹-Bestrebungen. Da nun aber die realen Juden aus Deutschland verschwunden waren (und die wenigen in der alten BRD lebenden den Deutschen gemeinhin fremd bleiben mussten), abstrahierte man die Juden zu ›Juden‹ und delegierte die Identifikation und Solidarität mit ihnen aufs Abstraktum ›Juden‹ und auf das, was ›die Juden‹ nach 1945 als real fassbares Kollektiv konkretisierte: Israel. Der 1948 errichtete jüdische Nationalstaat war nicht nur ein Glücksfall für die staatsoffizielle Materialisierung der Sühne seitens der Westdeutschen in Form der ›Wiedergutmachungs‹-Leistungen ab 1952, sondern er diente auch als Ersatz für den unmöglich gewordenen Umgang mit den aus der deutschen Realität verschwundenen Juden: Israel wurde zur Projektionsfläche der mit realen Juden in Deutschland nicht mehr zu bewerkstelligenden ›Solidarität mit Juden‹. Dabei geriet alles durcheinander: Die gemordeten Shoah-Opfer und die Überlebenden verwandelten sich allesamt in ›Juden‹, die wiederum mit dem gleichgesetzt wurden, was sie kollektiv greifbar machte – Israel –, welches seinerseits zum einen als ›Kompensation‹ für Auschwitz begriffen werden konnte, zum anderen aber auch eine benennbare moralische Grundlage für seine Gründung – den Zionismus – anbot. Was sich aber an Aktion Sühnezeichen etwa in den 1960er Jahren noch als erste vorsichtige Annährung von Deutschen an Juden in der Nachkriegszeit ausnehmen mochte, gerann späterhin zur groben ideologischen Solidaritätsbekundung, die sehr viel mit Bedürfnissen von Deutschen, herzlich wenig aber mit Israels Realität und noch weniger mit realen Juden zu tun hatte. Denn was mitabstrahiert wurde, war das reale Israel und seine historische Genese – ein fataler Umstand, der sich an der befindlichkeitsgesteuerten, daher ideologisierten Wahrnehmung Israels durch viele Deutsche festmachen sollte.
Der Staat Israel wurde nicht im geschichtslosen Raum gegründet, sondern er wählte sich schon in seiner zionistischen Vorgeschichte ganz bewusst das Territorium zu seiner Errichtung aus, welches es ihm ermöglichte, geschichtliche Kontinuität durch Anknüpfung an biblische Zeiten vorzugeben. Da aber dieses Territorium, trotz aller nachhaltigen ideologischen Bekundungen des Zionismus, mitnichten unbevölkert war, als man es zu kolonisieren begann, zeitigte das, was sich als Schuldabtragung ›der Welt‹ gegenüber dem jüdischen Volk ausnehmen mochte, ein großes, an den Palästinensern begangenes historisches Unrecht, mithin den bis heute währenden Nahostkonflikt. Man muss nicht mit dem moralisierend pathosgeschwängerten Spruch, dass die (jüdischen) Opfer zu Tätern geworden seien, aufwarten, um dennoch die Tragik der Konstellation zu erkennen (und anzuerkennen), dass die Notwendigkeit, nach der Shoah einen Staat für die Juden zu errichten, mit der Katastrophe des palästinensischen Volkes bezahlt wurde. Wer dies bewusst ignoriert oder vorbewusst verkennt, mag sich mit dem guten Gefühl herumtragen, seiner (schuldbeladenen) Verantwortung ›den Juden‹ gegenüber Genüge zu tun, darf indes nicht beanspruchen, die Logik des blutigen Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern angemessen begriffen, geschweige denn beurteilt zu haben.
Dies gilt umso nachhaltiger seit 1967. Denn nicht nur betreibt Israel seit weit über vierzig Jahren ein gewalt- und repressionsdurchwirktes Okkupationsregime in den von ihm im 1967er Krieg eroberten Gebieten, allen voran im Westjordanland, sondern das von ihm in diesen Territorien über Jahrzehnte errichtete Siedlungswerk, das mittlerweile zu einer Art Staat im Staat herangewachsen ist, treibt Israel in eine Sackgasse, die es ihm weder ermöglicht, eine emanzipative Friedenpolitik im Sinne der Zwei-Staaten-Lösung zu betreiben, noch in perspektivloser Stagnation zu verharren, wenn es nicht den binationalen Staat, der das Ende des Zionismus zur Folge haben müsste, objektiv befördern möchte. Israel fügt also nicht nur den Palästinensern unermessliches Leid zu, sondern es erstickt mittlerweile an der eigenen Politik, weiß mithin selbst nicht mehr, wie es mit den selbsterzeugten Zuständen umgehen soll. Wer Israels Politik heutzutage kritisiert, darf sich also nicht nur als Parteigänger der unterdrückten Palästinenser begreifen, sondern sich nicht minder auch als besorgter Sachwalter wirklicher israelischer Interessen fühlen. Schon lange treibt nicht wenige Bürger Israels die Ahnung um, dass Israel vor sich selbst gerettet werden müsse, wenn es historisch überdauern soll.
Die hohe israelische Politik und die von ihr mitbestimmte öffentliche Debattenkultur des Landes wollen davon für gewöhnlich freilich nichts wissen. Kritik an Israels Politik, auch dort, wo sie sich gegen offensichtliches Unrecht und eklatante Völkerrechtsverletzungen richtet, werden immer schon, besonders aber in den letzten Jahren rechter Regierungskoalitionen, als Antisemitismus abgeschmettert. Das Ideologische dieser Reaktion erweist sich an den unhaltbaren Verknüpfungen, die dabei gemacht werden: Der sich aus dem Nahostkonflikt speisende Antizionismus arabischer Länder wird auch denen, die Israels Politik kritisieren (und sich somit wie von selbst auf die palästinensische Seite schlagen), automatisch zugeschrieben, vor allem, wenn die israelkritischen Stimmen aus Europa kommen. Denn Europa als Kontinent der Shoah kodiert sich vielen Israelis immer noch als antisemitisch. Was also den Arabern/Palästinensern als Resultat des politischen Territorialkonflikts mit Israel zugeschrieben wird – nämlich Antizionismus –, wird im Zusammenhang mit Europäern von vornherein als tendenziell antisemitisch eingestuft. Antizionismus und Antisemitismus gerinnen somit vielen Israelis und nichtisraelischen Juden zu einem Einheitsbrei, den sie nun instrumentalisieren, um die in der Sache berechtigte Kritik an Israels Politik abzuwehren, wobei der Vorwurf des Antisemitismus zumeist wenig mit dem realen Antisemitismus zu tun hat.
Wie schon eingangs dargelegt, ist es müßig, nachzuweisen, dass Antizionisten (mitunter auch Israelkritiker) zwar von Antisemitismus angetrieben sein können, Antisemitismus, Antizionismus und Kritik an Israel jedoch strikt voneinander zu unterscheiden sind, wenn man nicht in die Falle hineintappen möchte, den Antisemitismus-Vorwurf heteronom zu funktionalisieren. Antizionistisch eingestellte Juden sind nicht ihrer Gesinnung wegen schon antisemitisch; ausgepichte Antisemiten können sich ohne Weiteres als prozionistische Israelfreunde erweisen; Israelkritiker – jüdisch oder nicht – dürfen den Anspruch erheben, nach dem Sachgehalt ihrer Kritik und nicht anhand fremdbestimmter Zuschreibungen beurteilt zu werden. Müßig ist es aber deshalb, dies Selbstverständliche immer wieder hervorzuheben, weil der Antisemitismus-Vorwurf längst schon zur ideologischen Waffe verkommen ist, mit der jegliche Kritik an Israel entschärft werden soll, wenn sie ans Eingemachte geht: an die nicht mehr von der Gesamtausrichtung des zionistischen Staates zu trennende Politik, welche nicht nur das an den Palästinensern begangene historische Unrecht perpetuiert, sondern den zionistischen Staat selbst in den historischen Abgrund treibt. Mit dem Antisemitismus argumentierende Israelapologeten verkennen dabei vollends, dass sie einer Politik das Wort reden, die deshalb als antizionistisch zu werten ist, weil sie den geschichtlichen Fortbestand des zionistischen Staates, mithin des gesamten zionistischen Projekts im Innersten infrage stellt.
Wie hier eingehend dargelegt, sehen sich Deutsche in diesem Zusammenhang dem spezifischen Problem ausgesetzt, dass sich ihre Israel-Wahrnehmung von vornherein neuralgisch einfärbt. Weil sie objektiv mit der Bürde einer historischen Last behaftet sind, erweist sich ihr Zugang zu Israel zumeist als projektiv: Da Deutsche an den Juden schuldig geworden sind, ist der Umgang mit ›den Juden‹ dahingehend tabuisierend fetischisiert, dass man ›den Juden‹ als Nachkommen der Opfer und ›ihrem Land‹ a priori als ›Land der Opfer‹ zu begegnen hat. Dies hat viel mit der Befindlichkeit der Projizierenden, wenig aber mit realen Juden, geschweige denn mit dem realen Israel zu tun. Und so schließt sich ein Teufelskreis: Weil Juden, Zionisten und Israel als identisch kodiert werden, werden auch Antisemitismus, Antizionismus und Israelkritik gleichgesetzt. Die gehorsame Befolgung dieser Koordinatenmatrix geht stets mit eigenbefindlichem Realitätsverlust einher. Jeglicher Versuch, sich dieser automatischen Befolgung zu widersetzen, sieht sich indes der Drohung des fremdbestimmten Antisemitismus-Vorwurfs ausgesetzt. Es gehört im heutigen Deutschland einiger Mut dazu, das reale Israel als das Land der Okkupationspolitik wahrzunehmen. Somit gehört auch nicht minderer Mut dazu, das zionistische Land vor sich selbst retten zu wollen. Dabei gilt es freilich zu bedenken, dass viele scheinbare Nonkonformisten, die ansonsten keinerlei humanistische Impulse verspüren, besonders gerne auf Israel als Okkupationsstaat einhacken. Sie spielen sich dabei gerne als ›Mutige‹ auf, die einem Schweigekartell der offiziellen Presse gegenübertreten müssen. »Man darf ja Israel nicht kritisieren«, lautet stets die Aussage dieser von eigenartigen, aber sicher nicht von humanistischen oder gar linken Motiven Angetriebenen.
Vor diesem Hintergrund sei hier nochmals resümierend die (psychologische) Logik des oben erörterten, auf den Beziehungen zwischen Deutschen und Juden (bzw. Israel) lastenden Tabus in einem weiteren Zusammenhang anvisiert. Die tiefere Wahrheit des vom israelischen Psychoanalytiker Zvi Rex einst (wohl halbironisch) geäußerten Diktums, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen, liegt darin, dass der kollektive Narzissmus von Deutschen durch die Monstrosität der von Deutschen verbrochenen Geschichte für Generationen gekränkt bleiben muss. Die damit einhergehende Aggression gegenüber den Urhebern solcher Belastung, den ›Juden‹, muss aber zugleich auch kanalisiert werden. Man darf ja den Opfern des eigenen Tuns nicht anlasten, womit man nicht fertig wird, obgleich man ihnen vor- bzw. unbewusst grollt, dass sie weiterhin ›da‹ sind. Da man aber die ›Lehren aus Auschwitz‹ gezogen, den Antisemitismus mithin in die Sphäre des moralisch Verworfenen verwiesen hat, bedarf es des sublimierten Umgangs mit dem in der Latenz verharrenden Unbehagen an den ›Juden‹. Mehrerlei Strategien sind dabei im Laufe der Jahre angewendet worden: Neonazis ergingen sich bereits in den 1960er Jahren in unverhohlenem Antisemitismus, der sich vor allem am Staate Israel bzw. an der zionistischen Bewegung austobte. Diese Randerscheinungen der politischen Kultur Nachkriegsdeutschlands wurde aber schon früh nicht nur durch linke Kritik und performative Bekämpfung, sondern auch durch eine organisierte Sühneaktivität konterkariert, welche zumeist an und nach Israel gerichtet wurde. Aus diesen ursprünglich ganz und gar aus genuinem Entsetzen und ehrlich empfundener Reue hervorgegangenen Praktiken erwuchs indes nach und nach ein Komplementäres zum antijüdischen Ressentiment, namentlich eine Überidentifizierung mit ›Juden‹, eine davon abgeleitete unverbrüchliche Solidarität mit ›Israel‹ und eine politisch sich umsetzende Positionierung gegen alles, was auch nur im Ansatz als gegen die Objekte eigener projektiver Identifizierungsbedürfnisse und Solidaritätsfetischismen gerichtet gedeutet werden kann. Zum ›Antisemiten‹ kann dabei schon der werden, der sich nicht der vorgegebenen Obödienzordnung des Solidaritätsritus mit ›Juden‹, ›Israel‹ und ›Zionismus‹ unterordnet. Da man ja selbst gerne mal Opfer wäre, identifiziert man sich mit dem Juden als Opfer; da man aber auch gerne mal das ausleben würde, was sich durch das Andenken an Deutschlands verbrecherischer Geschichte verbietet, solidarisiert man sich mit dem Israeli als Besatzungssoldat.
Das Prekäre daran ist, dass es Deutschen kaum je möglich wird, objektiv zu bleiben. Genuine Kritik an Israels Politik muss in Kauf nehmen, als antisemitisch apostrophiert zu werden, desgleichen die schlichte Anerkennung der historischen wie aktuellen Leiderfahrung der Palästinenser, geschweige denn die Solidarität mit ihnen. Aber auch schon die schiere Unterstützung von Friedensbestrebungen im Nahostkonflikt mag zur politischen Bedrohlichkeit geraten, wenn sie nicht mit dem korrespondiert, was in Jerusalem für »israelische Interessen« ausgegeben wird bzw. nicht das Placet der israelischen Botschaft in Deutschland oder gar das des Zentralrats der Juden zu erlangen vermag. Von Bedeutung ist dabei, dass sich die Matrix solch ideologischer Ausrichtung nicht nur in der Agitation gewisser außerparlamentarischer Gruppen manifestiert, sondern die Koordinaten der hohen Politik Deutschlands sowie die des politischen Diskurses eines Großteils der etablierten Medien bestimmt. Es ist schon bemerkenswert, wie sehr sich jene, die einst als außerparlamentarische Opposition die staatsoffizielle Innen- wie Außenpolitik Deutschlands anzufechten und zu bekämpfen trachteten, heute im nationalen Konsens und dem augenzwinkernden Wohlwollen des politischen Establishments wiegen dürfen.
Es ist nun dieser Kontext, in dem man die in Deutschland grassierenden antimuslimischen Affekte anvisieren muss – nicht nur in diesem Kontext, aber eben auch in ihm. Unerörtert bleibt auch in diesem Zusammenhang der strukturelle historische Vorlauf, der den ›Islam‹ bzw. ›Moslems‹ überhaupt zum Thema in Deutschland hat heranwachsen lassen. Als man in den 1960er Jahren wirtschaftswunderlich der Gastarbeiter bedurfte, zögerte man nicht, sie ins Land zu holen. Dass man sie dabei als Gäste attribuierte, gab sich zwar politisch korrekt höflich, meinte aber auch das, was mit dem Begriff des Gastes gemeinhin einhergeht: dass er kommt, um wieder zu gehen. Aber viele aus den großen Schüben der italienischen, spanischen, jugoslawischen, griechischen und zuletzt auch türkischen Gastarbeiter, die in die alte Bundesrepublik einwanderten, erwiesen sich eben als die Art von Fremden, die Simmel zum Topos gemacht hatte: als Wandernde, die heute kommen und morgen bleiben. Das hatte eine Menge mit ökonomischen Interessen deutscher Arbeitgeber und dem rigiden Existenzkampf ausländischer Arbeitnehmer zu tun (wie es denn heute mit Migrationsbewegungen aus einer hungernden Dritten bzw. infrastrukturell schwachen Zweiten in eine satte Erste Welt zu tun hat). Nicht in Kauf genommen wurde zunächst, dass die, die man ins Land holte, sich lebensweltlich werden einrichten müssen, wenn sie einmal beschlossen haben, zu bleiben. Und als sie begannen, sich einzuleben, gar zu integrieren, war die Welt noch heil, solange man (gerüstet mit fröhlicher Multikulti-Gesinnung) das Fremde an den gebliebenen Gästen noch in der Form des Gangs ›zum Italiener‹ oder ›zum Griechen‹ als kulinarische Alltagsexotik (abendländischer Couleur) genießen durfte. Zum Problem wuchs dies Fremde erst dann heran, als die Lebenswelten der Immigranten einen Sichtbarkeitsgrad erreichten, der mit dem herkömmlichen (›normalen‹) deutschen Stadtbild und den Öffentlichkeitsgewohnheiten kollidierte. Es ist davon auszugehen, dass man sich auch damit wohl hätte abfinden mögen, wenn diese Intrusion nicht mit einer anderen ›Bedrohlichkeit‹ verbunden gewesen wäre: der fremden Religion.
Über Religion soll hier gleichwohl nicht geredet werden, jedenfalls nicht im Sinne einer emanzipativen Religionskritik. Denn wäre dies der Ausgangspunkt, hätte man sich mit der christlichen und jüdischen Religion nicht minder zu befassen als mit dem Islam. Dass man aber die jüdisch-christliche Tradition plötzlich meint, im Rahmen der deutschen Islam-Debatte hervorheben und preisen zu sollen, ist nicht nur das Mittel einer perfiden Islam-Polemik, wie man sie sich dem Christentum und dem Judentum gegenüber nie erlauben würde, sondern auch eine nicht hinnehmbare Verzeichnung der gesamten Geschichte des Abendlandes, mithin der jahrhundertealten jüdischen Leiderfahrung in ihr. Man vergesse nie, dass Juden im und unter dem Islam nie auch nur annährend das zu erleiden hatten, was ihnen im christlichen Abendland widerfuhr. Wenn es eine jüdisch-christliche Tradition gab, dann die der christlichen Verfolgung der »Gottesmörder«, die ein wesentlicheres Merkmal der gemeinsamen Geschichte darstellt, als was der heutige jüdisch-christliche »Dialog« glauben machen möchte. Im Munde von manipulativen Politikern und polemisierenden Intellektuellen gerät diese »Tradition« zur Verhöhnung von Millionen Opfern dieser Tradition.
Auch dass man heute ›die Moslems‹ als Feinde ›der Juden‹ herausstellen darf, ist insofern eine Verballhornung dessen, worum es in dieser Feindschaft geht, als man sich für den determinierenden Faktor ihres historischen Zustandekommens bewusst (oder vorbewusst) blind macht: den Nahostkonflikt. Wenn man nicht begreift, dass der in die arabische Region des Nahen Ostens eingedrungene Zionismus, mithin also eine politische und keine genuin religiöse Dimension, der auslösende Faktor für den das gesamte 20. Jahrhundert durchziehenden Konflikt zwischen Juden und Arabern war, dann begibt man sich auf ein geschichtliches Glatteis, auf dem man allzu leicht (und verblendet) in eine interreligiöse Polemik hineinrutscht. Wenn man aber in eine solche Polemik hineingeraten möchte, dann besinne man sich tunlichst auch auf den jüdisch-religiösen Fundamentalismus, der seit gut vierzig Jahren zum gravierenden Träger der israelischen Okkupation palästinensischer Territorien und somit zu einem der schwerwiegendsten Faktoren der Verhinderung eines israelisch-palästinensischen Friedens herangewachsen ist. Genau das möchten aber jüdische Intellektuelle in Deutschland – israelsolidarisch ihres Zeichens – ausgeblendet wissen. Dass gerade sie sich als Wortführer des islamophobischen Diskurs in Deutschland hervortun und Gehör finden, indiziert die ideologische Verschwisterung von vorgeblicher Juden-Solidarität und Islamophobie, die sich im letzten Jahrzehnt, gespeist von der alten Neuralgie der deutsch-jüdischen Beziehungen, in Deutschland merklich verfestigt hat. Von selbst versteht sich dabei, dass der nach dem Terroranschlag des 11.9.2001 sich im Westen verbreitende Islam-Horror der Ideologie der deutschen Islamophobie eine gleichsam legitimierte Einbettung im Globalen zu bieten hatte (und noch immer bietet).
Was aber die Wirkmächtigkeit der Islamophobie in Deutschland ausmacht, ist etwas Anderes, nur zaghaft Ausgesprochenes. Als der deutsche Antisemitismusforscher Wolfgang Benz sich im Jahre 2010 einen Vergleich zwischen Antisemitismus und Islamophobie zu ziehen wagte, sah er sich sogleich heftigster Kritik vonseiten des Feuilletons ausgesetzt. Dass er den Vergleich in strukturell-phänomenologischer Absicht gezogen hatte, ohne den Vergleich der realen geschichtlichen Auswirkungen von Antisemitismus und Islamophobie auch nur anzudeuten, half ihm nichts. Er hatte ein Tabu angerührt, dessen Anrührung, gar Durchbrechung im heutigen Deutschland nicht ungeahndet bleiben darf. Zu fragen bleibt gleichwohl, ob sich hinter der Empörung, die Benz' Vergleich auslöste, nicht noch etwas Schwerwiegenderes verbirgt: eine unaufgearbeitete Dimension des deutschen Antisemitismus, der als perennierendes Ressentiment, in die Schranken des Tabus verwiesen, sich nunmehr einer neuen Projektionsfläche bedienen darf, um sich legitimerweise zu manifestieren. Er darf sich sogar seiner Legitimität vergewissern, indem er ›die Juden‹, mit denen sich der Träger des Ressentiments ›identifiziert‹, mutatis mutandis somit sich selbst, vor dem ›Islam‹ in Schutz nimmt. Zu fragen wäre entsprechend, ob nicht gerade in der Islamophobie sozialpsychologisch hervorlugt, was – tabuisiert – unaufgearbeitete Residuen des antisemitischen Ressentiments zum Inhalt hat. Sollte Zvi Rex mit seiner Behauptung, dass die Deutschen den Juden Auschwitz nie verzeihen werden, recht haben, dürfte dieses latent antisemitische Ressentiment in der deutschen Islamophobie ihr Eldorado gefunden haben.
Und ein weiterer Aspekt des Antisemitismus erzeugenden Ressentiments sei noch abschließend angerissen. Sind Antisemitismus und Islamophobie miteinander verschwistert, wie steht es da mit dem Philosemitismus? Der Philosemitismus erscheint als positiver Gegenpol des Antisemitismus, insofern dieser negativ konnotiert ist. Dies hat insofern seine Berechtigung, als behauptet werden kann, dass es den Juden während ihrer Exilgeschichte zweifelsohne besser ergangen wäre, wenn ihnen das nichtjüdische Umfeld in der jeweiligen Gesellschaft, in welcher sie ihre Lebenswelten einrichteten, philo- und eben nicht antisemitisch begegnet wäre. Zumindest darf davon ausgegangen werden, dass ihnen nicht die Gewalt widerfahren wäre, der sie im traditionellen, religiös begründeten Judenhass, erst recht aber dann im späteren modernen Antisemitismus und seinen in Auschwitz kulminierenden Vernichtungsexzessen ausgesetzt waren. Nun nimmt sich aber allein schon das Konjunktive dieser einleitenden Worte als gelinde Unverschämtheit aus: Gemessen daran, dass die Geschichte der Juden nun mal nicht entsprechend des im nachmaligen Wunschdenken angelegten Irrealen verlaufen ist, sondern eben als gewaltdurchwirkte Verfolgungsgeschichte, kann der Philosemitismus nicht schlicht als utopische Emanzipationsfolie eines anders Bestehenden begriffen, sondern muss im Kontext dessen, was den Antrieb ebendieser Verfolgungsgeschichte ausmachte –Judenhass und Antisemitismus –, erörtert werden. Die Verspieltheit der irrealen Möglichkeit steht der Monstrosität des historisch Stattgefundenen nicht an. Nicht zuletzt aus diesem Grund subsumiert sich der Philosemitismus zwangsläufig dem Antisemitisimus-Paradigma. Denn geht man davon aus, dass der antisemitische Diskurs sich von der Akzeptanz einer vermeintlich real existierenden »Judenfrage«, gar eines »Judenproblems« herleitet, so gilt dies in nicht geringerem Maß auch für die philosemitische Weltsicht. D.h., Antisemitismus wie Philosemitismus haben beide zur Voraussetzung, dass man ›den Juden‹ bzw. ›die Juden‹ als Prototypen eines außerhalb des ›normal‹ Existierenden, als den schlechthin ›Anderen‹ im exkludierenden Sinne wahrnimmt, was aber zur Folge haben muss, dass ›der Jude‹ abstrahiert, mithin alles Individuellen entkleidet wird. Die abstrahierende Entmenschlichung ›des Juden‹ lässt ihn zur bevorzugten Projektionsfläche des Antisemiten wie des Philosemiten werden. Was der Antisemit dem Juden an Verabscheuungswürdigem und Bedrohlichem anhängt, was der Philosemit ihm an Tugenden und Bewundernswürdigem zuschreibt, hat mit der (jedem Kollektiv eignenden) Heterogenität jüdischer Menschen etwa so viel zu tun wie das ideologisch selbstherrlich homogenisierte Wir-Gefühl der wahl- und skrupellos projizierenden Antisemiten und Philosemiten mit der Wirklichkeit ihres lädierten Selbstwertgefühls und ihrer letztlich fremdbestimmten individuellen Selbstwahrnehmung. Antisemitismus und Philosemitismus wurzeln im gleichen Ressentiment und sind daher tendenziell dahingehend gleichermaßen gefährlich, als das vermeintlich Positive (für Juden) am Philosemitismus unter gewissen historischen Bedingungen ins schiere Gegenteil umschlagen kann, um sich dann mit umso größerer Vehemenz der vorbewusst erahnten Selbsttäuschung gegen das ehemalige abstrakte ›Liebes‹objekt, welches nunmehr zum Projektionsobjekt des Ressentiment umgewandelt worden ist, zu richten. Darüber ist schon viel gesagt worden, und vieles wäre dem hinzuzufügen. Klar dürfte allerdings sein – dies zum Abschluss –, dass man es hier mit dem Grundelend der zeitgenössischen deutschen Ideologie zu tun hat.
Literaturhinweise:
Theodor W. Adorno (1969), Erziehung nach Auschwitz, in: ders., Stichworte. Kritische Modelle 2, Frankfurt am Main, S. 85-101
Ernst Bloch (1973), Das Prinzip Hoffnung, Band 3, Frankfurt am Main
Die Print-Version dieses Beitrages erschien in Gerhard Hanloser (Hg.): Deutschland.Kritik, Münster (Unrast-Verlag) 2015, und wird hier mit freundlicher Genehmigung von Autor, Herausgeber und Verlag veröffentlicht.