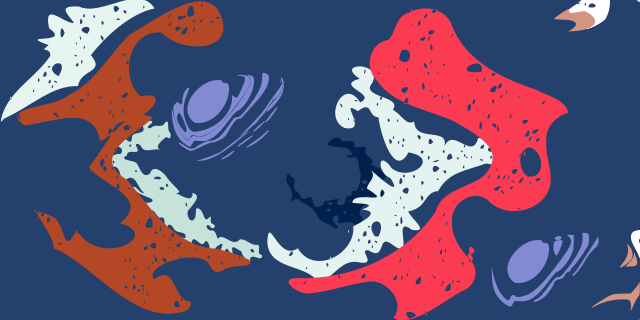von Peter Brandt
Wenn man die fast schon penetrante Fülle und Intensität von Veröffentlichungen zur 40. Wiederkehr von 1968 in den Medien auf sich wirken lässt, könnte man meinen, hier würde eines der wichtigsten Ereignisse der jüngeren deutschen Geschichte überhaupt gedacht, kurz hinter denen des ›Dritten Reiches‹. Doch weder die Demokratie noch die politische Linke und auch nicht die gesamtgesellschaftliche Modernisierung im nachfaschistischen Westdeutschland hatten um 1968 ihren Ausgang. Übrigens ebenso wenig, wie von konservativen Kritikern beklagt, Individualisierung und Wertewandel (oder wie man dort sagt: Werteverfall), Massenzuwanderung, Internationalisierung und Multikulturalität. Und doch sind sich Beteiligte und zeitgenössische Gegner, Publizisten und Fachwissenschaftler einig, dass ›1968 ‹ mental einen tiefen Traditionsbruch markiert, für den – nebenbei bemerkt – zehn Jahre danach, in den späten 70ern, noch das Jahr 1967 als Bezugspunkt diente.
Die Voraussetzungen für eine ›Historisierung‹ (um einen auf andere historische Umstände geprägten, aber inzwischen allgemein eingeführten Begriff zu verwenden) sind heute ungleich günstiger als noch vor zehn Jahren. Es existiert inzwischen eine quantitativ wie auch qualitativ beachtliche Forschungsliteratur; ich nenne als Autorennamen nur Ingrid Gilcher-Holtey und natürlich Wolfgang Kraushaar. [1] Die vielfältigen Quellen sind, teilweise in Spezialarchiven gesammelt, relativ leicht zugänglich.[2] Die eigentliche Herausforderung liegt woanders: Ich bin selbst Zeitzeuge – und zwar nicht nur als Beobachter, sondern als Handelnder. Das ist nicht unproblematisch – ich erinnere an den flapsigen Spruch vom Zeitzeugen als Todfeind des Historikers –, eröffnet, so meine Vermutung, bei einem professionell geschulten und auf analytische Distanz getrimmten Geschichtswissenschaftler aber auch die Chance einer gegenseitigen Befruchtung beider Rollen.
Wenn ich in der gebotenen Kürze eingangs meine Situation um das Jahr 1968 umreiße, dann geschieht das deshalb, um das angesprochene Spannungsverhältnis zwischen Wissenschaft und Zeitzeugenschaft konkret fassbar und damit meine Ausführungen nicht zuletzt auch besser kritisierbar zu machen: Ich bin in West-Berlin aufgewachsen, habe dort das Gymnasium besucht und ab Sommersemester 1968 an der Freien Universität das Studium der Geschichte, daneben Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre, absolviert. Bei den FU-Historikern war es damals noch relativ ruhig. Erst im Laufe dieses Jahres 1968 drang der Geist der Rebellion auch in die alte Villa deutlich abseits des Campus vor, wo das Friedrich-Meinicke-Institut untergebracht war. Als ich an die Universität kam, war ich ein bereits seit Jahren hochgradig politisierter junger Mann; 1963 war ich, schon damals aus politischen Motiven, den linkssozialdemokratischen »Falken« beigetreten und stand etwa seit 1965 auch in Kontakt mit dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund, dem SDS. Außerdem, oder besser: vor allem, hatte ich mich im Herbst 1966 der deutschen Sektion der halb konspirativ wirkenden trotzkistischen »Vierten Internationale« angeschlossen, die u. a. einen Flügel der »Falken« kontrollierte. Das waren in Deutschland nicht viel mehr als 50 Personen verschiedenen Alters, die allerdings teilweise über einen gewissen Einfluss in Betriebsräten von Großbetrieben, in Gewerkschaften – das prominenteste Beispiel ist der langjährige Chefredakteur der IG-Metall-Zeitung, Jakob Moneta – und in sozialdemokratischen Teil- bzw. Nebenorganisationen verfügten.
Die Studenten- und Jugendradikalisierung um 1968 führte dazu, dass die deutschen Trotzkisten, seit 1969 gespalten, den ›Entrismus‹ in der SPD aufgaben und über den Aufbau eigener Jugendorganisationen Einfluss zu gewinnen suchten. Ich selbst war im Herbst 1968 daran beteiligt, aus zwei ehemaligen Bezirksverbänden der »Falken« und der Schülergruppe »Neuer Roter Turm« einen Verband namens »Spartacus« (nicht zu verwechseln mit den Studentengruppen der DKP »MSB Spartakus«) ins Leben zu rufen, der zunächst als Initiative für eine breitere, revolutionär-sozialistische Jugendorganisation gedacht war. Spartacus hatte in Berlin nie mehr als 80 Mitglieder samt ›Kandidaten‹ und auf Bundesebene nie mehr als 250, wich aber in seiner sozialen Zusammensetzung von den unmittelbar aus der Studentenbewegung hervorgegangenen Gruppierungen gerade in dieser frühen Phase ab (relativ hoher Anteil von Lehrlingen, Jungarbeitern und anderen ›Werktätigen‹).[3]
Es mag den Heutigen befremdlich vorkommen, dass man sich als so junger Mensch – wie gesagt: sogar noch vor dem Ereignissen von 1967/68 – einer Art internationalem Orden, »Weltpartei der sozialistischen Revolution«, zugesellte. Für mich war es Jahre meines Lebens ein wesentlicher Teil, vielleicht das Zentrum der Existenz. Das bedeutet zugleich, dass manches von dem, was viele junge Leute gerade in den späten Sechzigern beschäftigte, für mich gar nicht (so der Drogenkonsum) oder kaum (so die neue Musikkultur) von Bedeutung war. Die führenden Gestalten der 68er-Bewegung, die, naturgemäß fünf bis zehn Jahre älter als ich, oft ebenfalls schon Jahre früher zu politischen Aktivisten geworden waren, darf man sich generell nicht als ›Gammler‹ oder Bohèmiens vorstellen, sondern sollte eher an den Typus des russischen revolutionären Intelligenzlers in den Jahrzehnten um 1900 denken.
Ich beginne mit der Schilderung eines für die 68er-Bewegung bedeutenden Ereignisses[4]: Am 17. Februar 1968 versammelten sich an die 5.000 Intellektuelle, Studierende und Jugendliche aus aller Welt im und um das Auditorium Maximum der Technischen Universität Berlin. Ein »Internationaler Vietnamkongress« tagte unter einem riesigen Transparent: »Sieg der vietnamesischen Revolution. Die Pflicht jedes Revolutionärs ist es, die Revolution zu machen!«, veranstaltet von elf linkssozialistischen Organisationen, neben dem einladenden SDS u. a. der italienischen PSIUP (=Sozialistische Partei der proletarischen Einheit, einer Abspaltung der Sozialisten), einer Gliederung der britischen Labour-Jugend und der »Jeunesse Communiste Révolutionnaire«, französischen Trotzkisten, die bei den Pariser Mai-Unruhen desselben Jahres zu den Trägergruppen des Aufruhrs gehören sollten. Der Verleger Gian Giacomo Feltrinelli hatte den Kongress zum Teil finanziert.
Die zitierte Parole ging zurück auf den einige Monate zuvor im bolivianischen Urwald gefangen genommenen und erschossenen argentinisch-kubanischen Revolutionär Ernesto ›Che‹ Guevara. Che Guevara wollte im Herzen Lateinamerikas (vergeblich) einen Guerillakrieg entfesseln: zur Entlastung des von den USA isolierten und wirtschaftlich boykottierten Kuba wie vor allem zur Entlastung Vietnams, das in seinem Kampf gegen den amerikanischen Imperialismus, so hatte er geklagt, auf tragische Weise allein gelassen werde.[5] Die direkte und indirekte Bezugnahme auf ›Che‹, das Idol der revolutionären Jugend aller Länder, beinhaltete die Abgrenzung vom Sowjetkommunismus unter Führung Moskaus, wo man von solch´ »abenteuerlichen«, »linksradikalen« Vorstellungen nichts wissen wollte.
Außer denen, die nach Berlin gekommen waren und sich dort unter der gespannten Aufmerksamkeit von Pressevertretern, Hörfunk- und Fernsehreportern, nicht nur aus Deutschland, zu ihrer Konferenz trafen, hatten sich bekannte Repräsentanten der linken geistes- und sozialwissenschaftlichen sowie künstlerischen Intelligenz Europas in Zeitungsannoncen, Telegrammen und Grußbotschaften mit den Veranstaltern solidarisiert, darunter die Philosophen Bertrand Russell, Jean Paul Sartre und Ernst Bloch, der Historiker Eric Hobsbawm, die Schriftsteller Alberto Moravia und Peter Weiss, die Creme der italienischen Filmregisseure mit Lucio Visconti, Michelangelo Antonioni und Pier Paolo Pasolini, der Komponist Hans Werner Henze sowie Giorgio Strehler und das Piccolo Teatro Milano.
Der Internationale Vietnamkongress beleuchtete in nuce das spannungsreiche Verhältnis zwischen Protestbewegung und den kommunistischen Parteien, namentlich den in Osteuropa regierenden. Diese waren in gewisser Weise durch einen Redner aus den Reihen der FDJ Westberlins repräsentiert, die sich der Teilnahme nicht hatte entziehen können oder wollen. Die gewiss nicht Moskau- bzw. Pankow-hörigen oder im Ungang mit den Kommunisten naiven SDSler hatten diese bewusst einbeziehen und zu einer Stellungnahme zugunsten der aktiven Unterstützung der Vietnamesen nötigen wollen. Es war im Vorfeld des Kongresses sogar daran gedacht worden, zusammen mit den etablierten kommunistischen Organisationen Westeuropas (analog dem Spanischen Bürgerkrieg von 1936-1939) eine Art Internationaler Brigade für Vietnam auszurüsten.[6]
Der KPdSU und der SED kam die Existenz einer fundamental-oppositionellen Studentenbewegung in Westdeutschland und West-Berlin vordergründig gelegen, da es dem Gegner im Ost-West-Konflikt Schwierigkeiten bereitete. Bei genauerer Prüfung und Abwägung der eigenen Interessen mussten dann doch die Bedenken gegenüber einer zu engen Tuchfühlung mit den nicht kontrollierbaren Rebellen aus dem Westen überwiegen. Das Risiko einer Infizierung der kommunistischen Organisationen, gar innerhalb des Ostblocks, schien zu groß.
Die radikale Vietnam-Solidarität drückte kein pazifistisches Bekenntnis aus, sondern vielmehr die vollständige oder weitgehende Identifikation mit dem als national- und sozialemanzipatorisch gedeuteten Partisanenkrieg der Nordvietnamesen und der Nationalen Befreiungsfront Südvietnams (FNL) gegen die USA und ihre vietnamesischen Verbündeten. Die Solidaritätsbewegung verstand sich gewissermaßen als europäisch-nordamerikanische Abteilung der antiimperialistischen Kämpfe in der Dritten Welt. Dabei projizierte man in die betreffenden Befreiungsbewegungen und Frontstaaten eigene Emanzipationsziele hinein, statt die dortigen Verhältnisse mit der gebotenen kritischen Distanz in den Blick zu nehmen.
Der Vietnam-Kongress stand unter einer besonderen Spannung, weil der Westberliner Senat die Demonstration und die Kundgebung am 18. Februar verboten hatte. Dieses Verbot wurde erst am Vortag vom Berliner Verwaltungsgericht aufgehoben. Angesichts der Mobilisierung von 15.000 Polizisten einerseits und der Überlegung im SDS, zu den amerikanischen Kasernen zu marschieren, andererseits hatte eine blutige Straßenschlacht gedroht. Zahlreiche protestantische Pfarrer hatten sich für den Fall, dass das Verbot bestehen blieb, bereit erklärt, in Talaren an der Spitze des Demonstrationszugs zu gehen. Dieser verlief dann vollkommen friedlich. Rund 15.000 Menschen demonstrierten unter roten und FNL-Fahnen, antiimperialistischen Transparenten und Bildern Ho Tschi Minhs, des vietnamesischen Revolutionsführers, sowie einer Reihe anderer Revolutionäre, namentlich Ermordeter wie Rosa Luxemburg, Leo Trotzki und Che Guevara. Mehr als 100 Teilnehmer, darunter die bekannten Bezirksstadträte Erwin Beck und Harry Ristock, trugen vorgefertigte Plakate mit der Aufschrift: »Ich protestiere gegen den Krieg der Amerikaner in Vietnam. Ich bin SPD-Mitglied!« Der daraufhin verhängte Ausschluss von Beck und Ristock aus der Berliner und damit aus der Gesamtpartei wurde einige Wochen später vom Nürnberger Bundesparteitag der SPD revidiert.
Drei Tage nach der großen internationalen Vietnamdemonstration riefen die vereinten etablierten Kräfte der Halbstadt unter dem Motto: »Wir wollen sagen, wofür wir sind«, die Berliner zu einer Gegenkundgebung auf. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, auch Arbeiter und Angestellte vieler Privatbetriebe hatten dafür frei bekommen. Entgegen den weit übertriebenen Zeitungsmeldungen nahmen laut Polizeiangaben rund 60.000 Menschen an der Anti-SDS-Kundgebung teil. Das war nicht unerheblich, zeigte aber, dass das Kräfteverhältnis im Hinblick auf die Mobilisierungsfähigkeit für die Achtundsechziger sich nicht so hoffnungslos darstellte, wie es vermutlich bei einer Volksabstimmung gewesen wäre. Der verbreitete, durchaus spontane Zorn über das für die meisten Westberliner nicht nachvollziehbare Engagement linker Studenten bezüglich eines sich in weiter Ferne abspielenden, ohne nähere Kenntnisse kaum durchschaubaren Partisanenkriegs (während West-Berlins latente Bedrohung von außen anhielt, der man ohne den Schutz der Amerikaner preisgegeben zu sein schien) entlud sich am Rande der Versammlung in bedenklichen Parolen (etwa: »Dutschke Volksfeind Nr. 1«) auf selbstgefertigten Plakaten und sogar in dem nur durch polizeiliches Eingreifen vereitelten Versuch einer Menschengruppe, einen Verwaltungsbeamten zu lynchen, der Rudi Dutschke ähnlich sah.
Aus all dem Gesagten wird deutlich, dass hier eine internationale und im strikten Sinn internationalistische Bewegung antrat, die Welt zu verändern. Etwa seit 1966 hatten Organisationen einer »Neuen Linken« – in doppelter Abgrenzung von der gemäßigten Sozialdemokratie und vom diktatorischen Poststalinismus – enge Konsultations- und Kooperationskontakte etabliert. Dabei kam der Verbindung des deutschen SDS mit den amerikanischen, gleich abgekürzten »Students for a Democratic Society«, sowie der afroamerikanischen Studentengruppe SNCC (= Student Nonviolent Coordinating Committee), radikalisiert in der Bürgerrechtsbewegung und im Vietnam-Protest, eine besondere Bedeutung zu. Die friedlichen, aber teilweise bewusst Regeln verletzenden Aktionsformen wie Teach-ins, Sit-ins, Go-ins, Verkehrsblockaden, Institutsbesetzungen usw. waren ebenso großenteils in den USA entwickelt worden (den Anfang machte 1964 das Free-Speech-Movement in Berkeley) wie Ende 1967 die Parole, man müsse nun »vom Protest zum Widerstand« gegen den US-Imperialismus übergehen.
›1968‹ war indessen nicht nur ein transnationales, sondern ein fast buchstäblich weltweites Phänomen, auch wenn insgesamt kein organisierter globaler Akteur benannt werden kann. Auch in Japan und in Drittweltländern wie Mexiko sowie in kommunistisch regierten Staaten wie Polen und Jugoslawien machten sich jugendliche, vor allem studentische Massenproteste gegen die bestehenden politisch-sozialen Verhältnisse geltend. Besonders auffällig war dabei die Parallelität von Gesellschaftsveränderungsprojekten mit revolutionärem oder radikal-reformerischem Anspruch, die sich der lähmenden Logik des Ost-West-Konflikts entzogen. Besonders stechen die Beispiele des ›Prager Frühlings‹ und des ›Pariser Mai‹ – keineswegs nur ein Studentenaufstand im großem Stil, sondern zugleich der größte Generalstreik in der französischen Geschichte – hervor. Auf der Ost-West-Achse gab es, nach wie vor dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-Staaten in die Tschechoslowakei am 21. August 1968, eine Fülle persönlicher und organisatorischer Kontakte, von der indirekten wechselseitigen Beeinflussung ganz abgesehen.[7] Mit dem, international nachweisbaren, Abschwung der Bewegung seit dem Sommer 1968 reduzierte sich auch der bereits erreichte Grad an internationaler Vernetzung sowie Vereinheitlichung von Deutungsschemata und Aktionsformen.
Gelegentlich wird eine Verbindung von ›1968‹ und ›1989‹, der friedlichen Revolution im Osten Europas, behauptet. Trotz gründlich veränderter Szenerie und – im Unterschied zu den späten 60er Jahren – der Beschränkung der Ereignisse zwei Jahrzehnte später auf den östlichen Teil des europäischen Kontinents erscheint diese Annahme nicht ganz abwegig. Das gilt offenkundig für manche der Aktivisten von 1989, die erstmals um 1968 in Erscheinung getreten waren – so etwa Adam Michnik in Polen und Petr Uhl in der Tschechoslowakei; aus den jüngst veröffentlichen Tagebüchern des Historikers Hartmut Zwahr haben wir eindrucksvoll bestätigt bekommen, mit welchen Hoffnungen das Prager Experiment von kritischen Sozialisten der jüngeren Generation der DDR verfolgt wurde.[8] Und auch die ursprünglichen Ziele der sozialen Protest- und der Bürgerrechtsbewegung in Osteuropa vor und um 1989, sogar einschließlich der nationalkatholisch drapierten Solidárnósc, sowie ihre antiautoritäre Stoßrichtung lagen in gewisser Weise näher an ›1968‹ als an dem, was sich dann tatsächlich östlich der Elbe etablierte.
Es ist nicht leicht, wirklich stichhaltige Gründe für die verblüffende übernationale Gleichzeitigkeit der Studenten- und Jugendrevolte auszumachen – und noch weniger für den Zeitpunkt ihrer Kulmination im April/Mai 1968. Selbst wenn hier offenbar auch Kontingenzen eine Rolle spielten, kann es sich insgesamt kaum um einen Zufall gehandelt haben. Ich will versuchen, die wichtigsten Rahmenbedingungen und Gründe zu nennen:
1. Die Wiederaufbauphase nach 1945, die dann in einen lang anhaltenden Wirtschaftsboom übergegangen war, war vorüber. Mit der nicht allein auf Deutschland beschränkten Rezession von 1966/67 deutete sich eine gewisse ›Normalisierung‹ des kapitalistischen Konjunkturzyklus an, allerdings auf einem in den zwei Jahrzehnten davor ganz erheblich erhöhten Reallohn- und sehr hohen Beschäftigungsniveau. Die jüngere Generation der Lohnabhängigen agierte somit einerseits unter viel günstigeren materiellen Voraussetzungen und trug andererseits nicht mehr so schwer an den demoralisierenden Erfahrungen der Jahrzehnte davor (Weltwirtschaftskrise, Zweiter Weltkrieg, Faschismus und Stalinismus). Das Anspruchsniveau hatte sich dementsprechend verändert, wobei neben die traditionellen Forderungen nach höheren Löhnen und reduzierter Arbeitszeit neue, qualitative Forderungen und Auseinandersetzungen traten, die auf die Autoritätsstrukturen in den Betrieben und Büros gerichtet waren. Sie spielten in den großen Streiks der Jahre ab 1968/69 in etlichen europäischen Ländern eine immer wichtigere Rolle. Westdeutsche Gewerkschaften diskutierten über die »Humanisierung« der Arbeitswelt, etwa durch die Einschränkung der Akkordarbeit und deren Umwandlung in Gruppenarbeit. Das globale, namentlich das europäische ›1968‹ bleibt unverstanden, wenn – gemäß einer überspitzten Deutung der deutschen Vorgänge – eine rebellische Studentenschaft einer durchweg abseits stehenden, ja feindseligen Restbevölkerung gegenübergestellt wird.
2. Zu der seit Mitte der 60er Jahre veränderten Konstellation trug maßgeblich die Abschwächung der Ost-West-Konfrontation bei, während in der ›Dritten Welt‹ weiterhin, ja verstärkt bewaffnete Konflikte ausgetragen wurden, meist in der Form nationaler Befreiungskriege unter der Führung antikolonialer bzw. antiimperialistischer und insofern antiwestlicher Gruppierungen. Die beginnende Entspannung in der nördlichen Hemisphäre beruhte auf dem Eigeninteresse der Supermächte, die während der Doppelkrise um Berlin und Kuba 1961/62 am nuklearen Abgrund gestanden hatten, eröffnete dann aber auch den europäischen Staaten einen größeren Spielraum, ihre spezifischen Anliegen einzubringen, so Rumänien innerhalb des Warschauer Pakts und das Frankreich de Gaulles im Atlantischen Bündnis; auch der Berliner Vorläufer der Neuen Ostpolitik der Bundesrepublik, die »Politik der kleinen Schritte«, gehört in diesen Zusammenhang. Die Entkrampfung der (anhaltenden) Blockkonfrontation auf der zwischenstaatlichen Ebene begünstigte mit dem beginnenden Abbau bzw. der Differenzierung der wechselseitigen Feindbilder die freiere Artikulation politischer Neuansätze auch im Innern der jeweiligen Gesellschaften.
3. Die permanent gewordene ›wissenschaftlich-technische Revolution‹ und die Expansion staatlicher Tätigkeit erforderten eine Anpassung des Bildungswesens, insbesondere eine Ausweitung der höheren Bildung. Es galt,›Bildungsreserven‹ in der werktätigen, nicht-akademischen Bevölkerung auszuschöpfen und die Studentenzahlen (in der Bundesrepublik bis in die frühen 60er Jahre wenige Prozente eines Jahrgangs) erheblich zu vergrößern sowie die Organisation der Universitäten und die Studiengänge entsprechend zu modernisieren. Diese Umstellung war bereits in Gang gekommen, zumindest in der Diskussion, als die Protestbewegung in größerem Umfang einsetzte; es ging jetzt nicht mehr darum, ob sich etwas ändern würde an den Hochschulen, sondern um das Was und das Wie. – Alles das betrifft vor allem die entwickelten kapitalistischen Länder, in zweiter Linie und modifiziert aber auch die Länder des europäischen Ostblocks.
4. Von kaum zu überschätzender Bedeutung ist die Tatsache, dass mit dem Vietnamkrieg ein gemeinsamer Bezugspunkt des Aufbegehrens gegeben war, seit die USA 1964/65 mit der Bombardierung Nordvietnams und dem massenhaften Einsatz von Bodentruppen selbst interveniert hatten. Der Versuch, mit dem vollen Einsatz der Militärmaschine der amerikanischen Weltmacht, die Zivilbevölkerung nicht schonend, einen exemplarischen Sieg über die antiimperialistischen Partisanenkriege in der Dritten Welt zu erringen, desavouierte, je länger er andauerte, offensichtlich den freiheitlichen Anspruch der Führungsmacht des Westens. Auch wurde für jeden unvoreingenommenen Beobachter schnell klar, dass der Vietnam-Konflikt mit dem Ost-West-Schema im Kern nicht zu erfassen war.
Die moralische Seite des Protests machte sicht nicht zuletzt und vielleicht besonders dort geltend, wo das Image der USA als antifaschistische Befreier- und antikommunistische Schutzmacht bis dahin noch weitgehend unbeschädigt war wie unter jungen Westdeutschen und namentlich Westberlinern. Als eine jugendliche Schwedin einem Fernsehreporter – weitertransportiert in die ganze Welt – erklärte, sie wünsche sich, eine Kämpferin der südvietnamesischen Befreiungsfront zu sein und die amerikanischen Invasoren zum Teufel zu jagen, schockierte diese etwas exaltierte Aussage nicht nur die US-amerikanische Öffentlichkeit. Und als am 24. Februar 1968 der Bildungsminister und spätere Premier Schwedens, eines neutralen und letztlich eher prowestlichen Landes, Olof Palme, in Stockholm Seite an Seite mit dem nordvietnamesischem Botschafter in Moskau gegen den Krieg der USA in Südostasien demonstrierte, wurde sichtbar, wie breit die Kluft zwischen der Supermacht USA und einem großen und stets wachsenden Teil der Europäer geworden war.
Als Ort der ersten internationalen Manifestation der Solidarität mit Vietnam war West-Berlin bewusst gewählt worden, symbolträchtiger und prestigebeladener Vorposten der amerikanischen Weltmacht und des westlichen Bündnisses, aus den Erfahrungen der Ost West-Konfrontation und der wiederholten Pressionen der Sowjetunion bzw. der DDR vermutlich die am meisten proamerikanische Großstadt außerhalb der USA selbst, auch wenn der Mauerbau und die Folgeereignisse eine erste Vertrauenskrise im Verhältnis der Westberliner zur Besatzungs- und Schutzmacht herbeigeführt hatten. Berlin war aber auch zusammen mit Frankfurt am Main das Hauptzentrum und gewissermaßen die Avantgarde dessen, was immer häufiger schlicht »die Revolte« genannt wurde. Es macht also nicht nur wegen meiner Zeitzeugenschaft Sinn, diese hauptsächlich am Berliner Beispiel in ihrem Verlauf näher zu beleuchten.
Das Westberliner Gemeinwesen mit seinem eigenartigen Sonderstatus war seit Ende des Zweiten Weltkriegs naturgemäß deutlich stärker politisiert als die westdeutschen Länder der Bundesrepublik. Es gab keine ›normale‹ Kommunal- und Landespolitik, die von Statusfragen und der gesamtdeutschen Problematik unabhängig gewesen wäre. Auch die Universitätslandschaft war dadurch geprägt; denn die Freie Universität war 1948 in Absetzung gegen die zunehmend reglementierte, im Sowjetsektor gelegene Humboldt-Universität gegründet worden: im Amerikanischen Sektor mit amerikanischer Hilfe. Das »Berliner Modell«, ohne Parallele an anderen deutschen Universitäten, beinhaltete ein ›antitotalitär‹ definiertes allgemeinpolitisches Mandat und studentische Mitwirkung auf allen Ebenen der akademischen Selbstverwaltung. Dieses Erbe des antikommunistischen Abwehrkampfes war für die bestimmenden Kräfte relativ unproblematisch, solange der universitäre Gründungs- und politische Grundkonsens im Großen und Ganzen erhalten blieb. Genau diese Voraussetzung schwand spätestens um die Mitte der 60er Jahre.
Die zunächst nur schleichende Veränderung des politischen Klimas in der jungen Generation der Westdeutschen und Westberliner deutete sich an, als in Reaktion auf das im Schatten der Kuba-Krise Ende Oktober 1962 erfolgte staatliche Vorgehen gegen den Spiegel wegen der Veröffentlichung militärischer Geheimnisse heftiger Widerspruch zu vernehmen war; die spontanen Demonstrationen waren allerdings noch recht klein. (Im Juni zuvor hatten die unpolitischen, aber obrigkeitsfeindlichen »Schwabinger Krawalle« bundesweit Aufsehen erregt.) Die 1960 begonnenen Ostermärsche der Atomwaffengegner bekamen nach und nach ein quantitativ größeres Gewicht. In Berlin ereignete sich etwas universitätsintern Einmaliges, als die Studenten der Freien Universität im Februar 1963 den neu gewählten, dem Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) angehörenden ASTA-Vorsitzenden Eberhard Diepgen, den späteren Regierenden Bürgermeister, in einer Urabstimmung mit großer Mehrheit abwählten. Diepgen war zugleich Mitglied in einer schlagenden Verbindung (Burschenschaft »Saravia«), was als Affront gegen den Gründergeist der FU empfunden wurde.
1965 begann dann die nicht mehr abreißende Serie politischer Konflikte zwischen einem Teil, bald der Mehrheit der Studierenden einerseits, den politisch-gesellschaftlichen Eliten und der Mehrzahl der Professoren (nicht nur der konservativen Richtung) andererseits, als dem Publizisten Erich Kuby wegen einer früheren abfälligen Äußerung über die Hochschule ein Vortrag zum 20. Jahrestag der Kapitulation des Deutschen Reiches in der Freien Universität verboten wurde. Im Sommersemester 1966 kam es erstmals zu einem breiten Studentenprotest wegen spezifisch universitärer Themen, als sich diverse Gruppierungen, bis hin zu den schlagenden Verbindungen, gegen die Zwangsexmatrikulation von Langzeitstudenten wehrten.
Es ist charakteristisch, dass der in diesem Sinn inneruniversitäre Protest zwei Stoßrichtungen hatte: erstens ging es den Progressiven um die Ablehnung der Ordinarienallmacht, um veraltete Lehrinhalte und -formen, um die soziale Öffnung und den quantitativen Ausbau der Gymnasien und Hochschulen, auch um Mitbestimmung der nichtprofessoralen Funktionsgruppen auf dem Weg paritätisch besetzter Gremien. Vieles davon wurde in der bundesdeutschen Öffentlichkeit seit Georg Pichts 1964 erschienener Artikelserie über die vermeintlich drohende »Bildungskatastrophe«[9] intensiv diskutiert. Die Richtung der angedachten und teilweise bereits stattfindenden Veränderungen, die sog. ›technokratische‹ Hochschulreform, stieß bei den kritischen Studenten indessen in manchen Aspekten auf ebenso wenig Gegenliebe. Man befürchtete die verstärkte Funktionalisierung der Bildungseinrichtungen für die Interessen von Staat und Großkonzernen, die »Verwertungsinteressen des Kapitals«, wie man sich mehr und mehr ausdrückte. Diese doppelte Stoßrichtung, anspruchsvoll formuliert schon in der Hochschuldenkschrift des SDS von 1961[10] und zugespitzt durch die Hereinnahme allgemeinpolitischer Kontroversen in den Universitätsbetrieb, erklärt jenes eigenartige Oszillieren der Studentenbewegung (als Hochschulbewegung) zwischen konkreten Reformbemühungen, der Schaffung eigener konkurrierender Strukturen – so der Berliner »Kritischen Universität« – und der oftmals wochenlangen und nicht selten brutalen Störung des Unterrichtsbetriebs, vor allem von Veranstaltungen missliebiger Professoren.
Auch der Vietnam-Protest artikulierte sich in Berlin frühzeitig. Eine Expertengruppe der SDS versuchte, u. a. durch Auswertung der internationalen Presse, die in der Bundesrepublik und besonders in West-Berlin anfangs fast durchweg proamerikanische Berichterstattung über den Vietnamkrieg zu konterkarieren. 1966 erschien im Suhrkamp-Verlag die dann in zahlreichen Auflagen verbreitete Analyse zweier Berliner SDSler unter dem Titel: »Vietnam. Genesis eines Konflikts«.[11] Im Februar 1966 gingen rund 2.000 Westberliner (viel für eine linke Demonstration zu dieser Zeit) gegen den »schmutzigen Krieg« auf die Straße, und es kam zu einer ersten Attacke einiger Teilnehmer gegen das Amerika-Haus (mittels Werfens von Hühnereiern und Auf-Halbmast-Setzens des Sternenbanners), ein Sakrileg in der Frontstadt des Kalten Krieges und Gegenstand ungeheurer Empörung seitens der etablierten politischen Kräfte der Halbstadt. Irritationen innerhalb des SDS hatten eine illegale Plakataktion in der Nacht vom 3. auf den 4. Februar und die Festnahme von fünf Beteiligten ausgelöst. Eine »Internationale Befreiungsfront«, unverkennbar aus den eigenen Reihen, nahm die vermeintliche Bonner Komplizenschaft und das angebliche Arrangement von ›Ost und West‹ auf Kosten der unterentwickelten Länder aufs Korn.
Im Innern der Bundesrepublik bildeten vor allem die Regierung der Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD (Dezember 1966 - Oktober 1969), die damit in den Bereich des Realisierbaren geratenden Pläne für eine verfassungsändernde Notstandsgesetzgebung, die ersten Wahlerfolge der als NPD neuformierten extremen Rechten sowie die vermeintlich mangelnde Gründlichkeit der Auseinandersetzung der westdeutschen Gesellschaft mit ihrer nationalsozialistischen Vorgeschichte Steine des Anstoßes. Dabei setzte sich eine analytische Kritik des ›Neo‹- oder ›Spätkapitalismus‹ in der Bundesrepublik durch, die alle diese Erscheinungen als Symptome einer sog. ›Formierung‹ des bürgerlichen Staates hin zu einem demo-autoritären System neuen Typs interpretierte, für das die Manipulation der Massen das entscheidende Herrschaftsmittel sei, lediglich ergänzt um die physische Unterdrückung oppositioneller Minderheiten. Diese Deutung, die sich teilweise mit prinzipieller Parlamentarismus-Kritik in der Tradition der Rätetheorie nach 1918 vermengte, verwischte bewusst die Unterschiede zwischen repräsentativer Demokratie und Rechtsstaat einerseits, Faschismus und Polizeistaat andererseits.
Ein weit verbreitetes Buch des Berliner Politikwissenschaftlers Johannes Agnoli und des Psychologen Peter Brückner über »Die Transformation der Demokratie« [12] analysierte die Entwicklung der Verfassungswirklichkeit in der Bundesrepublik als autoritäre Rückbildung des liberalen Staates unter Beibehaltung seiner Normen. Ein zunehmend fiktiver Parlamentarismus und ein Schein-Pluralismus von Parteien, die sich in der Substanz nicht mehr unterschieden, verschleiere die ständige Perfektionierung der Machtapparatur im Interesse des Kapitals.
Trotz dieser pessimistischen Analyse und der teils alarmistischen, teils leichtfertigen Beschwörung der Gefahr eines »neuen Faschismus« war der zwar in der Programmatik diffuse, aber in der Stoßrichtung radikale Demokratisierungsimpuls eine, ja die wesentliche Zielrichtung der 68er-Bewegung schlechthin, die sich auch als »Außerparlamentarische Opposition« (APO) definierte, und bezeichnete die Gemeinsamkeit des recht heterogenen Konglomerats. Dabei ging es um die Politisierung der realen Bedürfnisse und Interessen der Menschen. Die mit dem Anspruch auf demokratische Selbstbestimmung verknüpfte Mitbestimmungsforderung (»participatory democracy« in den USA, »autogestion« in Frankreich usw.) betraf jetzt hauptsächlich diejenigen »Bereiche konkreten Lebens, welche die alltäglichen Erfahrungen der Menschen bestimmten: in den Betrieben, Büros, Schulen, Universitäten.« [13]
Zur Außerparlamentarischen Opposition gehörten in der Bundesrepublik neben dem SDS und den als »Kampagne für Abrüstung« organisierten Ostermarschierern zunehmend auch unabhängige und sozialistische Schülergruppen – die schlossen sich, eher koordinierend, im Frühjahr 1967 in einer bundesweiten »Aktionsgemeinschaft« zusammen (AUSS) – sowie, mit gewisser Verzögerung, entsprechende Lehrlingsinitiativen, ferner die zum linksliberalen Bürgertum hin offenen, in der Grundtendenz traditionell-linken »Republikanischen Clubs« (im Milieu namentlich des Berliner RC und des darin entstandenen Publikationsorgans »Berliner Extra-Dienst« bzw. »Berliner Extrablatt« konnte das ostdeutsche Ministerium für Staatssicherheit einige Agenten platzieren bzw. rekrutieren), die Studenten- und Teile insbesondere der Jugendorganisation von SPD, FDP und DGB-Gewerkschaften sowie der großen Kirchen, hauptsächlich der Evangelischen Kirche; und sogar etablierte Jugendverbände eigentlich unpolitischen Charakters, wie der Bund Deutscher Pfadfinder, gerieten zeitweise in den Bann des Demokratisierungsdiskurses und in den Sog der Protestbewegung. In welchem Ausmaß diese einige Jahre stilprägend wirkte, lässt sich daran ablesen, dass Demokratisierungsforderungen sogar von christdemokratischen Jugendorganisationen wie der 1972 gegen die Achtundsechziger ins Leben gerufenen »Schülerunion« erhoben wurden.
Es waren zwei Berliner Ereignisse, die Erschießung Benno Ohnesorgs bei der Demonstration gegen den Besuch des vom Westen gestützten Schahs von Persien am 2. Juni 1967 und der Mordanschlag auf Rudi Dutschke am 11. April 1968, die für die deutsche Gesamtentwicklung bestimmend wurden: durch die flächenbrandartige Ausdehnung des Protests auf Westdeutschland bis tief in die Provinz und durch die Eskalation der Revolte mit Demonstrationen von insgesamt 50.000 Menschen mit (durchweg gescheiterten) Blockaden der Einrichtungen des Springer-Verlags und Straßenschlachten, wobei, wie später gerichtsnotorisch festgestellt wurde, zumindest in einem Fall ein V-Mann des Verfassungsschutzes als Scharfmacher fungierte. Zurück blieben nach dem Osterwochenende 1968 zwei Tote, 400 Schwer- und Leichtverletzte. Danach folgten zwar noch ›rote‹ 1. Maidemonstrationen von teilweise beeindruckender Größe (in Berlin-Neukölln marschierten rund 30.000 meist junge Linkssozialisten verschiedener Richtungen auf), und vor allem die Proteste gegen die Verabschiedung der Notstandsgesetze den Mai über; hier kam es (allerdings ohne weitere Folgen), neben dem großen Sternmarsch auf Bonn und anderen Aktionen auf Initiative linksgerichteter Gewerkschafter in nennenswertem Umfang sogar zu Proteststreiks, namentlich im Rhein-Main-Gebiet. Die Gewerkschaftsspitzen hatten sich angesichts der deutlichen Milderung der notstandsgesetzlichen Bestimmungen und der eindeutigen parlamentarischen Mehrheit für ihre Annahme von den Formen und Inhalten der APO-Kampagne abgewandt und eine eigene Kundgebung organisiert.
Bei der Interpretation der westdeutschen Verfassungsordnung als eines nur ›formal-demokratischen‹, in der Substanz autoritären Systems spielte, wie bereits erwähnt, die Vorstellung eine wesentliche Rolle, die lohnabhängigen Massen würden, außer durch materielle Zugeständnisse, vor allem durch einen mächtigen medialen Manipulationsapparat ruhig gehalten und daran gehindert, ihre Interessen zu erkennen und im Bündnis mit der jungen linken Intelligenz kämpferisch zu vertreten. Durch die weit fortgeschrittene Pressekonzentration und namentlich durch die mancherorts beherrschende, herausragende Position des Springer-Konzerns auf dem Zeitungsmarkt hatte die Kritik eine persönliche Adresse. In der Tat hatten die Springer-Zeitungen jahrelang und systematisch ein Bild vom SDS und seinen führenden Mitgliedern propagiert, das über eine scharfe inhaltliche Auseinandersetzung weit hinausging und dem, in grellen Farben ausgemalt, alle Kennzeichen eines regelrechten Feindbilds zueigen waren.
Als der SDS Anfang 1968 die Kampagne: »Enteignet Springer!« startete, konnte er sich bis zu einem gewissen Grad der Rückendeckung durch die großen linksliberalen Presseorgane wie Der Stern, Der Spiegel und die Frankfurter Rundschau sicher sein; deren Verleger und Chefredakteure förderten die Anti-Springer-Kampagne im Übrigen auch direkt mit verdeckten Geldspenden, obwohl auch sie in der Kritik der Studentenbewegung standen. Schon um die Mitte der 60er Jahre war die Publizistik in der Bundesrepublik politisch scharf polarisiert, und die genannten Zeitschriften wurden Foren der Kritik am Einfluss Axel Springers und an der Ausrichtung seiner Blätter, vor allem der Bild-Zeitung. Zugleich förderten die linksliberalen Presseerzeugnisse mit ihrer eher freundlichen Berichterstattung über die Studenten- und Jugendrevolte, deren Botschaften sie somit indirekt transportierten, die öffentliche Aufmerksamkeit für dieses Faszinosum. Erwähnung verdienen auch die diversen kritischen Magazin-Sendungen im Fernsehen; den Anfang hatte Panorama gemacht.
Daneben entstand spätestens seit 1965 aber auch eine Publizistik, die offen mit der Protestbewegung sympathisierte oder sich sogar als ihr angehörig verstand. Linke Zeitschriften wie Konkret und Pardon, selbst ein linksintellektuelles Diskussionsforum wie das von Hans Magnus Enzensberger redigierte Kursbuch, erreichten Ende der 60er Jahre Auflagen im Hunderttausender-Bereich. Dazu kamen eine Fülle weiterer Zeitungs-, Zeitschriften- und Verlagsgründungen sowie rege, meist auf die Verbreitung schwer zugänglicher oder teurer theoretischer Werke gerichtete Raubdruckaktivitäten. Und auch große Publikumsverlage wie Suhrkamp, Fischer, Luchterhand, Kiepenheuer und Witsch, Rowohlt und sogar Ullstein (Bestandteil des Springer-Konzerns) nahmen in erheblichem Maß entsprechende Titel in ihr Programm auf.
Fraglos enthielt das internationalistische Bekenntnis der Studenten in Deutschland von Anfang an einige spezifische Komponenten. Ihr Protest war nur aus dem Klima der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft erklärlich. Es war der Aufstand der Jugend gegen die Konformität der deutschen Provinz. Die noch wesentlich vom bürgerlichen Elternhaus geprägten Studenten erhoben sich gegen die Vätergeneration und machten dieser für ihr Versagen unter dem Nationalsozialismus sowie für die in den Familien erfahrene Methode der ›Vergangenheitsbewältigung‹ durch Abwendung und Verschweigen den Prozess. Hinter der inflationär gebrauchten Denunziationsformel ›faschistisch‹ (oder ›faschistoid‹) für soziale Verhaltensweisen und Strukturen in Schulen und Universitären wie in der gesamten Gesellschaft steckte auch der Versuch einer Vergangenheitsbewältigung – gleichsam eine verspätete Formel des Widerstands, die ihre moralische Rechtfertigung aus der aggressiven Reaktion von Teilen der bundesdeutschen Öffentlichkeit erfuhr – am deutlichsten in West-Berlin.
Die Geschichte der Revolte samt ihrer Probleme und Widersprüche verdichtet sich in der Biographie Rudi Dutschkes.[14] Geprägt von der protestantisch-christlichen Ethik des Elternhauses und der ostdeutschen Jungen Gemeinde, entzog er sich wenige Tage vor dem Mauerbau dem Wehrdienst in der NVA nach West-Berlin. »Ich weigerte mich, auf Deutsche zu schießen!« Bei Protestaktionen gegen die Mauer schloss er Freundschaft mit Bernd Rabehl. Mit dem westdeutschen Konsumkapitalismus konnten sich die beiden nicht anfreunden, ebenso wenig mit der, so meinten sie, hinter der Wiedervereinigungsforderung verborgenen, selbstzufrieden-selbstgerechten Abkehr der Bundesrepublik von den Landsleuten im Osten Deutschlands. Die Erfahrungen im Westen führten Dutschke (und Rabehl) zunächst in die mit der »Situationistischen Internationale« verbundene »Subversive Aktion«, eine anarchoide, sich ebenso künstlerisch wie politisch verstehende Gruppierung, die an den Dadaismus, Surrealismus und Lettrismus anschloss, dann Anfang 1965 zusammen mit der Subversiven Aktion in den SDS. 1968 schrieb Rudi Dutschke rückblickend: »Gerade die Beschäftigung mit internationalen Fragen war Resultat unserer widersprüchlichen Situation: Niemand von uns liebte die Mauer, nur wenige hielten die DDR und die SED für wirklich sozialistisch, aber fast alle hassten die heuchlerische Adenauer-›Republik‹, die Doppelzüngigkeit der SPD und den Verrat der CDU an der Wiedervereinigung.« [15]
Patriotismus und Internationalismus waren also in Dutschkes Engagement umschlossen. Kollektivschuld-Gefühle und deutscher Selbsthass waren ihm fremd. Er plädierte 1967 für ein »durch direkte Rätedemokratie getragenes West-Berlin« als einen »strategischen Transmissionsriemen für eine zukünftige Wiedervereinigung Deutschlands«. [16] Auch manche Nahestehende hielten das für bodenlose Spekulation. Ich erwähne es dennoch, weil heute vielfach unterstellt wird, die Achtundsechziger hätten sich entweder für die Deutsche Frage gar nicht interessiert oder wären vorbehaltlos für die Zweistaatlichkeit eingetreten. Für Etliche trifft das eine oder das andere zu. Es war aber auch keine rein individuelle, lebensgeschichtlich bedingte Spezialität oder gar ein Spleen, wodurch Dutschke und nicht wenige seiner Genossen, vor allem in West-Berlin, für die deutsche Teilungsproblematik und die Dialektik von globalen und nationale Prozessen, sozialer und nationaler Frage sensibilisiert wurden.
Dutschkes Persönlichkeit ›passte‹ zu dem, was er vertrat: Auch entschiedene Gegner konnten sich seiner gewinnenden, offenen, unarroganten Art, seiner warmherzigen Ausstrahlung schwer entziehen. Seine ›weichen‹ Charakterzüge waren indessen kombiniert mit einem beinahe fanatischen Sendungsbewusstsein; er war ein asketischer Revolutionär ohne erkennbare Laster, erfüllt von unermüdlichem Lerneifer, mit einem disziplinierten Lebenswandel und einem – als früherer Leistungssportler – gestählten Körper.
Was verband diesen Typus des intellektuellen Asketen, den Dutschke in fast idealer Weise verkörperte, mit jenen jungen Leuten verschiedener Herkunft, die, ähnlich wie die amerikanischen Hippies, den (mittellosen) Lebensgenuss ins Zentrum ihres Strebens stellten, sich in allen ihren Äußerungen von der ›Leistungsgesellschaft‹ und ihren Trägern, also auch der Mehrheitsbevölkerung, abgrenzten und die ›Spießer‹ verachteten? Allen eventuellen ideologischen Gemeinsamkeiten vorgeordnet, einte beide Typen die emotionale Gegnerschaft: gegen den ›Konsumterror‹ und gegen den Konformismus der breiten Volksschichten, namentlich der Akademiker. Das war die Voraussetzung dafür, dass ab 1966 Teile des SDS darüber nachdachten und sich darum bemühten, unpolitisches Protestverhalten von Jugendlichen politisch zu kanalisieren, während umgekehrt der sehr ›ernsthafte‹ Studentenverband durch den Lebensstil, das äußere Erscheinungsbild (Haartracht) und den Habitus der jugendlichen Gegenkultur infiltriert wurde. Nun hieß es: »Die Revolution muss Spaß machen«, wie es der mit Begeisterung aufgenommene Louis-Malle-Film Viva Maria (mit Brigitte Bardot und Jeanne Moreau) von 1965 zeigte.
Rudi Dutschke war nicht der einzige Achtundsechziger mit Wurzeln im Protestantismus und mit Prägung durch dessen charakteristische Moralität. Bekannte Theologen aus der Tradition der Bekennenden Kirche, vor allen anderen Helmut Gollwitzer, Dutschkes persönlicher Freund und Gesprächspartner, standen der Protestbewegung zumindest zeitweise nahe. (Ein zweiter, in der Regel weniger beachteter Traditionsstrang verband zahlreiche Akteure mit den Ausläufern der deutschen bürgerlichen Jugendbewegung, namentlich mit den elitären, kaum nationalsozialistisch kontaminierten bündischen Gruppierungen wie der »Deutschen Jungenschaft vom 01.11.1929« (DJ 1/11) und dem »Nerother Wandervogel«, die um 1960 noch einmal einen kleinen Aufschwung erlebt hatten.) War die biographische Verbindung mit dem evangelischen Christentum in der 68er-Bewegung ein weit verbreitetes Phänomen, so personifizierte niemand die quasi-religiösen Züge der Protestbewegung so eindringlich wie der christliche Marxist Dutschke. Sein Appell, eine neue, nie dagewesene, solidarische Gesellschaft der Freien und Gleichen zu schaffen, ständig benutzte Metaphern wie der ›neue Tag‹, dessen Ankunft bevorstehe, und der ›neue Mensch‹, der nicht einfach als Ergebnis der Revolution zu erwarten sei, sondern, um zum menschheitsbefreienden Ziel zu gelangen, schon im Kampf geboren werden müsse, enthielten metapolitische Heilsbotschaften, wie sie in den heroischen Phasen der sozialistischen Arbeiterbewegung auch früher schon ausgesandt worden waren und zeitnah von Theoretikern der antikolonialen bzw. antiimperialistischen Revolution formuliert wurden: hauptsächlich von Frantz Fanon [17], dem aus Martinique stammenden, später dann im Unabhängigkeitskrieg auf die Seite der algerischen Befreiungsfront getretenen, verstorbenen afroamerikanischen Arzt, und eben von Che Guevara (auch er ursprünglich Arzt), der bei Dutschke und manchen seiner Gesinnungsgenossen geradezu christusähnliche Züge zugesprochen erhielt.
Dutschkes Marxismus war eng mit seiner Deutung der christlichen Botschaft verwoben, und er war dementsprechend weniger deterministisch als vielmehr in hohem Maß voluntaristisch. »Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen... Wir können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat...« [18] Neben (vor allem dem frühen) Marx stützten sich Dutschke und seine engeren Gefolgsleute auf die Schriften von Karl Korsch, des dissidenten, libertären Kommunisten der Weimarer Zeit, und seines ungarischen Zeitgenossen, des 1956 der Regierung von Imre Nagy angehörendem Literaturwissenschaftlers und Philosophen Georg Lukács, mit dem Dutschke, wie auch mit Herbert Marcuse und Ernst Bloch, persönlich Kontakt hielt. Auch Dutschkes 1966/67 von großen Teilen des SDS übernommene (Fehl-) Wahrnehmung der chinesischen ›Kulturrevolution‹ einschließlich des Personenkults um Mao Tse-Tung als einer eigenständigen und selbsttätigen, antibürokratischen Massenbewegung ist nur vor dem Hintergrund einer Marx-Interpretation zu begreifen, die den subjektiven Faktor stark betonte.
Neben den genannten Autoren und den marxistischen, doch auch den anarchistischen ›Klassikern‹ (wie Bakunin) gingen bedeutende Einflüsse von der ›Kritischen Theorie‹ der Frankfurter Schule aus, insbesondere von Max Horkheimers Theorie des autoritären Staates und von den Schriften des in Berkeley lehrenden Herbert Marcuse, der die Freudsche Psychoanalyse in seine vom Marxismus inspirierte Gesellschaftstheorie einband. [19] Die Entdeckung bzw. Wiederentdeckung aller dieser Ansätze, wozu noch die ›Sexualpolitik‹ Wilhelm Reichs[20] zu rechnen ist, durch den SDS erfolgte nicht erst im unmittelbaren Vorfeld von ›1968‹, sondern über etliche Jahre hinweg. Mit den in Deutschland lehrenden Vertretern der Kritischen Theorie kam es seit 1967, als Jürgen Habermas im Hinblick auf Rudi Dutschkes Aktionismus und Voluntarismus von der Gefahr eines ›linken Faschismus‹ sprach,[21] zu Konflikten, die in manchen Fällen an Vatermord erinnern.
Obwohl der Graben insbesondere zu den mittleren und älteren Generationen der lohnabhängigen Bevölkerung in der Bundesrepublik tiefer blieb als in den meisten anderen Ländern Westeuropas, waren die überwiegend studentischen Revolutionäre von der Arbeitnehmerschaft doch nicht vollständig isoliert. Von der illegalen und im Herbst 1968 relegalisierten KPD/DKP und ihrem engeren Umfeld abgesehen, hatten sich in der tradierten Arbeiterbewegung linkssozialistische Kerne erhalten, die nun durch die Revolte belebt wurden, etwa im Funktionärskorps der IG Chemie, der IG Druck und der IG Metall, welche mit dem (allerdings noch vor-antiautoritären) SDS-Vorstand bei der seit 1965 forcierten Kampagne gegen die Notstandsgesetzgebung jahrelang direkt zusammenarbeitete. Der IG-Metall-Vorsitzende Otto Brenner, der legendäre »Eiserne Otto«, kam – nicht anders als Willy Brandt, aber im Unterschied zu diesem stärker traditionell-sozialistisch orientiert – aus der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAP), die, vereinfacht gesagt, am Ende der Weimarer Republik und ab 1933 in der Illegalität zwischen SPD und KPD stand.
Überall gab es in der 68er Bewegung auch ein werktätiges Element. In West-Berlin waren das, neben Einzelpersonen, etwa die mehrere Dutzend junge Männer umfassenden »Roten Bauarbeiter«, deren Sprecher mit ihrem übertrieben proletenhaften Auftreten das Entzücken mancher großen Versammlung erregten. Dazu kamen die zusammen selbst quantitativ nicht zu vernachlässigenden Veteranen der vorfaschistischen revolutionären Arbeiterbewegung, namentlich der sozialistischen und kommunistischen Splittergruppen, die sich mit dem nun wieder reichlich strömenden ›jungen sozialistischen Blut‹ gemein machen und von denen Einzelne ein gewisses Prestige genossen. Das gilt etwa für den Trotzkisten Oskar Hippe, zweimal jahrelang inhaftiert unter Hitler wie unter Stalin und unbeirrbar die ›Lehren der Geschichte‹ verkündend.[22] Praktisch am relevantesten wurde die Zusammenarbeit von Studenten, Oberschülern und Lehrlingen bzw. jungen Arbeitnehmern bei den wiederholten Protesten gegen Fahrpreiserhöhungen kommunaler Verkehrsbetriebe.
Unter dem Eindruck einer begrenzten Belebung selbstständiger Artikulationen sozialen Protests in der Industriearbeiterschaft – von den Demonstrationen gegen das Zechensterben im Ruhrgebiet 1966/67 bis zu den spontanen (›wilden‹) Septemberstreiks des Jahres 1969 – näherte sich übrigens auch der 1967/68 im SDS dominierende ›antiautoritäre‹ Flügel bezüglich der Bestimmung des ›revolutionären Subjekts‹ wieder traditionell-marxistischen, auf die ›historische Mission der Arbeiterklasse‹ gerichteten Positionen, nachdem einige Zeit wechselnde Theorien über die kommende große Verweigerungsrevolution der Intelligenz und der Randgruppen, der aus der industriellen Leistungsgesellschaft ›Herausgefallenen‹, ja der Jugendlichen und Kinder zumindest im Berliner SDS en vogue gewesen waren. Die partielle Wiederentdeckung der Arbeiterklasse wurde befördert durch die Bildung von Stadtteil-, später auch Betriebs-›Basisgruppen‹, die unter dem Schock des 2. Juni 1967 bzw. des Dutschke-Attentats vom 11. April 1968 und unter dem Eindruck der Isolierung von den breiten Schichten des Volkes überall entstanden.
Einen Anhaltspunkt für Aussagen über die soziale Zusammensetzung des Protests bieten die amtlichen Zahlen über Verhaftungen und Ermittlungsverfahren nach den Osterunruhen des Aprils 1968. Von 389 in Berlin Festgenommenen waren 122 Studenten und 35 Schüler, aber deutlich mehr, nämlich 232, Angehörige verschiedener Berufe. Von 827 Personen, gegen die in der Bundesrepublik insgesamt ermittelt wurde, waren 286 Studenten und 92 Schüler, hingegen 195 Angestellte, 150 Arbeiter und 31 Angehörige diverser sonstiger Berufe; 123 Personen waren ohne Beruf oder hatten einen unbekannten Beruf. Während der studentische Charakter der Unruhen somit deutlich zu relativieren ist, bestätigen die Zahlen den Generationsaspekt: Die große Mehrzahl der Verhafteten bzw. von einem Ermittlungsverfahren Betroffenen waren zwischen 19 und 25 Jahre alt. Dazu passen die Ergebnisse einer Anfang Februar 1968 vom Spiegel veröffentlichten Blitz-Umfrage unter 3.000 Studenten, Schülern und Berufsschülern zwischen 15 und 25 Jahren in Orten über 10.000 Einwohnern, der zufolge zwei Drittel und mehr in allen drei Kategorien Protestdemonstrationen junger Leute befürworteten; insgesamt 58 Prozent äußerten ihre Bereitschaft, selbst zu protestieren. Immerhin 27% der Befragten erklärten ihre Zustimmung zu den Positionen Rudi Dutschkes (oder was sie dafür hielten).[23]
Einer anderen Umfrage zufolge nahmen im Januar/Februar 1968 36%, im Juni/Juli gar 53% der Studenten an Demonstrationen teil; bei der nichtakademischen Jugend waren es nur 5%, die sich gemäß eigenen Angaben faktisch beteiligten. Nach einer weiteren, zu dieser Zeit erhobenen Repräsentativbefragung gaben 56% der Studenten und immerhin 25% der nichtakademischen Jugendlichen an, sehr stark oder stark politisch interessiert zu sein (Gesamtbevölkerung: 14%).[24]
Um es noch einmal auf den Punkt zu bringen: die 68er-Bewegung stieß bei der Mehrheit der Bevölkerung, auch der Arbeiterbevölkerung, in der Bundesrepublik auf distanzierte bis klar ablehnende, nicht selten auch aggressive Reaktionen. Es gelang ihr aber, binnen kurzer Zeit nicht nur die Mehrzahl der Studenten und wohl auch der älteren Gymnasiasten, sondern – mit Ausstrahlung auf weitere Kreise – zudem einen beträchtlichen Teil der Lehrlinge bzw. der jungen Arbeitnehmer zu gewinnen; manche von ihnen nahmen etwa in wachsender Zahl an den großen Teach-ins und Vollversammlungen teil, konnten Form und Inhalt der Aktionen allerdings bestenfalls in zweiter Linie bestimmen. Deren studentischer, vom Ursprung der Bewegung und von der Mehrzahl der Beteiligten geprägter Charakter blieb letztlich unverändert.
Ungeachtet dessen, dass sich die quantitative, räumliche und soziale Ausbreitung der von der Protestbewegung ausgehenden Impulse – sich niederschlagend auch in der Entstehung einer links-alternativen kulturellen Infrastruktur mit speziellen Kneipen, Buchläden, Kinos, auch Theatern (in Berlin das Kinder- und Jugendtheater Grips und die Schaubühne am Halleschen Ufer) – noch jahrelang fortsetzte, trat die Bewegung schon um die Mitte des Jahres 1968 in eine neue, durch Zerfaserung, Stagnation und Rückfluten einerseits, Radikalisierung und Sektenbildung andererseits gekennzeichnete Phase ein. Von der Vielgestaltigkeit des als APO auftretenden Spektrums war bereits die Rede. Selbst im organisatorischen Kern der Bewegung, im SDS, musste die – keinesfalls homogene – ›antiautoritäre‹ Tendenz mit einer – ebenfalls innerlich differenzierten, mancherorts, hauptsächlich in Köln und Bonn, an der illegalen KPD orientierten – ›traditionalistischen‹ Strömung koexistieren. Solange es aufwärts ging, gelang das einigermaßen.
Nachdem mit Rudi Dutschke der am meisten charismatische Führer ausgefallen war (Hans-Jürgen Krahl – er kam 1970 bei einem Autounfall ums Leben –, die zweite, Dutschke in vieler Hinsicht gleichrangige und theoretisch wohl überlegene Führungsgestalt der antiautoritären Mehrheit des SDS, [25] konnte ihn nicht ersetzen), nachdem die Aufbrüche des Pariser Mai und dann auch des Prager Frühlings gestoppt worden waren, nachdem schließlich die Notstandgesetze, ›NS-Gesetze‹ genannt, nicht hatten verhindert werden können (ohne dass sich die Vorraussagen über deren Benutzung gegen die Opposition in irgendeiner Weise zu bestätigen schienen), wurde das Fehlen mittel- und längerfristiger Konzepte offenkundig. Es breitete sich eine Stimmung der Ratlosigkeit aus, die sich auf der letzten SDS-Delegiertenkonferenz Mitte September 1968 in Frankfurt am Main in einem basisdemokratisch begründeten Dezentralisierungsbeschluss niederschlug, der mit dem Verzicht auf politische Intervention faktisch schon die Abdankung des Studentenverbandes bedeutete. In gewisser Weise war der SDS mit seinem unerwarteten Erfolg nicht fertig geworden.
Was folgte, war der totale Zerfall der 68er-Bewegung als einer relativ geschlossenen, wenigstens im Negativen einheitlichen. Die unterschiedliche bis absolut konträre Beurteilung des sowjetrussischen Einmarschs und der folgenden ›Normalisierung‹ in der Tschechoslowakei – die neugegründete, von der SED und der KPdSU abhängige DKP durfte keine Konzessionen an die links der Mitte weit überwiegende Kritik des sowjetischen Vorgehens machen – bildete nur die eine Spaltungslinie; und man muss konstatieren, dass die Belastung mit der ČSSR-Invasion wie mit dem Ostblocksystem überhaupt die DKP bzw. die SED Westberlins und ihre Nebenorganisationen in der Folgezeit nicht daran hinderte, etliche durch ›1968‹ politisierte oder anpolitisierte junge Menschen, oft aus Arbeiter- und Angestelltenfamilien, für sich zu gewinnen. Offenbar wirkten die – gerade wegen ihrer Dogmatisierung – etwas einfachere Weltsicht des Sowjetkommunismus und die Aussicht, sich einem mächtigen Fortschrittslager anzuschließen, auf nicht wenige junge Menschen attraktiv.
Deutlich stärker entwickelte sich indessen der Zustrom zur SPD. Die Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten, in der 1969 der linke Flügel das Ruder in die Hand nahm, konnte im Lauf von vier Jahren rund 100.000 neue Mitglieder rekrutieren, die in ihrer großen Mehrzahl nicht direkt aus der 68er-Bewegung kamen, aber doch, nach der bewussten Öffnung der Mutterpartei seit dem Nürnberger Parteitag vom März 1968, überwiegend davon beeinflusst waren.
Die Kerngruppen der 68er und viele Hinzukommende wollten weiterhin weder von der Sozialdemokratie noch vom Parteikommunismus Moskauer Provenienz etwas wissen. Statt dessen konstituierten sich seit Dezember 1968 (Gründung der KPD/ML zum 50. Jahrestag der KPD-Gründung) unterschiedliche maoistische (›marxistisch-leninistische‹) Gruppierungen die sich dann auf Bundesebene parteiförmig organisierten. Der völlige Bruch mit allem Antiautoritären – das war die Lehre, die sie aus ›1968‹ zogen – bedeutete den Übergang zu einem kruden Organisationsfetischismus und zur Anlehnung an die Ideologie und die Außenpolitik der KP Chinas bzw. der Partei der Arbeit Albaniens, überwiegend einschließlich der Rechtfertigung Stalins und der zunehmenden Negativfixierung auf die ›sozialimperialistische‹ Sowjetunion als Hauptfeind.
Gewiss authentischer wurde die Tradition der 68er-Bewegung von jenem Konglomerat anarchistischer, anarchosyndikalistischer oder rätekommunistischer, vielfach vom linksradikalen ›operaismo‹ Italiens beeinflusster, oft auch betont ›undogmatischer‹ und ›spontaneistischer‹ Organisationen, Zirkel und Basisgruppen fortgeführt, die sich bewusst dem Appell der ›K-Gruppen‹ zur straffen Organisierung und zum sofortigen Parteiaufbau entzogen. Eine feste revolutionäre Klassenkampforganisation würde – so nahm man an – allein im Prozess der kommenden sozialen Kämpfe entstehen können. In Berlin wurde aus der Idee linker Studenten, als Arbeiter in die Betriebe zu gehen, um dort politisch zu wirken, eine »Projektgruppe Elektroindustrie«, die dann zur »Proletarischen Linken/Parteiinitiative« (PL/PI) mutierte. Am anderen Ende dieses Spektrums tummelten sich in Berlin die »Umherschweifenden Haschrebellen«. In Frankfurt fand sich mit ähnlicher Zielsetzung und Arbeitsweise wie der der PL/PI der »Revolutionäre Kampf« (RK) zusammen, deren bekanntestes Mitglied Daniel Cohn-Bendit war, einer der Protagonisten des Pariser Mai, und zu der auch der spätere Außenminister Joseph Fischer gehörte. Anfang der 70er Jahre nahm sich der RK des Frankfurter ›Häuserkampfs‹ an.
Weniger spektakulär, weniger militant und nüchterner in der Einschätzung der Handlungsmöglichkeiten arbeitete das 1969 gegründete, in Offenbach angesiedelte »Sozialistische Büro« (SB), das auf die Koordinierung realer linker Aktivitäten in den diversen Bereichen der Gesellschaft orientierte, mit besonderem Augenmerk auf Großbetriebe und Gewerkschaften und ohne strikte Abgrenzung zur Sozialdemokratie, überdies zweifelsfrei demokratisch in der gesellschaftspolitischen Zielsetzung und inneren Struktur. Das SB strebte die Organisierung der westdeutschen Linken nach sozialen ›Interessen‹, nicht nach ›Köpfen‹ und vorgefertigten Programmen an und drückte damit das Selbstverständnis einer großen Zahl junger Sozialisten, auch außerhalb der Universitätsstädte, aus, die mit parteikommunistischer Stellvertreterpolitik so wenig anfangen konnten wie mit dem Ultraradikalismus, der Gewaltbereitschaft und dem Chaotismus eines Teils der ›Sponti‹-Szene.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz zählte 1971 fast 400 Organisationen der extremen Linken mit – unter Berücksichtigung von Doppelmitgliedschaften – 67.000 Mitgliedern; 1975 wurden sogar rund 140.000 Mitglieder gezählt, davon jeweils mehr als die Hälfte in der DKP und ihren Umfeldorganisationen.[26] Es wird deutlich, dass die Auffächerung der 68er-Bewegung mit ihren gut 2.000 SDSlern und einigen tausend weiteren Aktivisten von einer beachtlichen quantitativen Ausdehnung begleitet war.
Wenn man nach den Effekten der Protestbewegung der späten 60er Jahre in der Bundesrepublik fragt, dann lassen sich einige Gesichtspunkte mit hoher Plausibilität hervorheben:
– Die intransigente Opposition gegen die Notstandsgesetzgebung, obwohl sie die Haltung der SPD einschloss, stärkte faktisch die intensiven sozialdemokratischen, namentlich linkssozialdemokratischen Bemühungen um die rechtsstaatliche Einhegung und Entschärfung der betreffenden Gesetze.
– Obwohl vielfach ein gegenseitiges Hochschaukeln befürchtet worden war, brachte die parallel zur NPD zum relevanten politischen Faktor aufgestiegene APO die Rechtsextremen nicht in den Bundestag. Vielmehr trugen die unablässigen Störungen von NPD-Wahlkundgebungen im Bundestagswahlkampf 1969 dazu bei, dass die Nationaldemokraten mit Unruhe und Krawall assoziiert wurden statt wunschgemäß mit Gesetz und Ordnung. Bereits in den Jahren davor, als die NPD in mehrere Landtage einzog, gehörten Sprengungen und Störungen von Veranstaltungen dieser Partei zum festen Repertoire der APO; die Aktionen waren mit dafür verantwortlich, dass die Schaffung einer organisatorischen Struktur der NPD mancherorts erschwert oder sogar verhindert wurde.
– Ohne Zweifel bewirkte die Schubkraft des studentisch-jugendlichen Protests, dass sich das innenpolitische Klima in der Bundesrepublik weiter zugunsten von sozialem Engagement, Fortschrittsorientierung und Reformbereitschaft wandelte. 1971 erklärten drei Viertel der Befragten ihre Bereitschaft zu aktiver Mitarbeit an gemeinwohlorientierten Arbeiten.[27] Die staatliche Amnestie der meisten Demonstrationsdelikte im Jahr 1970 förderte die allgemeine Anerkennung von Demonstrationen als legitime Ausdrucksform oppositioneller Willensbekundung. Unbeabsichtigt bereitete die 68er-Bewegung die Regierungsübernahme der – von ihr scharf kritisierten – SPD-Führung im Bündnis mit der zeitweise sozialliberal geöffneten FDP mit vor.
– Auf die Durchsetzung des Demokratisierungsparadigmas seitens der Achtundsechziger ist schon hingewiesen worden. Die Parole Willy Brandts in der Antrittsrede als Bundeskanzler (28. Oktober 1969), die neue Regierung wolle »mehr Demokratie wagen«, griff die Intentionen der Protestbewegung auf und versuchte, sie für systemimmanente Reformen nutzbar zu machen. Von den 68ern hingegen ging die ›Veralltäglichung des Protests‹ aus, der seither zur Bundesrepublik gehört und in den partikularen Bürgerinitiativen und den ›Neuen Sozialen Bewegungen‹ der 70er und 80er Jahre seinen Ausdruck fand: hauptsächlich in der Frauenbewegung, der Anti-AKW- bzw. Umweltbewegung, der Hausbesetzerbewegung sowie in der um 1980 neu belebten Friedensbewegung. Die seit den späten 70er Jahren zu verzeichnenden Wahlkandidaturen von ›alternativen‹, ›bunten‹ und ›grünen‹ Listen auf Kommunal- und Landesebene sowie die folgende Etablierung der Bundespartei Die Grünen und damit die definitive Integration der Masse des Protestpotentials in das politische System resultierte letztlich aus diesem ununterbrochenen Prozess.
– Die spätestens seit dem Frankfurter Auschwitzprozess (1963-65) verstärkt in der Öffentlichkeit thematisierte, mehr und mehr als unzureichend empfundene strafrechtliche Ahndung von NS-Verbrechen und die anhaltende nationalsozialistische Belastung sämtlicher Funktionseliten der Bundesrepublik wurden von der Protestbewegung mit verstärkter Vehemenz, polemische Attacken nicht scheuend, beklagt. Kein Respekt vor der unabhängigen Justiz hinderte die Anhänger der APO daran, auch gegen formal einwandfrei zustande gekommene Gerichtsurteile auf die Straße zu gehen, so am 14. Dezember 1968 gegen den Freispruch des ehemaligen Besitzers beim Volksgerichtshof, Hans-Joachim Rehse, durch ein Berliner Schwurgericht. Die, in einem Fall auch physischen (Beate Klarsfelds Ohrfeige vom 7. November 1968), Angriffe auf das frühere NSDAP-Mitglied Bundeskanzler Kurt-Georg Kiesinger – eine nominelle Mitgliedschaft und somit ein vergleichsweise harmloser Fall – entlegitimierten nach dem angeblichen ›KZ-Baumeister‹ Bundespräsident Heinrich Lübke auch den zweiten führenden Repräsentanten des Staates, jedenfalls bei vielen jungen Leuten. Indem das drückende nationalsozialistische Erbe ins Zentrum des kollektiven Bewusstseins geholt und damit der zurückhaltende, teilweise auch abwehrende Umgang mit dieser Problematik in den 50er und frühen 60er Jahren überwunden werden sollte, stellten die 68er, darüber hinaus, die Legitimität des westdeutschen Staates und der westdeutschen Gesellschaft überhaupt in Frage. Faktisch wurden die bis dahin bestimmenden politischen Kräfte liberal-konservativer Färbung dadurch mehr getroffen als die diesbezüglich relativ unangefochtene SPD (mit einem früheren antifaschistischen Flüchtling und Illegalen an der Spitze, der gleichwohl um nationale Versöhnung bemüht war, jetzt aber auf einer neuen, wahrhaftigeren Grundlage).
– Zu den unmittelbaren Konsequenzen von ›1968‹ gehörte die Wiederbelebung marxistisch-sozialistischen Denkens in der Bundesrepublik – sowohl auf der politisch-publizistischen Ebene, hauptsächlich über die Jungsozialisten und ihre älteren Mentoren in der SPD, als auch auf der Ebene der Fachwissenschaften, wenngleich die Berufung von erklärten Marxisten, etwa in der Disziplin Volkswirtschaft, Ausnahme blieb; im akademischen Mittelbau sah es schon anders aus. Jedenfalls wurden marxistische Ansätze wieder zu einem Bestandteil der wissenschaftlichen und intellektuellen Debatten. Charakteristisch war dabei, neben der Enttabuisierung der seriösen Ergebnisse der ›parteilichen‹ Wissenschaft in der DDR und in Osteuropa, die Vielgestaltigkeit des Entdeckten und Wiederentdeckten, namentlich von Arbeiten dissidenter Kommunisten und Sozialisten aus der Zwischenkriegszeit und unabhängiger Linker, nicht zuletzt denen der Frankfurter Schule, aus den Jahren des Exils.
– Die gravierendste Folge der Studenten- und Jugendrevolte war die nachhaltige Politisierung der jungen Intelligenz nach links, nachdem gerade die deutschen Akademiker bzw. Studenten bis 1945 etwa 70 Jahre lang in großer Mehrzahl konservativ angepasst oder völkisch-nationalistisch eingestellt gewesen und in der Nachkriegszeit als desillusioniert-unpolitisch, als Angehörige einer ›skeptischen Generation‹ beschrieben worden waren.[28] In den meisten vergleichbaren Ländern war die politische Orientierung der bürgerlichen Intelligenz auch vor ›1968‹ weniger eindeutig konservativ als in Deutschland – teilweise gab es, so in Frankreich oder Nordeuropa, eine linksrepublikanische bzw. linksnationale Tradition in Teilen des Bürgertums. Die Grundtendenz der 68er-Bewegung, die Linksorientierung der insbesondere jungen, dann auch der älter werdenden Intelligenz einzuleiten oder zu bestärken, war indessen nicht auf Deutschland beschränkt. Während die Studentenbewegung mancherorts, vor allem in Frankreich und Italien, tatsächlich wie eine Art Detonator bei der kämpferischen Aktivierung und Radikalisierung erheblicher Teile der Arbeiterschaft wirkte (überdies die Abwendung der kommunistischen Parteien vom Moskauer Vorbild vorantrieben), kann davon in der Bundesrepublik kaum die Rede sein. Unter den führenden Industrieländern des Westens war der Abstand zwischen den linken Studenten und der, zumal älteren, Masse der Arbeiter wohl nur in den USA noch größer als in Westdeutschland.
Der beschleunigte soziale Wandel, der Übergang zum Konsumkapitalismus, und der damit verbundene, um die Mitte der 60er Jahre schubartig verstärkte Wertewandel führten zu jener, allerdings längerfristigen Mobilisierung, die Eric Hobsbawm als »kulturelle Revolution« bezeichnet; [29] diese betraf vor allem das Verhältnis der Geschlechter und das der Generationen. Die Krise der klassischen Kleinfamilie schlug sich in einer Zunahme von Ehescheidungen, unehelichen Geburten, sowie der wachsenden Zahl von Alleinerziehenden und allein Lebenden (›Singles‹) nieder. Die Etablierung einer neuen Jugendkultur als ›einer unabhängigen sozialen Kraft‹ verlieh der jungen Generation Macht über den Konsumwarenmarkt. Generell waren die 60er Jahre eine Zeit schneller Verbreitung elektronischer Massenmedien und des Übergangs von der Radio- zur Fernsehgesellschaft. Waren in der Bundesrepublik am Anfang des Jahrzehnts etwa ein Viertel aller Haushalte mit Fernsehgeräten ausgestattet, so an dessen Ende schon rund drei Viertel. Entgegen der Befürchtung vieler linker Fundamentaloppositioneller bedeutete Konsumgesellschaft nicht Entpolitisierung – im Gegenteil: Politisches Interesse und Reformbereitschaft nahmen in Westdeutschland seit den späten 50er Jahren kontinuierlich zu.
Die Bewertung all’ dessen liegt nicht auf der Hand; sie ergibt sich aus dem jeweiligen politisch-weltanschaulichen Standort des Betrachters. Das gilt bis zu einem gewissen Grad auch für den folgenden Versuch der Problematisierung an einigen, m. E. analytisch unabweisbaren Punkten:
– Mit dem aus dem Ruder laufenden, radikalen Antiautoritarismus und mit der Beförderung einer stimmungsmäßigen revolutionären Naherwartung (obwohl gerade Dutschke immer wieder die Langfristigkeit seiner Bewusstseins- und Verweigerungsrevolution betonte) machte der SDS als Kern der Bewegung die Elaborierung einer nüchtern kalkulierten, realistischen, Etappenziele einschließenden sozialistischen Strategie und Taktik unmöglich. Zugleich verhinderte das antiautoritäre Politik- und Organisationsverständnis die Schaffung effektiver, durchsichtiger, kalkulierbarer Strukturen, was gerade angesichts des exponentiellen Wachstums der Bewegung 1967/68 unabdingbar gewesen wäre, um das Erreichte zu konsolidieren. Die Entwicklung ab Sommer 1968, als die Protestbewegung erkennbar an ihre Grenzen stieß und sich Frustration breit machte, konnte so von den Protagonisten kaum noch beeinflusst werden.
– Der in den Jahren der Selbstbehauptung seit dem Unvereinbarkeitsbeschluss der SPD vom November 1961 politisch gereifte und zugleich gehärtete SDS war von dem eigenen Erfolg überfordert und außer Stande, die Dynamik der Revolte noch zu beherrschen oder sich wenigstens ihr gegenüber zu behaupten. Dazu kam ein Weiteres: Der emanzipatorische Aufbruch von 1967/68 beinhaltete neben dem politisch-gemeinschaftlichen Aspekt auch den der individuellen Befreiung und Selbstverwirklichung. Die Attraktivität der Bewegung bestand ja gerade in der Erwartung, anders als die tradierten, als langweilig und gegenüber ihren Mitgliedern als repressiv wahrgenommenen Organisationen der Linken, der ›Alten Linken‹, wie man auch sagte, beides verbinden zu können. Tatsächlich erwies sich dieses von Anfang an als schwierig bis unmöglich – die legendäre Westberliner Kommune 1 ist nur das bekannteste Beispiel für das Abgleiten in den Subjektivismus und Irrationalismus. Die Entfernung von den ›normalen‹ Menschen der Mehrheitsgesellschaft, die bei manchen geradezu zu einem Objekt der Verachtung wurden, hatten eben nicht nur ideologische Gründe, sondern beruhten mindestens gleichermaßen auf dem verabsolutierten Selbstverwirklichungsanspruch.
– Kritikwürdig ist ferner und nicht zuletzt die schrittweise Durchsetzung eines theoretisch schillernden und in der Praxis spielerischen Umgangs mit Gewalt. Die provokativen, doch gezielten und begrenzten Regelverletzungen in den Jahren vor 1968 – etwa bei Sit-ins oder nicht genehmigten Demonstrationen – waren Teil eines Mobilisierungskonzepts, das eventuelle strafrechtliche Folgen billigend in Kauf nahm, allerdings teilweise die Konfrontation regelrecht suchte. Rudi Dutschke kokettierte schon früh mit der Illegalität und dachte im Hinblick auf den Vietnamkrieg über Sabotageakte gegen die amerikanische bzw. NATO-Infrastruktur nach.[30] Die Osterunruhen 1968 in Reaktion auf das Dutschke-Attentat hatten bereits eine andere Qualität als die Demonstrationen des Vorjahres. Doch auch hier war die politische Botschaft – symbolische Verhinderung der Auslieferung von Zeitungen des Verlagshauses Springer, das für den Mordanschlag verantwortlich gemacht wurde – für jeden nachvollziehbar, selbst wenn er die Aktionen nicht billigte. Der Primat der Politik wurde noch gewahrt. Eine weitere Stufe der Eskalation bildete dann am 4. November 1968 die »Schlacht am Tegeler Weg«, als nicht mehr als 1.000 studentische und jugendliche Demonstranten anlässlich des Ehrengerichtsverfahrens gegen den über Jahre vielfach unentgeltlich oder gegen geringes Honorar verteidigenden APO-Anwalt Horst Mahler im Berliner Landgericht mit Schlagstöcken und einem wahren Steinhagel offensiv gegen die in der Minderheit befindlichen Polizeibeamten vorgingen. Einige der ob des ›Sieges‹ – die Polizei wurde zurückgedrängt und hatte weitaus mehr Verletzte zu beklagen als die Angreifer – euphorisierten Demonstranten entwickelten daraus eine regelrechte Offensivtheorie, der zufolge die beiseite stehenden Volksmassen niemals mit denen gehen würden, die sich in ihre Opferrolle fügten, sondern nur mit denen, die Stärke zeigten. Auch wenn man vielen der Beteiligten ehrliche Empörung über die beabsichtigte Ausschaltung ihres Rechtsanwalts und über frühere negative Erfahrungen mit unverhältnismäßigen, gelegentlich brutalen Polizeieinsätzen zugute halten mochte, trat hier, neben dem Kurz- und Fehlschluss bei der Situationseinschätzung – schließlich konnte eine vorbereitete Polizei jederzeit mit stärkeren Mitteln, im Extremfall auch mit Schusswaffen antworten – eine gewisse Verrohung und Gewaltverherrlichung zu Tage.
– Und dennoch: auch die »Schlacht am Tegeler Weg« war qualitativ etwas anderes als das, was sich 1970 in Gestalt einer »Rote-Armee-Fraktion« (RAF) als abgehobene ›Stadtguerilla‹ inszenierte, für die Verfolgungsbehörden eine ›terroristische Vereinigung‹, für die breite Öffentlichkeit die »Baader-Meinhof-Bande«. Als ich am 14. Mai 1970 im Radio die Nachricht von der mit Waffengewalt und nur um ein Haar ohne Todesopfer erfolgten Befreiung des (wegen der Frankfurter Kaufhausbrandstiftung vom 3. April 1968 verurteilten) Andreas Baader hörte – übrigens auch das ein Berliner Ereignis –, war mir sofort klar, dass hier eine bestimmte Gruppe den ›bewaffneten Kampf‹ aufgenommen hatte und alles versuchen würde, möglichst große Teile der außerparlamentarischen Linken hineinzuziehen. Ich hielt das Konzept, zumal unter bundesdeutschen Bedingungen, für politischen Wahnsinn – abgesehen davon, dass die meisten Aktionen selbstreferentiell waren – und war entschieden der Meinung, dass es für die Linke in allen ihren Schattierungen ein Gebot der Selbsterhaltung sei, sich dem zu verweigern. Das schloss keineswegs die Bereitschaft zur Kooperation mit der Polizei (sofern es dafür einen Anlass geben würde) ein, wohl aber die unzweideutige Zurückweisung jeglicher, selbst indirekter Hilfeleistung und Unterstützung für die ›Guerilla‹. Auch wenn einzuräumen ist, dass die Abgrenzung nicht überall so klar vorgenommen wurde, so darf man doch festhalten, dass der Kriegsplan der RAF, sofern man von einem solchen sprechen kann, nicht nur gegenüber Staat und Gesellschaft, dem ›Schweinesystem‹, sondern auch gegenüber dem vermuteten politischen Umfeld schon im Ansatz gründlich scheiterte. Es gab durchaus das Phänomen des engeren und weiteren – offenen und auch versteckten – Sympathisantentums, es hatte aber keineswegs jene Dimensionen, die ihm damals von dem hysterisierten Teil der Publizistik zugeschrieben wurde. Der Terrorismus der RAF war ein gravierendes inneres Problem der Bundesrepublik während der 70er Jahre; innerhalb der westdeutschen Linken, auch der radikalen Linken, stellte er qualitativ und quantitativ aber eher ein Randphänomen dar. Die Verbindung des RAF-Terrorismus (einschließlich verwandter Gruppen) zur 68er-Bewegung bestand, konkretisiert in personellen Kontinuitäten, darin, dass er zwar eine der in ›1968‹ enthaltenen Möglichkeiten realisierte, doch keineswegs die nächstliegende und schon gar nicht die logische oder aufgrund der Bewegungsdynamik zwingende. Nur unter dieser Prämisse macht die kritische Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zwischen den beiden Phänomenen ›1968‹ und ›RAF‹ Sinn.
– Einen heutzutage gelegentlich beschworenen ›linken Antisemitismus‹ im eigentlichen Sinn, nämlich die Juden in ihrer Eigenschaft als Juden abzulehnen, gab es auf Seiten der 68er-Bewegung meiner Erinnerung nach nicht, auch nicht in Andeutungen. Richtig ist, dass die etwa bis zum Sechstagekrieg im Nahen Osten (Juni 1967) eindeutig pro-israelische Haltung linksdeutscher Sozialisten, auch im SDS, einer, teilweise überzogenen, antiimperialistisch motivierten Kritik am Staat Israel mit antizionistischer Tendenz wich, bis hin zur Identifikation mit den linksnationalistischen, in der Wahl der Kampfmittel wenig skrupulösen und auf die Beseitigung Israels zielenden Organisationen der Palästinenser. Einige wenige 68er gingen so weit, selbst die jüdischen Einrichtungen in Deutschland (die sich traditionellerweise mit Israel identifizierten) als feindlich wahrzunehmen. Es wurde am 9. November 1969 – 31 Jahre nach dem Reichspogrom! – sogar ein Bombenattentat auf das jüdische Gemeindehaus in West-Berlin verübt.[31] Wenn man von Exzessen dieser Art absieht, bestand das Versagen der 68er-Bewegung eher in einer gewissen Nonchalance, einer verbreiteten Missachtung oder Verdrängung der besonderen deutsch-israelischen (als Teil der deutsch-jüdischen) Problematik. Es wäre jedoch eine Verzeichnung, die Haltung zu Israels Politik nachträglich zum zentralen Kriterium für die Beurteilung des Selbstverständnisses und des politischen Agierens der Protestbewegung zu machen.
– Der »Triumph des Individuums« (E. Hobsbawm), bei dem die 68er-Bewegung zumindest als kräftiger Verstärker diente, war weitgehend erfolgreich in seinem destruktiven Aspekt, die alten, tatsächlich vielfach repressiven, nichtökonomischen Gruppenbildungen und das ihnen zugrunde liegende moralische System zu untergraben und aufzulösen. Die zunehmend zerstreute Bewegung, die ja zugleich neue Formen der Vergemeinschaftung angestrebt hatte, konnte unter den Bedingungen eines weiterbestehenden – und seit den späten 70er Jahren wieder mehr und mehr entfesselten – Kapitalismus jedoch nicht verhindern, dass die von ihr einst ausgegangenen, zumindest verstärkten Impulse in pervertierter Form zur Durchsetzung eines schrankenlosen Individualismus ohne ethische Steuerung und soziale Einbindung beitrugen.
Und was ist mit den zahlreichen, bisher allenfalls am Rande erwähnten, lebensreformerischen Projekten und kulturrevolutionären Ansätzen, die das Bild von ›1968‹ mindestens ebenso sehr geprägt haben und die von vielen als das Wesentliche und Wirkungsvolle angesehen werden? Und mit der großen, majoritären Gruppe unter den Jungen, die mit der Bewegung in Berührung kamen und mehr oder weniger davon beeinflusst wurden, aber nur partiell oder sporadisch an Aktivitäten teilnahmen, die eventuell mehr die freiheitliche und befriedigende Gestaltung des eigenen Lebens als eine gesamtgesellschaftliche Veränderung im Auge hatten? Die Stichworte lauten ›Kommune‹- bzw. Wohngemeinschaftsexperimente, nicht- oder ›antiautoritäre‹ Erziehung, auch durch die neu gegründeten ›Kinderläden‹ und autonomen Jugend- bzw. Lehrlingszentren, sowie ›sexuelle Befreiung‹, nicht zuletzt durch Auflösung der lange fast unumgänglichen Verbindung von Sexualität und Ehe (begünstigt durch die seit Jahren verfügbare Antibaby-Pille), ferner das Ausprobieren ›bewusstseinserweiternder‹ Drogen und die Hinwendung zu der neuen, rebellischen Musikkultur des Rock, Beat und Folk. Auch die explosionsartig zunehmende Wehrdienstverweigerung und die grassierende Aufsässigkeit in Schulen und Lehrwerkstätten sind hier zu nennen. Schließlich die erst nach und nach durchschlagende Veränderung von vorpolitischen Einstellungen, alltäglichen Verhaltensweisen und Umgangsformen hin zu einer weniger autoritären und obrigkeitlichen, stärker permissiven, auch toleranteren, doch zugleich eben auch mehr individualistischen Mentalität der Gesellschaft insgesamt – einschließlich des negativen Bedeutungsgehalts dieser Bezeichnung.
Deutlicher als bei der im engeren Sinn politischen Protestbewegung (wobei die Vorläufer, wie angesprochen, auch dort bis in die frühen 60er Jahre zurückreichen) erscheint die ›Kulturrevolution‹ um 1968 als lediglich beschleunigende, gewiss auch eigene Akzente setzende, aber keine andere Qualität begründende Phase eines längerfristigen soziokulturellen Wandels in den entwickelten, kapitalistischen, parlamentarisch und in Europa zudem sozialstaatlich verfassten Ländern des Westens. Die Rede ist von der Periode zwischen den späten 50er oder den frühen 60er und den frühen oder mittleren 70er Jahren, für das die Zeithistoriker inzwischen die Bezeichnung der ›langen Sechziger‹ erfunden haben.[32] In unserem Zusammenhang ist es wichtig, sich zu erinnern, dass der soziokulturelle Wandel und insbesondere die emanzipatorisch-kulturrevolutionären Impulse auch die ›harten‹ politischen Aktivisten nicht unbeeinflusst und angesichts der manchmal damit verbundenen Komplikationen in den zwischenmenschlichen Beziehungen nicht immer ungeschoren ließen. So kam es zeitweise zu einer weitgehenden Überlappung, gelegentlich sogar Verschmelzung von politischer Opposition und jugendlicher Gegenkultur.
Auch wenn die evolutionäre ›Neujustierung‹ der westdeutschen Gesellschaft (wie auch, meist weniger scharf ausgeprägt, der westlichen Gesellschaften überhaupt) über einen längeren, etwa anderthalb Jahrzehnte umfassenden Zeitraum erfolgte, wurden die späten 60er Jahre von den Befürwortern des Neuen wie von den Widerstrebenden gleichermaßen als markerschütternder kultureller Umbruch erlebt. Dabei wirkte die mediale Teilnahme am Geschehen durch die Fernsehberichterstattung mit der für 1968 charakteristischen, ununterbrochenen Vergegenwärtigung diesbezüglicher, buchstäblich sensationeller Ereignisse enorm verstärkend. Die Radikalität und Ungeniertheit, mit denen sich die Achtundsechziger kulturell wie politisch artikulierten, ebenso wie die quantitative Ausbreitung der neuen Phänomene, vermittelten allgemein den Eindruck eines plötzlichen und wuchtigen Einschnitts.
Weiterführende Literatur
Willy Albrecht, Der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS). Vom parteikonformen Studentenbund zum Repräsentanten der Neuen Linken, Bonn 1994.
Klaus R. Allerbeck/ Leopold Rosenmayr (Hg.), Aufstand der Jugend? Neue Aspekte der Jugendsoziologie, München 1971.
Götz Aly, Unser Kampf. 1968 – ein irritierter Blick zurück, Frankfurt am Main 2008.
Günther Amendt (Hg.), Kinderkreuzzug oder Beginnt die Revolution in den Schulen?, Reinbek bei Hamburg 1968.
Arnulf Baring u. Mitarb. v. Manfred Görtemaker, Machtwechsel, Die Ära Brandt-Scheel, Stuttgart 1982.
Bedingungen und Organisation des Widerstandes. Der Kongress in Hannover. Protokolle, Flugblätter, Resolutionen. Mit Beiträgen von Helmut Gollwitzer u. a., Berlin 1967.
Uwe Bergmann u. a., Rebellion der Studenten oder Die neue Opposition. Eine Analyse, Reinbek bei Hamburg 1968.
Frank Böckelmann/ Herbert Nagel (Hg.), Subversive Aktion. Der Sinn der Organisation ist ihr Scheitern, Frankfurt am Main 1976.
Winni Breines, The Great Refusal. Community and Organization in the New Left 1962-1968, New Brunswick/ New York 1989.
Clayborn Carson, In Struggle. SNCC and the Black Awaking of the 1960s, Cambridge/ Mass 1981.
Lin Chun, The British New Left, Edinburgh 1993.
Werner Conze/ M. Rainer Lepsius (Hg.), Sozialgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Beiträge zum Kontinuitätsproblem, Stuttgart 1983.
Charles DeBenedetti /Charles Chatfield, An American Ordeal. The Antiwar Movement of the Vietnam Era, New York 1990.
Gerard J. DeGroot (Hg.), Student Protest. The Sixties and After, London/ New York 1998.
Claudia Derichs, Japans Neue Linke. Soziale Bewegung und außerparlamentarische Opposition, 1957-1994, Hamburg 1995.
Tilman P. Fichter/ Siegward Lönnendonker, Kleine Geschichte des SDS. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund von Helmut Schmidt bis Rudi Dutschke, 4. überarb. u. erg. Aufl., Essen 2007.
Carole Fink u. a. (Hg.), 1968: The World Transformed, Washington D.C./ Cambridge 1998.
Etienne François u. a. (Hg.), 1968 – ein europäisches Jahr ?, Leipzig 1997.
Norbert Frei, 1968. Jugendrevolte und globaler Protest, München 2008.
Bernd Gehrke/ Gerd-Rainer Horn (Hg.), 1968 und die Arbeiter. Studien zum „proletarischen Mai“ in Europa, Hamburg 2007.
Ingrid Gilcher-Holtey, »Die Phantasie an die Macht«. Mai 68 in Frankreich, Frankfurt am Main 1995.
Ingrid Gilcher-Holtey (Hg.), 1968 – Vom Ereignis zum Gegenstand der Geschichtswissenschaft, Göttingen 1998.
Ingrid Gilcher-Holtey, Die 68er Bewegung. Deutschland-Westeuropa-USA, München 2001.
Hermann Glaser, Die 60er Jahre. Deutschland zwischen 1960 und 1970, Hamburg 2008.
Jürgen Habermas, Protestbewegung und Hochschulreform, Frankfurt am Main 1969.
Ulrich Herbert (Hg.), Wandlungsprozesse in Westdeutschland. Belastung, Integration, Liberalisierung 1945-1980, Göttingen 2002.
Eric Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, München 1995.
Christina von Hodenberg/ Detlef Siegfried (Hg.), Wo ›1968‹ liegt. Reform und Revolte in der Geschichte der Bundesrepublik, Göttingen 2006.
Ingo Juchler, Die Studentenbewegung in den Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik der sechziger Jahre. Eine Untersuchung hinsichtlich ihrer Beeinflussung durch Befreiungsbewegungen und -theorien aus der Dritten Welt, Berlin 1996.
Michael Kimmel, Studentenbewegungen der 60er Jahre. BRD, Frankreich und USA im Vergleich, Wien 1998.
Christoph Kleßmann, Zwei Staaten, eine Nation. Deutsche Geschichte 1955-1970, Bonn 1988.
Gerd Koenen, Das rote Jahrzehnt. Unsere kleine deutsche Kulturrevolution 1967-1977, Köln 2001.
Wolfgang Kaushaar, Die Protestchronik der Bundesrepublik, 2. Bde., Hamburg 1996.
Wolfgang Kaushaar, 1968. Das Jahr, das alles verändert hat, München/ Zürich 1998.
Wolfgang Kaushaar (Hg.), Frankfurter Schule und Studentenbewegung. Von der Flaschenpost zum Molotowcocktail. 1948 bis 1995, 3 Bde., Hamburg 1999.
Wolfgang Kaushaar, 1968 als Mythos, Chiffre und Zäsur, Hamburg 2000.
Wolfgang Kaushaar (Hg.), Die RAF und der linke Terrorismus, 2 Bde., Hamburg 2006.
Wolfgang Kaushaar, Achtundsechzig. Eine Bilanz, Berlin 2008.
Jan Kurz, Die Universität auf der Piazza. Entstehung und Zerfall der Studentenbewegung in Italien 1966-1968, Köln 2001.
Gerd Langguth, Die Protestbewegungen in der Bundesrepublik Deutschland 1968-1976, Köln 1976.
Gerd Langguth, Mythos ´68. Die Gewaltphilosophie von Rudi Dutschke – Ursachen und Folgen der Studentenbewegung, München 2001.
Siegward Lönnendonker u. a. (Bearb.), Freie Universität Berlin. Hochschule im Umbruch, 5 Teile, Berlin 1973-83.
Siegward Lönnendonker u. a., Die antiautoritäre Revolte. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund nach der Trennung von der SPD, Bd. 1: 1960-1967, Wiesbaden 2002.
Robert Lumley, States of Emergency. Cultures of Revolt in Italy from 1968 to 1978, London 1990.
Jürgen Miermeister/ Jochen Staadt (Hg.), Provokationen. Die Studenten- und Jugendrevolte in ihren Flugblättern 1965-1971, Darmstadt 1980.
Zdeněk Mlynár, Der tschechoslowakische Versuch einer Reform 1968. Die Analyse seiner Theorie, Köln 1975.
Jaromír Navrátil (Hg.), The Prague Spring 1968. A National Security Archive Documents Reader, Budapest 1998.
Karl A. Otto, Vom Ostermarsch zur APO. Geschichte der außerparlamentarischen Opposition in der Bundesrepublik, Frankfurt am Main/ New York 1977.
Karl A. Otto (Hg.), Die außerparlamentarische Opposition in Quellen und Dokumenten (1960-1970), Köln 1989.
Keith A. Reader, The May 68 Events in France. Reproduction and Interpretations, Basingstoke u.a. 1993.
Roland Roth/ Dieter Rucht (Hg.), Neue soziale Bewegungen in der Bundesrepublik Deutschland, 2. überarb. u. erw. Aufl., Bonn 1991.
Erwin K. Scheuch (Hg.), Die Wiedertäufer der Wohlstandsgesellschaft. Eine kritische Untersuchung der »Neuen Linken« und ihrer Dogmen, Köln 1968.
Axel Schildt u. a. (Hg.), Dynamische Zeiten. Die 60er Jahre in den beiden deutschen Gesellschaften, Hamburg 2000.
Axel Schildt/ Detlef Siegfried (Hg.), Between Marx and Coca-Cola. Youth Culture in Changing. European Societies, 1960-1980, New York/ Oxford 2006.
Michael Schneider, Demokratie in Gefahr? Der Konflikt um die Notstandsgesetze. Sozialdemokratie, Gewerkschaften und intellektueller Protest (1958-1968), Bonn 1986.
Klaus Schönhoven, Wendejahre. Die Sozialdemokratie in der Zeit der Großen Koalition 1966-1969, Bonn 2004.
Venanz Schubert (Hg.), 1968. 30 Jahre danach, St. Ottilien 1999.
Marcia Tolomelli, »Repressiv getrennt« oder »organisch verbündet«. Studenten und Arbeiter 1968 in der Bundesrepublik Deutschland und Italien, Opladen 2001.
Fritz Vilmar, Strategien der Demokratisierung, 2 Bde., Darmstadt 1973.
Friedrich Voss, Die studentische Linke in Japan. Geschichte, Organisation und hochschulpolitischer Kampf, München 1976.
1 Vgl. zuletzt Ingrid Gilcher-Holtey, Die 68er Bewegung. Deutschland – Westeuropa – USA, München 2001 u. ö.; Wolfgang Kraushaar, Achtundsechzig. Eine Bilanz, Berlin 2008. Weitere einschlägige Titel (auch der genannten Autoren) im Literaturverzeichnis. – Die Fußnoten beschränken sich im Folgenden hauptsächlich auf den Nachweis von Zitaten, Titeln und Zahlenangaben.
2 Es gibt mindestens zwei sehr nützliche Hilfsmittel: Thomas P. Becker/ Ute Schröder (Hg.), Die Studentenproteste der 60er Jahre. Archivführer-Chronik-Bibliographie, Köln u. a. 2000; Philipp Gassert/ Pavel A. Richter (Bearb.), 1968 in West Germany. A Guide to Sources and Literature of the Extra-Parlamentarian Opposition, Washington 1998.
3 Vgl. zum deutschen Trotzkismus Peter Brandt/ Rudolf Steinke: Die Gruppe Internationale Marxisten (GIM), in: Richard Stöss (Hg.), Parteien-Handbuch. Die Parteien der Bundesrepublik Deutschland 1945-1980, Bd. 3 (Sonderausgabe), Opladen 1986, S. 1599-1647 (mit weiteren Literatur- und Quellenhinweisen).
4 Hauptsächlich nach: Sibylle Plogstedt (Red.), Der Kampf des vietnamesischen Volkes und die Globalstrategie des Imperialismus. Internationaler Vietnam-Kongress 17./18. Februar 1968 Westberlin, Berlin 1968; Tilman P. Fichter/ Siegward Lönnendonker, Kleine Geschichte des SDS. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund von Helmut Schmidt bis Rudi Dutschke, 4. überarb, u, erg, Aufl., Essen 2007, S. 182-186; Gilcher-Holtey, Die 68er Bewegung, S. 7ff.
5 Che Guevara, Schaffen wir zwei, drei, viele Vietnam. Brief an das Exekutivsekretariat von OSPAAL [= Organisation der Solidarität der Völker Afrikas, Asiens und Lateinamerikas], Berlin 1967.
6 Fichter/ Lönnendonker, Kleine Geschichte, S. 184.
7 Pars pro toto: Die in Anmerkung 4 genannte Aktivistin Sibylle Plogstedt war nach der ČSSR-Invasion einige Zeit inhaftiert, weil sie antistalinistische Sozialisten um Petr Uhl unterstützt hatte. Ich selbst wurde wiederholt von Gruppen tschechischer Studenten bzw. Flüchtlinge kontaktiert, die bewußt Rückhalt vor allem bei der Linken Westeuropas suchten. Es ist einzuräumen, dass die schnell abnehmende Bereitschaft der Mehrzahl auch der sowjetkritischen Linken, sich diesbezüglich längerfristig zu engagieren, vielfach Enttäuschung hervorrief.
8 Hartmut Zwahr, Die erfrorenen Flügel der Schwalbe. DDR und „Prager Frühling“. Tagebuch einer Krise, 1968-1970, Bonn 2007; Stefan Wolle, Der Traum von der Revolte. Die DDR 1968, Berlin 2008.
9 Auch als Buch erschienen: Georg Picht, Die deutsche Bildungskatastrophe, Olten/ Freiburg 1964.
10 Hochschule in der Demokratie. Denkschrift des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes zur Hochschulreform, Frankfurt am Main 1961 (2. überarb. Aufl. 1965).
11 Peter Gäng/Jürgen Horlemann, Vietnam. Genesis eines Konflikts, Frankfurt am Main 1966 u. ö.
12 Johannes Agnoli/ Peter Brückner, Die Transformation der Demokratie, Berlin 1967.
13 Oskar Negt, Demokratie als Lebensform, in: Neue Gesellschaft/ Frankfurter Hefte 3/2008, S. 37-41, hier S. 40.
14 Rudi Dutschke, Mein langer Marsch. Reden, Schriften und Tagebücher aus zwanzig Jahren, hg. v. Gretchen Dutschke-Klotz u. a., Reinbek bei Hamburg 1980; Rudi Dutschke, Jeder hat sein Leben ganz zu leben. Die Tagebücher 1963-1979, hg. v. Gretchen Dutschke, Köln 2003; Gretchen Dutschke, Rudi Dutschke. Wir hatten ein barbarisches, schönes Leben. Eine Biographie, Köln 1996; Ulrich Chaussy, Die drei Leben des Rudi Dutschke. Eine Biographie, Darmstadt 1983.
15 Hier zit. nach Herbert Ammon/ Peter Brandt, Patriotismus von links. Rückblick und Zustandsbeschreibung (1982), in: Peter Brandt, Schwieriges Vaterland. Deutsche Einheit. Nationales Selbstverständnis. Soziale Emanzipation. Texte von 1980 bis heute, Berlin 2001, S. 104-161, hier S. 152.
16 R.S. (= Rudi Dutschke), Zum Verhältnis von Organisation und Emanzipationsbewegung, in: Oberbaumblatt Nr. 5 v. 12.06.1967, S. 4. – Die Zuspitzung der öffentlichen Kontroversen anlässlich der Wendung einiger bekannter ehemaliger Achtundsechziger nach rechtsaußen führt von der eigentlichen Problematik weit weg. Vgl. etwa Horst Mahler u. a., Kanonische Erklärung zur Bewegung von 1968, in: Junge Freiheit Nr. 10 v. 05.03.1999; Erklärung „Wir waren nie Nationalisten“, in: Junge Welt v. 15.02.1999.
17 Frantz Fanon, Die Verdammten dieser Erde. Mit einem Vorwort von Jean-Paul Sartre, Frankfurt am Main 1966.
18 Rudi Dutschke in dem berühmten Interview mit Günter Gaus vom 8. Dezember 1967, hier zit. nach Gerd Langguth, Mythos ´68. Die Gewaltphilosophie von Rudi Dutschke – Ursachen und Folgen der Studentenbewegung, München 2001.
19 Theodor W. Adorno, Studien zum autoritären Charakter, Frankfurt am Main 1995; Max Horkheimer, Autoritärer Staat, in: Marxismuskollektiv (Hg.), Kritische Theorie der Gesellschaft III, Frankfurt am Main 1968; Herbert Marcuse, Eros und Kultur, Stuttgart 1957; Herbert Marcuse, Der eindimensionale Mensch, Neuwied 1967; Herbert Marcuse, Das Ende der Utopie, Berlin 1967.
20 Wilhelm Reich, Die sexuelle Revolution, Frankfurt am Main 1966.
21 Hier zit. nach Jürgen Habermas, Protestbewegung und Hochschulreform, Frankfurt am Main 1969, S. 148.
22 Oskar Hippe, „ ...und uns´re Fahn ist rot“. Erinnerungen an 60 Jahre in der Arbeiterbewegung, Hamburg 1979.
Bekannter wurde etwa, in Frankfurt wohnhaft, Heinz Brandt, Ein Traum, der nicht entführbar ist. Mein Weg zwischen Ost und West, München 1967; Knut Andresen, Widerspruch als Lebensprinzip. Der undogmatische Sozialist Heinz Brandt (1909-1986), Bonn 2007.
23 Christoph Kleßmann, Zwei Staaten, eine Nation. Deutsche Geschichte 1955-1970, Bonn 1988, S. 272; Fichter/Lönnendonker, Kleine Geschichte, S. 183.
24 Max Kaase, Die politische Mobilisierung von Studenten in der Bundesrepublik, in: Klaus Allerbeck/ Leopold Rosenmayr (Hg.), Aufstand der Jugend. Neue Aspekte der Jugendsoziologie, München 1971, S. 161; Detlef Siegfried, Vom Teenager zur Pop-Revolution. Politisierungstendenzen in der westdeutschen Jugendkultur 1959 bis 1968, in: Axel Schildt u. a. (Hg.), Dynamische Zeiten. Die 68er Jahre in den beiden deutschen Gesellschaften, Hamburg 2000, S. 582-623, hier S. 621.
25 Hans-Jürgen Krahl, Konstitution und Klassenkampf, Frankfurt am Main 1971.
26 Zahlen nach Langguth, Mythos ´68, S. 111.
27 Klaus Jürgen Scherer, Politische Kultur und neue soziale Bewegungen, in: Gert-Joachim Glaeßner u. a. (Hg.), Die Bundesrepublik in den siebziger Jahren. Versuch einer Bilanz, Opladen 1984, S. 71-91, hier S. 72.
28 Helmut Schelsky, Die skeptische Generation. Eine Soziologie der deutschen Jugend, Düsseldorf 1957.
29 Eric Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, München 1995, S. 402-431.
30 Einleitung von Gaston Salvatore/ Rudi Dutschke zu: Guevara, Vietnam; Gretchen Dutschke, Leben, S. 177ff.
31 Wolfgang Kraushaar, Die Bomben im Jüdischen Gemeindehaus, Hamburg 2005.
32 So etwa Christina von Hodenberg, Detlef Siegfried, Reform und Revolte. 1968 und die langen sechziger Jahre in der Geschichte der Bundesrepublik, in: dies. (Hg.), Wo „1968“ liegt. Reform und Revolte in der Geschichte der Bundesrepublik, Göttingen 2006, S. 7-14.