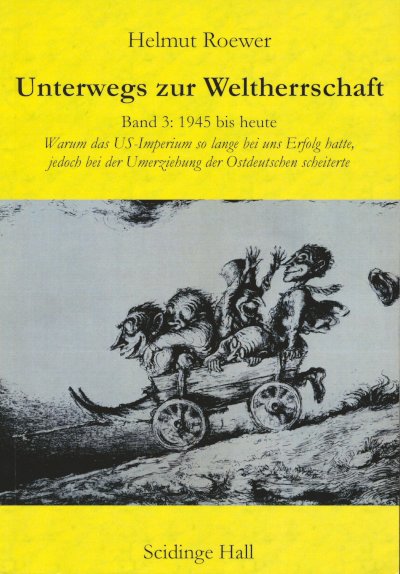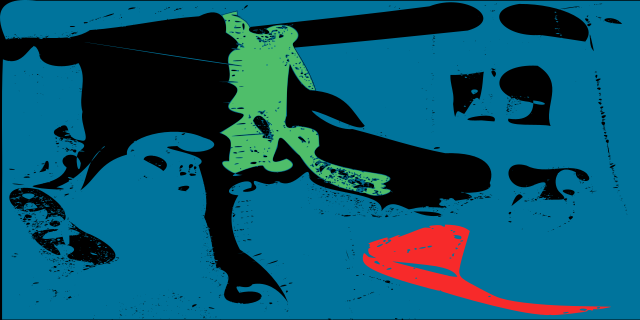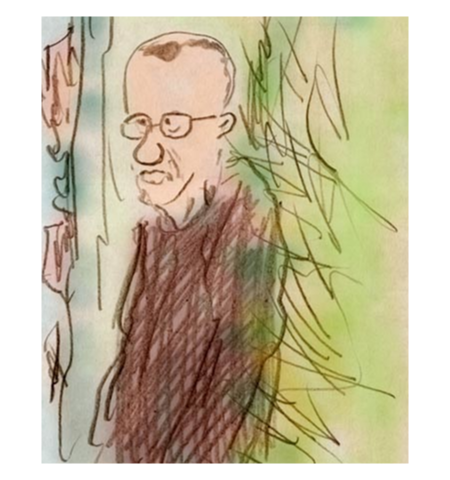von Herbert Ammon
Vergessene Opfer des Krieges. Leidenserinnerungen von Deutschen aus Ostpreußen
I.
Geschichtliche Erinnerung ist alles andere als die gemeinsam geteilte Vergegenwärtigung der Vergangenheit. Vielmehr findet sie auf unterschiedlichen, ja separaten Ebenen statt: in den Werken der Historiker, in der historischen Selbstwahrnehmung einer Nation oder einer Volksgruppe sowie, sehr viel weniger sichtbar, im Bewusstsein - und Unterbewusstsein – von Individuen. Für Millionen Menschen ist die Geschichte des 20. Jahrhunderts erfüllt von Erinnerungen an Krieg, Tod, Zerstörung und Vernichtung.
Dessen ungeachtet wird ihren spezifischen traumatischen Erlebnissen in der Mehrzahl unserer Geschichtsbücher kaum mehr als ein paar Fußnoten eingeräumt. Erschüttert von so vielen grauenvollen Bildern aus der NS-Vergangenheit und dem Holocaust vor Augen, zögern wir insbesondere, eine solche Feststellung zu treffen, wenn es darum geht, Deutsche in der Rolle von Opfern zu erkennen. Doch immerhin erinnern Historiker wie Ian Kershaw (in seinem: The End. Hitler´s Germany, 1944-45, erstmals 2011) oder Giles MacDonogh (After the Reich. The Brutal History of Allied Occupation, 2007) an die Folgen der fehlgeschlagenen Verschwörung gegen Hitler am 20. Juli 944: Unzählige Leben wären gerettet worden, viele Städte in all ihrer Schönheit wären vor Zerstörung bewahrt worden, der Massenmord in den Konzentrationslager hätte ein Ende gefunden.
Im Gegensatz zu derart empathischer Haltung ist im heutigen Deutschland eine Tendenz zu erkennen, die Erinnerung an Leiden und Not, wie sie Millionen Deutsche während und nach dem II. Weltkrieg erfuhren, gering zu veranschlagen, wenn nicht aus der geschichtlichen Erinnerung auszublenden. Als Jörg Friedrich, als Historiker des Holocaust mit Preisen ausgezeichnet, in seinem Buch Der Brand (erstmals 2002) die entsetzlichen Wirkungen der Flächenbombardements auf deutsche Städte als Strategie der Alliierten schilderte, kam von Kritikern der Vorwurf, es gehe ihm um die ›Relativierung‹ der deutschen Kriegsschuld und der Naziverbrechen. Konfrontiert mit der totalen Katastrophe ihres Landes unter Hitler, sehen sich viele Deutsche offenbar in einem historischen Minenfeld gefangen. Nicht wenige Intellektuelle haben für sich den einfachen Ausweg gewählt zu verkünden, die Deutschen hätten bekommen, was sie verdient hätten. Zynismus in moralischer Verkleidung gehört zu den beliebten Instrumenten einiger politischer Aktivisten. In aggressivster und primitivster Form wird er auf Spruchbändern sogenannter ›antifaschistischer‹ Gruppen sichtbar, die in Dresden mit Parolen wie ›Bomber Harris, Do It Again!‹ agieren.
II.
Vor diesem Hintergrund tritt der Name Freya Klier als der einer Autorin von unbestechlicher Integrität hervor, ausgewiesen durch ihre Lebensgeschichte. 1950 in Dresden geboren, wurde sie 1953 in ein Kinderheim eingewiesen, nachdem ihr Vater im Gefolge des Aufstands am 17. Juni 1953 inhaftiert worden war. In jungen Jahren sah sie ihren Bruder, der die Machthaber mit seiner Vorliebe für die Musik der Beatles ›provoziert‹ hatte, zum letzten Mal in einer psychiatrischen Klinik, ehe er dort seinem Leben ein Ende setzte. 1968 landete sie nach einer missglückten ›Republikflucht‹ selbst im Gefängnis. Auf bitter absurde Art und Weise, verhalf ihr der Tod des Bruders zur Freilassung und Zulassung zum Theater- und Schauspielstudium. Als eine der Vorkämpferinnen der unabhängigen Friedensbewegung in Ostdeutschland wurde sie 1988 verhaftet und in die Bundesrepublik ausgewiesen. Nach dem Fall der Berliner Mauer – für ihren Beitrag zu deren Sturz gebührt Freya Anerkennung – begann ihre Karriere als Schriftstellerin und Dokumentarfilmerin.
Freya Kliers Arbeiten gelten den menschlichen Opfern unmenschlicher Geschichte. In einem ihrer ersten Bücher schrieb sie über Frauen, die während des II. Weltkriegs in Ravensbrück, dem Konzentrationslager achtzig Kilometer nördlich von Berlin, den Naziärzten zu qualvollen ›medizinischen Versuchen‹ dienten. Danach folgte sie den Spuren der deutschen Frauen, die im Gefolge des Vormarsches und Sieges der Roten Armee im östlichen Mitteleuropa ihren Familien und Kindern entrissen und ›bis ans Ende der Welt‹, zur Zwangsarbeit nach Sibirien oder andernorts in der Sowjetunion deportiert wurden. Nicht zufällig drückt der Kommentar eines Lesers auf Amazon die paradoxe aber gleichwohl richtige Empfehlung aus: ›Das habe ich als über 60-jähriger alles nicht gewusst! Unglaublich, was da im Krieg alles passiert ist. Sehr lesenswert!‹
III.
In ihrem jüngsten Buch richtet Freya Klier das Augenmerk auf die ›letzten Kinder von Ostpreußen‹. Sie rückt die Biographien von drei Männern und vier Frauen in den Blick, die in der östlichsten der infolge des II. Weltkriegs verlorenen deutschen Provinzen geboren wurden. Zur Schilderung des Unheils, das 1944/45 über Ostpreußen hereinbrach, stützt sie sich auf deren persönliche Erinnerungen – im Falle Michael Wiecks auch auf dessen Autobiographie – sowie auf historische Literatur.
Wir erfahren die Lebensgeschichte von Karla Browarcyk, die nach Vollendung dieses Buches im Jahr 2014.starb. Sie war die Tochter eines unerschütterlichen Kommunisten, der in einem Versteck in Hafennähe Panzerfäuste lagerte, fest entschlossen, der Roten Armee bei der Befreiung von der Nazi-Herrschaft beizustehen. Er starb im Februar 1944, durch den Tod davor bewahrt, die realen Umstände der Befreiung zu erleben. Mit ihrer Mutter und ihren fünf Geschwistern durchlebte Karla, die zweitälteste, das Inferno der britischen Luftangriffe auf Königsberg gegen Ende August 1944. An die 5000 Einwohner wurden getötet und 200 000 verloren ihre Wohnungen, als die Bomben die alte Krönungsstadt Preußens in Schutt und Asche legten.
Mit 2,2 Millionen Soldaten eröffnete die Rote Armee ihre Winteroffensive am 12. Januar 1945. Sie zerschlug die deutschen Linien entlang der gesamten Ostfront. In den Folgewochen erteilten die Nazi-Behörden – nach meist unsinnig langer Verzögerung – in Ostpreußen und anderswo die Befehle zu Evakuierung – ehe sie sich selbst absetzten, wie der ostpreußische Gauleiter Erich Koch auf einem kleinen Eisbrecher. Karlas Mutter brachte ihre Kinder nach Rauschen, einem der Seebäder nahe Königsberg. Das Krankenhaus, in dem sie Quartier gefunden hatten, wurde bombardiert. Am nächsten Morgen fand die Mutter ihr jüngstes Kind tot vor – erfroren.
In den folgenden Wochen, Monaten, Jahren, verlor Karla zuerst einen weiteren Bruder. Er starb an Typhus. Danach starb ihre Mutter an depressiver Erschöpfung im Alter von 43 Jahren. Zuvor hatte sie eine andere Tochter einer estnischen Frau übergeben, die versprach, sich um das Kind zu kümmern. Roswitha-Anna Browarcyk wuchs in Tallinn als Anne Avik auf – ihre Geschichte erscheint in dem Buch als eine der weniger bedrückenden Episoden. Im Jahr 1946 waren Karla Browarcyk und ihr elfjähriger Bruder Peter allein. Die beiden gehörten zu den Tausenden von ›Wolfskindern‹, die als verlorene Waisen, dem Hungertod nahe – die sowjetischen Behörden meldeten Fälle von Kannibalismus – durch die verwüstete Landschaft streiften und sich in den Wäldern oder verlassenen Dörfern verbargen. Eine Anzahl von ihnen ging nach Litauen hinüber, wo sie von Bauern versteckt und adoptiert wurden. Nicht selten führten ihre Retter – wie auch deren lettische und estnische Nachbarn – einen Partisanenkrieg gegen die sowjetrussischen Besatzer. Im Sommer jenes Jahren saß Karla auf dem Sims eines Kellerfensters und wartete auf ihren Bruder, der nach Litauen auf Nahrungssuche gegangen war. Zufällig kam ein Offizier vorbei, versprach dem dem Mädchen etwas zu essen und vergewaltigte die Achtjährige. Ihr Bruder kam nie zurück. Jahre später erfuhr Karla, dass man ihn wegen eines Hakenkreuzes auf der Gürtelschnalle als jungen Nazi verdächtigt und erschossen hatte.
Zur frühen Lebensgeschichte von Doris Meyer, geboren als Einzelkind einer frommen preußischen Familie gehören folgende Szenen: Sie erlebte die Belagerung und die Kapitulation Königsberg (am 9. April 1945) in einem Luftschutzkeller. Das achtjährige Kind sah, wie eine polnische Frau von ihren vermeintlichen Befreiern nach oben gezerrt wurde und mit zerrissenen Kleidern, vergewaltigt, wieder zurückkam. Eine paar Tage später wurde Doris von einer Horde entmenschter Soldaten zu einer Scheune geschleppt, wo man ihr die Siegestrophäen vorführte: die verstümmelten Leiber vergewaltigter Frauen.
Jahrzehnte danach, als die russische Menschenrechtsorganisation Memorial Veteranen befragte, wollte keiner eingestehen, irgendwelche Grausamkeiten erlebt, geschweige denn begangen zu haben. Dessen ungeachtet sind derlei Szenen von Alexander Solschenyzin in den Versen seines berühmten Gedichtes Ostpreußische Nächte festgehalten worden. Bei diesem Gesamtbild gab es Ausnahmen, wie wiederum Doris Meyer selbst berichtet. In einem Dorf unweit von Königsberg traf sie mit ihrer Mutter, die sich auf Schneiderarbeiten verstand, auf eine Einheit mit disziplinierten Soldaten, mit denen sie sich anfreundete.
Brigitte Possienke wurde in Schuditten, dreißig Kilometer westlich von Königsberg geboren, als jüngste Tochter eines wohlhabenden Bauern, der – als deutscher Patriot, aber nicht nazistisch – als Bürgermeister des Dorfs fungierte. Als die Ostfront näher rückte, wurde er zum ›Volkssturm‹, Hitlers letzter Reserve von geringem militärischen Nutzen, eingezogen. Jahre später wurde er als ›vermisst‹ gemeldet. Bei Müttern mit Kindern wurden Ausnahmen gemacht, als wegen des Mangels an Männern Frauen und junge Mädchen zur Deportation nach Russland erfasst wurden. Die Familie Possienke ließ man auf einer soeben errichteten Militärsowchose arbeiten. Dort musste die vierjährige Brigitte zusahen, wie ihre Mutter an Typhus starb. Sodann erkrankte ihre älteste, acht Jahre alte Schwester Edith. Man brachte sie in ein notdürftig hergerichtetes ›Krankenhaus‹. Dort sah Brigitte sie zum letzten Mal in katatonischem Zustand, ehe sie ein paar Tage später erfuhr, dass die Schwester gestorben war.
Eine Zeitlang beabsichtigten Stalins neue Herrscher im nördlichen Ostpreußen, die verbliebenen Deutschen in ihrer Heimat zu belassen und Sowjetpatrioten aus ihnen zu machen. Da man sie im neu errichteten Militärbezirk alsbald als potenzielle Spione verdächtigte, schalteten die Sowjets 1947 in Richtung Deportation der Deutschen um. In den Jahren 1947/48 wurden diese Überlebenden, meist Frauen und Kinder, eingesammelt und nach Westen in die Sowjetzone gebracht. Bürokratisch genau listete der Abschlussbericht eines sowjetischen Generals 102 125 Ausgesiedelte auf (274). Die Züge verließen Königsberg mit je 2000 Menschen, die Fahrt in Viehwaggons dauerte bis zu einer Woche. Eine Anzahl der Abgeschobenen überlebte wegen hohen Alters und körperlicher Schwäche die Fahrt nicht. Bei Aufenthalten der Züge wurden die Leichen einfach auf dem Bahndamm abgelegt.
Nach Ankunft in Frankfurt/Oder wollten Brigitte Possienke und ihre älteste Schwester Birgit sich entkleiden, um sich von Schmutz und Läusen zu reinigen. Da brachen sie in Schreie aus, denn ihre zerschlissenen Kleidungsstücke waren an den offenen Wunden ihres Körpers festgeklebt. Als Karla Browarcyk, zu der Zeit neun Jahre alt, in Eisenach (der Geburtsstadt Johann Sebastian Bachs in Thüringen) ankam, schätzte sie der sie untersuchende Arzt auf fünf Jahre, befand sie damit als noch nicht schulreif. Die Behörden waren sehr darum bemüht, Adoptiveltern für die verwaisten Kinder zu finden. Vielfach wurden die Jungen von den adoptionsbereiten Eltern übergangen, aus Furcht, im nächsten Krieg einen weiteren Sohn zu verlieren. Folglich nahmen sie lieber Mädchen.
IV.
Gegenüber den anderen Biographien sticht Michael Wiecks Geschichte des Überlebens in mancherlei Zügen hervor. Geboren im Jahr 1928, wuchs Michael in einer bekannten Musikerfamilie auf. Väterlicherseits führt sein Name auf Clara Wieck zurück, die Pianistin und Gattin Robert Schumanns. Seine Mutter, jüdischer Herkunft, war die Musiklehrerin Hannah Arendts in Königsberg. Nach der Machtübernahme durch die Nazis wurde Michael als ›Halbjude‹ von einer Lehrerin gedemütigt und von Mitschülern geschlagen. Als Junge stand er nach dem Novemberprogrom 1938 vor der ausgebrannten und geschändeten Synagoge. Während seine Schwester Miriam dank einer Quäker-Hilfsorganisation die Ausreise nach Großbritannien glückte, blieb der Rest der Familie in Königsberg zurück. Bis zum Kriegsende mussten Michael und seine Mutter, als Ausgestoßene mit dem Judenstern, zwangsweise in einer Chemiefabrik arbeiten.
Die sowjetischen Soldaten, denen die Wiecks erstmals in einer überfüllten Kellerruine begegneten, zeigten nicht das geringste Interesse an ihrer Geschichte als Überlebende der NS-Verfolgung. Die Michael verhörenden Geheimdienstoffiziere des NKWD scherten sich nicht um den Ausweis, der ihn und seine Mutter als Juden kennzeichnete, und stellten ihn als jungen deutschen Soldaten unter Verdacht. Im Mai 1945 wurde er verhaftet und in eine Wehrmachtskaserne gebracht, die jetzt als NKWD-Lager für nahezu viertausend Gefangene diente. Michael fand sich in einem stinkenden Keller wieder, zusammen mit anderen ›Verdächtigen‹, meist alten Männern. Dem Verhungern nahe, hatte er jede Überlebenshoffnung bereits aufgegeben, als man ihn herausrief und zurück nach Königsberg brachte, wo er seine Eltern in tiefer Verzweiflung wiederfand. Später im Jahr bekam Michael wie viele andere Malaria. Er verbrachte fünf Monate in einem Krankenhaus, in dem russisches und deutsches Personal zusammenwirkten, um diejenigen zu retten, die in dem furchtbaren Winter 1945/46 noch eine Überlebenschance hatten. Für viele schwanden diese Chancen, nachdem die Militärverwaltung durch Zivilbehörden ersetzt wurde. Die Ärzte in dem Hospital mit dem alten deutschen Namen ›Barmherzigkeit‹ gaben Anweisung, in den Ruinen und Wiesen um Königsberg jegliche Art von essbaren Pflanzen zu sammeln.
In einem der letzten Züge, die 1948 das nördliche Ostpreußen mit Deutschen verließen, wurden Michael und seine Eltern – die einzigen, die älter als 60 Jahre waren – in die Sowjetische Zone gebracht, wo sie in einem Quarantäne-Lager bei Potsdam landeten. Michael gelang die Flucht nach West-Berlin, wo er die Endphase der Berliner Blockade erlebte. Er bestand die Aufnahmeprüfung für das Konservatorium und begann nach seinem Abschluss an der Berliner Hochschule der Musik seine Karriere als bekannter Violinist.
Michael Wieck war von Bitterkeit erfüllt, als er 1992 Kaliningrad besuchte. Die auf Ruinen errichtete neue Stadt mit 400 000 Einwohnern hatte keine Ähnlichkeit mit dem Königsberg von einst, wie er es kannte. Erfüllt von Erinnerungen an eine glückliche Kindheit, sinnt er über die unerbittliche Logik der Geschichte nach: »Hätte der ›20. Juli1944‹ zur Beendigung des Krieges geführt, wäre Königsberg unzerstört geblieben, die ostpreußische Bevölkerung nicht geflohen und die Voraussetzungen für eine russische Totalvereinnahmung der Stadt gar nicht vorhanden gewesen...« (410)
V.
Siegfried Matthus – in der DDR wurde er zu einem namhaften Dirigenten und Komponisten – wurde 1934 in einem Ort nur zehn Kilometer von dem berüchtigten Nemmersdorf geboren. Es handelt sich um eines der beiden Dörfer unweit der Grenze zu Litauen, mit denen die sowjetischen Truppen erstmals siegreich deutsches Gebiet erreichten und furchtbare Grausamkeiten an den Zivilisten verübten. Die Greueltaten vom 21. Oktober 1944 wurden entdeckt, als deutsche Truppen die Gegend im äußersten Osten des Reiches zurückeroberten. Die Nazi-Propaganda nutzte die Szenen, um Widerstand ›bis zum letzten‹ gegen den ›asiatisch-bolschewistischen Feind‹ zu mobilisieren.
Matthus' Vater besaß einen Bauernhof. Einer Familientradition entsprechend spielte er auf seinem Akkordeon Polka und sang populäre Lieder bei Festivitäten in den Dörfern oder in der Kreisstadt Darkehmen (1938 umbenannt in Angerapp). Nachdem seine Mutter es mit der Familie über das zugefrorene Haff auf ein Schiff geschafft hatte, brachte sie in Danzig ein Baby zur Welt. Dort half Siegfried die mit 84 Jahren gestorbene Großmutter zu beerdigen. Die achtjährige Schwester übernahm die Führung auf der weiteren Flucht nach Westen, als die Mutter dem Tode nahe schien. In Pommern starb die neugeborene Schwester. Im Durcheinander von Flüchtlingstrecks, zurückflutenden deutschen Truppen und vorstoßenden sowjetischen Panzern wurde Siegfried von seiner Mutter und seinen drei Geschwistern getrennt. Seine Odyssee endete in Mecklenburg, wo er 1946 mit seiner Familie vereint wurde – einschließlich des Vaters, der Ende 1944 eingezogen, den Krieg überlebte hatte.
Siegfried Matthus hatte das Glück, die Oberschule im nahegelegenen Rheinsberg (bekannt als Lieblingsort des jungen Friedrich des Großen) zu besuchen und von dort seine außergewöhnliche Musikkarriere zu beginnen. Was die verlorene Heimat in Ostpreußen anbelangt, so gab es in den frühen Jahren kaum Zeit für Heimweh. Die Familie war damit beschäftigt, sich eine neue Existenz auf einem kleinen Hof aufzubauen, den man ihnen als ›Umsiedlern‹ – der in der Sowjetzone geprägte Euphemismus für die Heimatvertriebenen aus dem Osten – zugeteilt hatte. »Die Sehnsucht nach unserem Dorf in Ostpreußen, die kam erst später auf, als es uns schon etwas besser ging.« (238)
Dank des Geschicks eines DDR-Filmteams gelang es Matthus, damals 58 Jahre alt, im September 1988 erstmals den Ort seiner Kindheit in der militärischen Sperrzone Kaliningradskaja oblast wiederzusehen. In dem halbzerstörten Dorf standen noch einige Gebäude, darunter sein altes Schulhaus. Andernorts können die Menschen, die heute für einen Besuch zurückkehren, keine Spur ihrer früheren Wohnstätten wiederfinden, da in jenem Teil Ostpreußens an die dreitausend Dörfer verschwunden sind, teils ausgelöscht im Krieg, teils abgerissen, um als Nutzfläche der schlecht bestellten sowjetischen Kollektivlandwirtschaft zu dienen.
Nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Zusammenbruch der Sowjetunion kehrte Matthus mehrfach als Dirigent nach Königsberg zurück. Wie viele andere Deutsche aus den einstigen Ostgebieten engagiert er sich für Versöhnung und für freundschaftliche Kontakte mit den neuen Einwohnern von Kenigberga, wie junge Russen ihre Stadt mit deutscher Vergangenheit häufig wieder bezeichnen.
Matthus spricht offen über gewisse politische Aspekte der heutigen Situation. Die deutsche Regierung hat nie irgendwelches Interesse gezeigt, Verbindungen zu den heute in der Region lebenden Russen zu knüpfen oder zu stärken. In nicht geringem Maße geschieht dies aus Rücksicht auf Empfindlichkeiten in Polen und Litauen, wo man bezüglich des russischen Keils an der Ostseeküste eigene Ambitionen pflegt.
VI.
Ungeachtet aller Unterschiede in Herkunft und späterer Lebensgeschichte haben die ›letzten Kinder von Ostpreußen‹ einen biographischen Grundzug gemein: In keiner Weise verantwortlich für das, was ihnen in ihrer Kindheit widerfuhr, unschuldig im vollen Sinne des Wortes, wurden sie zu hilflosen Opfern von Krieg und Gewalt. In mancherlei Hinsicht stehen sie für die grausame Absurdität und die Paradoxien der Geschichte. Obgleich tief verwundet an Leib und Seele, brachten sie es auf irgendeine Weise fertig, wieder in die ›Normalität‹ des Lebens einzutreten. Trotz wiederkehrender traumatischer Erinnerungen blieb ihnen anhaltende Verzweiflung und psychische Depression erspart. Auf der anderen Seite erfahren wir von Birgit Possienke, dass ihre Schwester Birgit, einst in den Jahren der Qual und des Leidens die Stärkere, sich nie mehr von den Wunden erholte, die ihr in der Kindheit zugefügt wurden. Für den Rest ihres Lebens verharrte sie in einem Zustand psychischen Leidens. Ähnlich neigte Siegfried Matthus' Schwester zeitlebens zu Depressivität.
Freya Klier gelingt es, die psychologischen Aspekte einer leidvollen Vergangenheit zu verdeutlichen. Mit Intuition und Sensibilität zeichnet sie die westdeutsche Atmosphäre der 1950er Jahre nach. Zu jener Zeit hegte die große Mehrheit der Flüchtlinge – keineswegs willkommen und oft bespöttelt von ihren glücklicheren Landsleuten im Westen – noch die Hoffnung auf Rückkehr in die ›Heimat‹ im Osten. In der DDR aufgewachsen, verfügt Freya auch über eine präzise Wahrnehmung der ›Achtundsechziger‹-Generation. Die Studentenbewegung in Westdeutschland war bewegt von einer Mischung aus Abscheu angesichts der Nazi-Verbrechen und moralischem Hochmut gegenüber der Elterngeneration, die den Blick auf die Vergangenheit scheute. Darüberhinaus war die Studentenrevolte von Ideologie geprägt und von absurden Fehlwahrnehmungen der Wirklichkeit, einschließlich weitgehender Gleichgültigkeit gegenüber dem Unterdrückungsregime in der DDR.
Zu Freya Kliers Technik gehört die Verknüpfung der autobiographischen Zeugnisse mit den jeweiligen geschichtlichen Phasen, so ihre Behandlung der ›Generation von 1968‹ mit der ›Erzählung‹ von Ostpreußen. In dem Kapitel Hippies gegen Faltenrock-Ordnung. 1960er Jahre nimmt sie das entsetzliche Thema des Massakers von Palmnicken, das sie zuvor in Die große Winterschlacht. 1945 abgehandelt hat, wieder auf. Als angesichts des Zusammenbruchs der deutschen Front Evakuierungsbefehle für die Zivilbevölkerung ergingen, befanden sich noch etwa siebentausend Juden, Überlebende aus Fabriken und Lagern, in der Region. Sie wurden von einem SS-Kommando in Königsberg zusammengezogen und – mit ihren dünnen Häftlingskleidern am Leib und Holzspantinen an den Füßen – durch Eis und Schnee an die Ostseeküste getrieben. In einem Prozess, der 1967 in Lüneburg gegen einige der am Palmnicken-Massaker beteiligte Täter stattfand, sagte ein Zeuge aus, der auf einer kurzen Strecke seines Weges zu seiner ›Volkssturm‹-Einheit dreihundertsechsundachtzig Leichen gezählt hatte. Die SS beabsichtigte, alle Gefangenen in dem Bernsteinwerk von Palmnicken zu ermorden. Dem Bergwerksdirektor Hans Feyerabend gelang es, den Plan drei Tage lang zu verhindern. Als er erkennen musste, dass die SS ihn getäuscht hatte und die Mordaktion in Gang setzte, erschoss er sich. Nur wenige Menschen in Deutschland kennen Feyerabends Namen, der im November 2015 von der Gedenkstätte Yad Vashem als ›Gerechter unter den Völkern‹ geehrt wurde. (Naomi Bader: Mut und Menschlichkeit, in: Jüdische Allgemeine Zeitung v. 15.11.2015, http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/24023. In dem Artikel heißt es, die Umstände von Feyerabends Tod seien bis heute nicht geklärt.)
VII.
Freya schreibt nicht als Historikerin. So unterlaufen ihr, gestützt auf Sekundärquellen, ein paar Ungenauigkeiten. Was beispielsweise die Vereinbarungen von Jalta (vom 11. Februar 1945) anbetrifft, so werden darin im Wortlaut keine »Einflußsphären« benannt (192-193). Diese Interpretation als der ›Teilung Europas‹ war unter den polnischen Dissidenten der 1980er Jahre eine populäre Formel. Zudem – so abstoßend der Gedanke, Opferzahlen zu zerlegen, auch erscheinen muss – umfasst die Ziffer von sechs Millionen toten Polen die Millionen ermordeter polnischer Juden (138).
Geboten ist vom Thema her die Frage nach den Ursachen. Übten sich die brutalisierten Truppen der Roten Armee – es gab bemerkenswerte Ausnahmen – schlicht in Vergeltung? Die deutschen Invasoren verübten mehr als nur ein paar Greueltaten. Ein Beispiel gibt der Bericht einer weißrussischen Krankenschwester, die ansehen musste, wie psychisch Kranke von SS-Leuten aus der Klinik gezerrt und in einen Lastwagen gesteckt wurden, wo sie durch Auspuffgase zu Tode gebracht wurden.(130)
Freya ist bedacht, die Geschichten schrecklichen Leidens, erlitten von unschuldigen deutschen Kindern, in die historische Perspektive zu rücken. Als Autorin ist sie sich jedoch der Vergeblichkeit – und der unmoralischen Arroganz – jeglichen Bemühens bewusst, menschlichem Leiden irgendeinen anderen Sinn zu geben als das aus Krieg und menschlicher Unmenschlichkeit entstandene Leiden darzustellen.