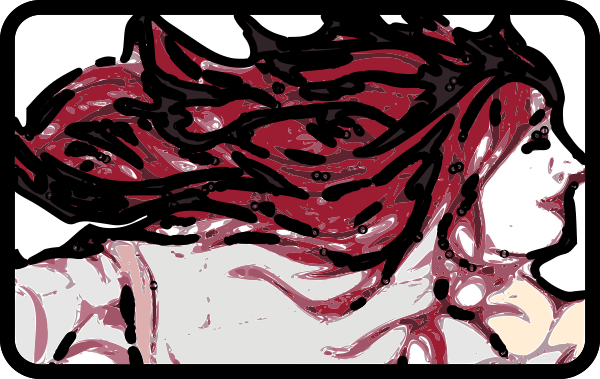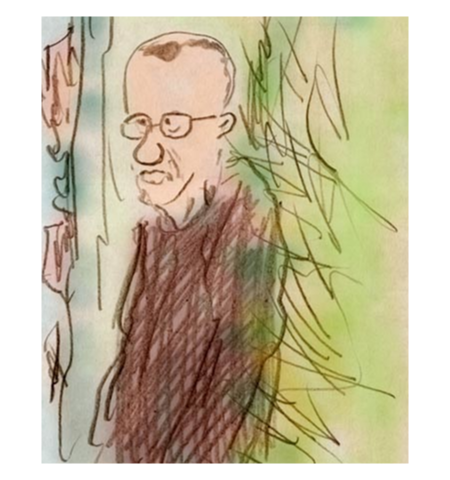von Siegfried Heimann
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges hieß es leider zu Recht: „Der Kaiser ging, die Generäle blieben…“ Es stellte sich freilich schnell heraus, dass nicht nur die Generäle geblieben waren: In Schulen und Universitäten, in Verwaltungen und in der Justiz der Weimarer Republik waren Monarchisten und andere Feinde der Demokratie zu Hauf zu finden. Sie alle in ihren einflussreichen Ämtern zu lassen, sollte sich als einer der Geburtsfehler der Weimarer Demokratie erweisen.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war es nur scheinbar anders. Die größten Verbrecher, einschließlich des „Führers“ waren tot. Viele Andere aber wollten nur „Beihilfe“ geleistet, „nur“ Befehle ausgeführt oder „nichts gewusst“ haben. Die Alliierten drängten auf eine Entnazifizierung, sie blieb in Ost und West halbherzig und wurde schließlich im Westen zugunsten des neuen Verbündeten im Kalten Krieg, der wiederbewaffneten Bundesrepublik, ganz eingestellt. „Einmal muss doch Schluss sein mit der Vergangenheitsbewältigung“ hieß es schon in den fünfziger Jahren in einer ständig wiederholten Parole. Widerspruch dagegen gab es, aber er wurde wenig gehört in der bundesrepublikanischen Gesellschaft, die dem platten Antikommunismus als Gründungsideologie verpflichtet war.
Dann aber gab es Anfang 1960, vorbereitet bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 1959, einen kleinen Paukenschlag: Am 25. Januar 1960 stellte Reinhard Strecker gegen 43 schwer belastete ehemalige Nazi-Richter Strafanzeige. Der Bundesvorstand des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) hatte ihn dazu aufgefordert. In den Medien wurde der schon zuvor erhobene Vorwurf wiederholt, der SDS und vor allem Strecker betreibe das Geschäft der DDR.
Aber der Reihe nach: Seit Ende 1958 suchte und fand Strecker Dokumente über in der Bundesrepublik weiterbeschäftigte oder gar schon pensionsberechtigte Juristen, die im „Dritten Reich willfährige Diener bis hin zum Verbrechen“ (Strecker) gewesen waren. Es ging ihm weniger um die einzelnen Biographien, sondern um Beispiele für die Tätigkeit der nazistischen Sondergerichte, Kriegsgerichte und des Volksgerichtshofs. Die Strafanzeige sollte die Justiz der Bundesrepublik zwingen, eine „Selbstreinigung“ – so Streckers illusionäre Hoffnung – zu beginnen. Die Dokumente fand er zunächst vor allem in der DDR (der „Ausschuss für deutsche Einheit der DDR half dabei aus sicher nicht uneigennützigen Gründen, er hatte schon Anfang 1959 eine Broschüre veröffentlicht mit dem Titel: „Wir klagen an. 800 Nazi-Blutrichter – Stützen des Adenauer-Regimes“), später auch in Polen, der Tschechoslowakei und schließlich auch in Israel.
Der Berliner Landesverband des SDS, in dem Strecker Mitglied war, half, die Dokumente zu sichten, die Echtheit zu prüfen und lange Namenslisten zu erstellen. Im Februar 1959 beschloss der Konvent der Freien Universität Berlin auf Antrag von Reinhard Strecker eine Unterschriftensammlung „für eine Petition an den Bundestag zum Thema nationalsozialistischer Richter, Staatsanwälte und Ärzte“. Nach wenigen Tagen hatten über 2000 Studenten unterschrieben. Im Juli 1959 entschied die Bundesdelegiertenkonferenz des SDS in Göttingen, die von Strecker vorbereitete „Aktion gegen nationalsozialistische Juristen, die heute in der Bundesrepublik Ämter bekleiden“ zu unterstützen. Alle SDS-Hochschulgruppen sollten in ihren Universitäten diese Aktion – sie trug nun den Namen: „Ungesühnte Nazijustiz“ – unterstützen. Die Zeit drängte, denn am 8. Mai 1960 drohte die Verjährung der Verbrechen. Deshalb sollte die inzwischen vorbereitete Ausstellung zuerst in Karlsruhe, dem Sitz des Bundesverfassungsgerichts, gezeigt werden. Die SDS-Gruppe der TH Karlsruhe bereitete zusammen mit Reinhard Strecker die Ausstellung in der Stadthalle vor, sammelte unter den Genossen der SPD, deren Mitglied sie waren, Geld und am 27.November 1959 fand die Eröffnung statt.
Aber wenige Tage zuvor distanzierte sich der SPD-Parteivorstand von diesem Vorhaben. Die Partei könne die Aktivitäten nicht billigen, da „deren Hintermänner und Absichten nicht bekannt“ seien. Der Vorwurf, die „Hintermänner“ säßen im „Osten“, war damit in der Öffentlichkeit und hatte sofort Folgen. Die Ausstellungsräume wurden gekündigt, im Karlsruher Lokal „Krokodil“ konnte die Ausstellung nur unter sehr erschwerten Umständen weiter gezeigt werden. Die drei SDS-Verantwortlichen aus Karlsruhe wurden im Januar 1960 nach § 29 (Sofortausschluss) aus der SPD ausgeschlossen.
Aber Strecker und der SDS gaben nicht auf. Nun sollte die Ausstellung in Berlin gezeigt werden. Die Hakenkreuzschmierereien an der Kölner Synagoge am 24. Dezember 1959 – zwei Mitglieder der Deutsche Reichspartei waren die Täter – offenbarten die Aktualität des Vorhabens. Der Konvent der FU Berlin beauftragte den Asta, dafür Sorge zu tragen, dass die Ausstellung „Ungesühnte Nazijustiz“ in den Räumen der FU stattfinden kann. Kurz darauf kam es zur bereits erwähnten Strafanzeige Streckers gegen 43 ehemalige Nazi-Richter. Die Ausstellung an der FU sollte folgen. Aber die Universitätsleitung verweigerte die Nutzung von Räumen der Universität. Die Bezirksämter der Stadt wurden in „Vertraulichen Briefen“ des CDU-Justizsenators Valentin Kielinger gewarnt, die Anfragen der Ausstellungsmacher positiv zu bescheiden.
Unverhofft kam Hilfe. Die private Kunstgalerie Springer am Kurfürstendamm stellte ihre Räume kostenlos für die Ausstellung zur Verfügung. Der Inhaber Rudolf Springer widersetzte sich ohne Zögern auch dem sofort einsetzenden politischen Druck, seine Zustimmung zurückzuziehen. Ein Kuratorium mit so bekannten Namen wie Professor Helmut Gollwitzer, Propst Heinrich Grüber, Günther Grass und mehrere studentische Gruppen unterstützten die Ausstellungsmacher. Professor Wilhelm Weischedel und Professor Ossip Flechtheim waren Sprecher des Kuratoriums, die sich bald auch gegen Diffamierungen in der Presse zur Wehr setzen mussten. Am 23. Februar 1960 wurde die Ausstellung „Ungesühnte Nazijustiz“ eröffnet. Bis zur Schließung Anfang März kamen rund 8000 Besucher in die Ausstellung, darunter auch eine Gruppe von ausländischen Journalisten, die auf Einladung des Auswärtigen Amtes Berlin besuchten. Bei einem abendlichen Empfang beim Regierenden Bürgermeister Willy Brandt waren sie des Lobes voll über die mutige Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit.
An der Haltung der SPD im Bund und in Berlin gegenüber dem SDS änderte das freilich nichts. Die SPD trennte sich von einem großen Teil seiner akademischen Jugend und seiner nicht allzu vielen sozialdemokratischen Professoren, die den SDS weiter fördern wollten. Die Mitgliedschaft im SDS wurde durch Beschluss des Parteivorstandes unvereinbar mit der Mitgliedschaft in der SPD. Der zeitgleich entstehende parteifromme Sozialdemokratische Hochschulbund (SHB) fand zunächst wenig Zulauf. Der Berliner SDS hatte bald mehr Mitglieder als zuvor. Im Frühjahr 1960 traten über 60 Berliner Studenten in den SDS ein, darunter der Verfasser dieser Zeilen.
Die Ausstellung Ungesühnte Nazijustiz“ war trotz oder gerade wegen der Diffamierungsversuche ein voller Erfolg und bleibt bis heute mit dem Namen Reinhard Strecker verbunden.
Da Strecker oft unterstellt wurde, mit der maßgeblich von ihm erarbeiteten Ausstellung das Geschäft der DDR betrieben zu haben, nahm er schon 1960 deutlich zu diesen Vorwürfen Stellung. Er wusste natürlich, dass auch in der DDR – er nannte sie in übrigen hin und wieder „Deutsche-Sowjet-Republik“ – ehemalige Nazis lebten. Aber – so sagte er: „Ein kommunistischer Staat lässt sich wohl kaum reformieren. Ich versuche mich in dem Staat, dem ich angehöre. Bei uns wird häufig darauf geschlossen, bei uns sei alles gut, weil doch verschiedenes auf der anderen Seite so schlecht sei… Wir haben eine Demokratie, die von ihrem Ideal weit entfernt ist“ (Reinhard Strecker in einer in Jerusalem geschrieben Stellungnahme am 20.10.1960). Das überzeugte wohl auch die Berliner SPD: Reinhard Strecker wurde noch im Jahre 1960 von der Steglitzer SPD in die Partei aufgenommen. Er konnte daher auch nicht, wie oft behauptet wurde, wegen seiner Aktivitäten für die Ausstellung „Ungesühnte Nazi-Justiz“ aus der SPD ausgeschlossen werden, da er ihr Ende 1959/Anfang 1960 noch gar nicht angehört hatte.
Der Hinweis darauf ist wichtig, da die SPD im Bund und in Berlin in jener Zeit, in der das „Prinzip der Geschlossenheit“ hochgehalten wurde, wenig zimperlich war, Parteimitglieder aus der Partei reihenweise auszuschließen. Die SPD wollte nach der erneuten Niederlage in der Bundestagswahl 1957 endlich Wahlen gewinnen. Innerparteiliche Opposition störte das Bild einer auch programmatisch gewandelten Partei und Ausschluss war eine beliebte Methode besonders in der Berliner SPD, unliebsame Querdenker aus der Partei zu entfernen. Dazu kam die schwierige Situation in Berlin nach dem Chruschtschow-Ultimatum im Jahre 1958. Die Freiheit Westberlins war ernsthaft bedroht. Die Unterstützung durch die Bundesregierung durfte nicht gefährdet werden, in Berlin regierte trotz einer absoluten Mehrheit der SPD eine große Koalition mit der CDU, die noch mehr als die Berliner SPD jeden Kontakt mit Ostberlin als Zurückweichen vor der „kommunistischen Bedrohung“ zu ahnden bereit war.
Freilich war die SPD zumindest im eigenen Selbstverständnis nicht bereit, Vorwürfe gegen die Bundesrepublik wegen vieler, allzu vieler ehemaliger Nazis in verantwortlichen Stellen in Verwaltung, Justiz und Regierung als bloße Propaganda des „Ostens“ abzutun. Bezeichnend ist ein „Aktenvermerk“ Egon Bahrs für seinen Chef Willy Brandt aus dem April 1960: „Wir haben weder gegenüber der Bundesrepublik noch gegenüber dem Ausland ein Interesse daran, eine schlechte Position Bonns zu decken, was die Einstellung gegenüber der braunen Vergangenheit einzelner angeht“.
Auch Reinhard Strecker war schon damals nicht bereit, dass angeblich Schaden nehmende Ansehen der Bundesrepublik im Ausland als Argument zu akzeptieren, um die Augen zuzumachen vor den vielen „Würdenträgern“ der Bunderepublik, die während der Nazidiktatur nicht nur Mitläufer gewesen, sondern an schweren Verbrechen beteiligt waren. Strecker half so schon als junger Student mit, dem „Schlussstrich-Denken“ entgegenzutreten und das „Labyrinth des Schweigens“ aufzubrechen.
Reinhard Strecker, seit über 55 Jahren Mitglied der SPD, hat sich um die Demokratie in Deutschland verdient gemacht.