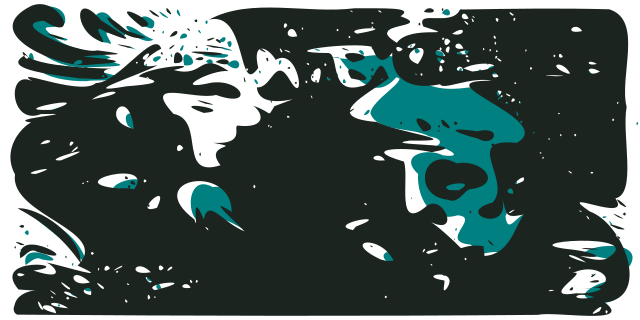von Peter Brandt
Identität, verstanden als das subjektive Gefühl sozialer Zugehörigkeit, innerer Stimmigkeit und biographischer Kontinuität, ist eine Grundkategorie der Humanwissenschaften, namentlich der Psychologie. Nicht unumstritten ist der Begriff der ›kollektiven Identität‹ von Sozialgruppen, insbesondere solchen ethnischen bzw. nationalen Charakters, doch halten ihn die meisten Autoren für unverzichtbar und sehen durch ihn ein elementares Konstruktionsprinzip auch moderner Gesellschaften beschrieben.
Das Bewusstsein bzw. die Empfindung wesentlicher Gemeinsamkeiten entsteht in einem Prozess der Vergemeinschaftung durch (alltägliche) Kommunikation, politisch-gesellschaftliche Erfahrung und Erinnerung, Letztere nicht nur notwendigerweise selektiv, sondern auch durchwoben von (günstigenfalls emanzipatorischen) Mythen.
Kollektive Identitäten sind nichts Statisches, vielmehr einem ständigen Wandel unterworfen, der dem sozialen Wandel folgt. Im Hinblick auf das Vereinigte Europa in statu nascendi liegt der höhere Abstraktionsgrad eines eventuellen Identitätsbewusstseins auf der Hand, da die enge historische und kulturelle Verbundenheit der Nation, in der Regel auch über eine gemeinsame Hochsprache und u.U. die Vorstellung gemeinsamer Abstammung, fehlt. Die kulturelle Vielfalt, die Differenz, kann geradezu als ein zentrales Wesensmerkmal Europas bezeichnet werden, das die Europäische Union ausdrücklich der Erhaltung und des Schutzes für wert erachtet, ja darin eine ihrer Bestimmungen sieht.
Gerade das Offen-Halten, das Vermitteln in verschiedene Richtungen sei, so wird teilweise argumentiert, typisch europäisch, so dass man in einer bestimmten ›römischen‹ Aneignungshaltung aus einem Gefühl der Zweitrangigkeit heraus, sei es gegenüber dem originären Griechentum, sei es – als spätantike und mittelalterliche christliche Kirche – gegenüber dem originären Judentum, das Vorbild einer »exzentrischen Identität« Europas, sieht (Brague 1993). Dabei ist unübersehbar, an dieser Stelle aber auch nicht entscheidend, dass sich weder die Griechen noch die Römer des klassischen Altertums als Europäer verstanden.
Ein anderer Zugang zum Problem der europäischen Identität eröffnet sich, wenn auf den inzwischen erreichten Kohäsionsgrad der wirtschaftlich-sozialen Verflechtung und entsprechender Kommunikationsbeziehungen jedenfalls West- und Westmitteleuropas (mit zunehmender Einbeziehung Ostmitteleuropas) abgehoben wird; diese machen es plausibel, von der Existenz einer europäischen Gesellschaft zu sprechen, die sich seit dem späten 19. und namentlich seit dem mittleren 20. Jahrhundert herausgebildet hat, während eine europäische Öffentlichkeit und ein europäischer Demos offenkundig erst ansatzweise existieren.
Nicht zu unterschätzen ist der innereuropäische Massentourismus, und generell zeigen Lebensstile und Alltagshabitus (Essgewohnheiten, Wohnformen, Freizeitverhalten usw.) Anzeichen einer »hybriden« Europäisierung, einer gewissen Identitätsvermischung, deren Triebkraft der (für die Gemeinwesen keineswegs unproblematische) allgemeine Individualisierungsprozess ist (Kaschuba 1995). Zugleich werden vielfach nationale staatliche Horizonte gewissermaßen von unten, regional und lokal, aufgeweicht, ohne dass sich daraus die politische Perspektive eines postnational föderierten Europas der Regionen ableiten ließe.
Um die Einstellungen der Bürger der EU-Staaten zu Europa, ihre emotionale Unterstützung des Einigungsprozesses, zu untersuchen, sind im »Eurobarometer« seit Jahrzehnten breit gefächerte Befragungen durchgeführt worden. Als in der zweiten Hälfte der 70er Jahre alternativ nach dem vorrangigen Zugehörigkeitsempfinden zur Gemeinde oder Stadt, zur Region, zum Land, zu Europa und zur Welt gefragt wurde, wiesen die Muster der Antworten europaweit keine großen Unterschiede auf. Zwei Drittel und mehr setzten ihre Stadt und ihr Land (und zwar, mit Ausnahme Großbritanniens, in dieser Reihenfolge) vor Europa und die Welt. An diesen Platzierungen änderte sich im Lauf der 80er Jahre wenig. 1990 lag – wie zehn/fünfzehn Jahre zuvor – die lokale Einheit durchweg an erster Stelle, an zweiter das Land (in Deutschland die Region). Europa gelangte nirgendwo in den prozentual zweistelligen Bereich; meist wurden keine fünf Prozent erreicht, während das Vaterland zu durchschnittlich knapp 30 Prozent präferiert wurde.
Daneben hatte man nach 1979 aber das Frageformat geändert, weil die europäische Identität in der Regel offenbar nur in Verbindung mit der jeweiligen nationalen Identität vorkam. Denn es hatte sich gezeigt, dass nicht Europa und die Nation in der Wertigkeit konkurrierten, sondern der beschränkte lokale Horizont mit dem weiteren, der schon im Nationalstaat und umso mehr im europäischen Verbund einen abstrakteren Zugang zu gesellschaftlichen Problemen verlangte.
In den 80er und dann noch einmal in den 90er Jahren hat man die Fragen an diese Erkenntnisse angepasst und Doppelidentifikationen als eine mögliche Antwort angeboten. In den hier zugrunde liegenden Eurobarometern bis Mitte der 2000er Jahre bestätigt sich, dass – mit erheblichen, die Kernaussage aber nicht berührenden Unterschieden von Land zu Land und bei kurzfristigen, eher konjunkturellen Schwankungen – sich nur etwa ein Zehntel der Befragten Europa allein oder hauptsächlich zugehörig fühlt. Rechnet man diejenigen hinzu, die die nationale Verbundenheit zwar an die erste Stelle setzen, sich aber zugleich als EU-Bürger verstehen, ist immerhin eine Größenordnung europafreundlicher Stimmen zwischen der Hälfte und zwei Dritteln zu vermelden (2004: 57 %). Eine ausschließliche Nationalidentifikation artikulieren immer noch zwei Fünftel. – Übrigens bestätigen die Untersuchungen der Eurobarometer insofern das Vorhandensein eines elitären Bias europäischer Identität, als, jedenfalls für den Zeitraum 1983 bis 1991, eine deutliche Korrelation mit dem Bildungsgrad, dem Einkommen und der Urbanität gegeben ist. Trotz der somit nicht nur theoretisch denkbaren, sondern auch empirisch messbaren Vereinbarkeit von europäischer und nationaler Identität ist dieses Verhältnis bekanntlich politisch höchst brisant.
Geschichts- und gesellschaftswissenschaftliche Arbeiten aus den letzten Jahrzehnten heben darauf ab, dass Nationen gedanklich konstruiert, wie es teilweise heißt: erfunden werden (Anderson 1998; Hobsbawm 1992 u.a.). Solche ›Erfindungen‹ funktionieren selbstverständlich nicht völlig willkürlich, sondern sind an das Vorhandensein gewisser Voraussetzungen gebunden. Hier reicht es festzustellen, dass die ›Nation‹ jedenfalls keine natürliche, etwa seit vorgeschichtlicher Zeit und bis in alle Ewigkeit existierende, sondern eine historisch – und das heißt konkret: insbesondere im Zusammenhang mit der Herausbildung der modernen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft im 18. und 19. Jahrhundert, namentlich mit der Verdichtung der damit verbundenen sozialen Kommunikation – entstandene soziale Erscheinung ist, zu der die üblicherweise angeführten ethnisch-muttersprachlichen und historisch-kulturellen Merkmale das typische Rohmaterial bilden. Die Nationswerdung ist also ein dynamischer gesellschaftlicher Vorgang. Dabei sollte man nicht übersehen, dass auch die in der Regel ursprünglichere Ausformung des ›Volkes‹ im ethnischen Sinn des Wortes, die sog. Ethnogenese, nicht so sehr biologisch wie historisch-gesellschaftlich zu verstehen ist.
Ein tendenziell demokratisches, ›westliches‹ Nationsverständnis, das von Staatsbürgerschaft, Verfassung und Partizipation ausgeht, wird bis heute einem ethnischen, ›deutschen‹ (wie osteuropäischen) Nationsverständnis, das durch Muttersprache, ›Volksgeist‹ und Abstammung definiert sei, gegenübergestellt. Greifbar wird eine solche Polarität etwa anhand des entsprechend begründeten Anspruchs Frankreichs wie Deutschlands auf Elsaß-Lothringen, strittig zwischen 1871 und 1945. Ohne die Plausibilität einer solchen polarisierenden Konzeption gänzlich zu bestreiten, sind doch beträchtliche Relativierungen anzubringen. So ging das ethno-nationale Denken der deutschen Nationalbewegung (und das der anderen Völker ohne eigenen oder einheitlichen Staat) im größeren Teil des 19. Jahrhunderts in der Regel mit den liberalen Verfassungsbestrebungen bzw. demokratischen Forderungen Hand in Hand, wenn auch einzuräumen ist, dass die überall in Europa zu registrierende Wendung vom überwiegend ›linken‹ zum überwiegend ›rechten‹ Nationalismus im späteren 19. Jahrhundert durch die Radikalisierung des ethnischen Diskurses in eine ›völkische‹ Richtung in Deutschland auch geistig besonders günstige Bedingungen vorfand. – Umgekehrt enthielt der meist als paradigmatisch genannte französische Nationalpatriotismus untergründig ebenfalls Elemente eines sprachlich-kulturellen Nationsgedankens, der der Dritten Republik erst die populäre Verankerung verlieh, um den wiederholten rechtsnationalistischen Herausforderungen, etwa in der Dreyfus-Affäre, erfolgreich Paroli zu bieten.
Während die Kriegsniederlage und die vorangegangenen Verbrechen des NS-Staats das völkisch-rassistische Modell desavouierten, erlangte Frankreichs Nationsverständnis mit der Erinnerung an die Große Revolution und mit der »mission civilisatrice« 1944/45 eine neue und erweiterte Legitimität, die für die politischen Kräfte von links bis rechts (anders als in der Bonner und Berliner Bundesrepublik) bis heute einen stark empathischen Bezug auf die souveräne Nation beinhaltet. Für Großbritannien lässt sich bei anderem historischen Hintergrund Ähnliches sagen.
Für die staatsbürgerliche wie für die ethnische Variante gilt gleichermaßen: Die klassischen Nationalstaaten waren von ihrem Grundprinzip her, der uneingeschränkten staatlichen Souveränität, für eine Einigung Europas nicht geeignet. Das kann man so pauschal feststellen, auch wenn stets einige dieser Staaten ihrer Machtstellung wegen de facto souveräner waren als andere. Paradoxerweise kam der europäische Kontinent einem politischen Zusammenschluss am nächsten, wenn eine Großmacht vorübergehend als absoluter militärischer Hegemon fungieren konnte, so das napoleonische Frankreich zwischen 1806 und 1812 und Hitler-Deutschland von 1940 bis 1943.
Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben wir es mit einem ganz neuartigen Ansatz zu tun, bei dem unabhängige Staaten in relativer Gleichberechtigung und gegenseitiger Übereinstimmung daran gehen, eine übergeordnete institutionelle Ordnung zu schaffen, der sie sukzessive größer werdende Teile ihrer wesentlichen Kompetenzbereiche überlassen bzw. bewusst abtreten. Obwohl hauptsächlich ein Projekt von Eliten, haben die Völker Europas die Einigung in der Grundtendenz mitgetragen. Gewiss geschahen die ersten Schritte dieses Prozesses unter dem Eindruck des gerade überstandenen Krieges und beeinflusst von der amerikanischen Blockbildungsstrategie im Kalten Krieg, doch zwingend war der Weg von der Montanunion über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die EG bis zur EU heutigen Zuschnitts nicht. Alles das unterstreicht: Es handelt sich um einen Vorgang ohne historisches Beispiel. Während die englischen Siedlerkolonien Nordamerikas, die 1787/89 einen schlecht funktionierenden Staatenbund in den Bundesstaat USA überleiteten, bei allen Unterschieden soziokulturell eng verwandt waren, nicht zuletzt sich auch in einer gemeinsamen Sprache verständigen konnten, stand und steht die EU vor der Aufgabe, ihr Einigungswerk mit der Existenz der einzelnen national-kulturellen und nationalstaatlichen Traditionen und Identitäten in Einklang zu bringen, die Europa erst ausmachen.
Gibt es so etwas wie einen realen Kern für ein europäisches Identitätsbewusstsein? Auch wenn weitgehende Einigkeit besteht, dass ›Europa‹ (außer in der physischen Geographie) keinen eindeutig definierbaren Raum beschreibt und deshalb sinnvoll nur als Kulturbegriff verstanden werden kann, existiert mit der Europäischen Union heute eine politische Struktur und ein Territorium, die – anders als die frühe Sechsergemeinschaft – Europa annähernd ausmachen. Abgesehen von den ostslawischen Staaten Russland, Ukraine und Weißrussland sowie der Türkei, wo die Zugehörigkeit jeweils problematisch ist, sind die (noch) nicht der EU angehörenden Länder Europas auf die Union orientiert, entweder als Beitrittswillige oder als Mitglieder des Europäischen Wirtschaftsraums.
Um den Charakter der »Europäischen Verfassung« im weiteren Sinn des Wortes zu beschreiben, werden verschiedene Termini verwendet, die alle das sui generis zu beschreiben versuchen, handelt es sich bei der EU doch zweifellos um ein Gebilde, dessen Dichte in mancher Hinsicht schon weit über die eines klassischen Staatenbundes hinausreicht, ohne ein Bundesstaat ähnlich den USA zu sein und sein zu wollen – jedenfalls für die absehbare Zeit. Dazu kommt, dass die EU über verschiedene Formen engerer Kooperation ihre Abgrenzung nach außen flexibel, an den geographischen Rändern offen gestaltet. Von einer »Sympolitea mit einer polykephalen Entscheidungsstruktur« wird gesprochen (Haratsch u.a. 2010: 2).
Für einen Historiker liegt es nahe, nach den geschichtlichen Wurzeln des spezifisch Europäischen zu fragen. Dabei geht es nicht darum, eine Meistererzählung analog denen zu konstruieren, die im 19. Jahrhundert die Nationsbildungsprozesse begleiteten. Vielmehr sind die Diskontinuitäten und die mörderische Gewalt auch der europäischen Geschichte bewusst einzubeziehen, vor allem – nach der Unterjochung der südlichen Hemisphäre mit ihren genozidalen Begleiterscheinungen, namentlich dem Sklavenhandel – die Zivilisationsbrüche in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit den Exzessen des Imperialismus und Nationalismus, den totalitären Weltanschauungsdiktaturen und den beiden großen Kriegen – wobei der Völkermord an den Juden den grauenvollen Höhepunkt bildete.
Die Shoah wird heute mehr und mehr als ein – in zweiter Linie eben auch – gesamteuropäischer Vorgang analysiert und erinnert, ebenso das Phänomen des Heimatverlusts von 60–80 Millionen Menschen im ›Jahrhundert der Vertreibungen‹, beginnend mit den Armeniern im Osmanischen Reich und den anatolischen Griechen während des Ersten Weltkriegs bzw. in dessen Gefolge. Obwohl die Auseinandersetzung mit der dunklen Seite der Geschichte Europas nicht durchweg auf gemeinsamen, sondern auf großenteils grundverschiedenen Erinnerungen beruht, entfaltet sich in der Verschränkung von trennenden und verbindenden Elementen inzwischen eine »Dynamik an historischer Aufarbeitung« (Schmale 2007: 131), die eher integrierend wirkt – auch wenn einzuräumen ist, dass sich die nationalantagonistischen Muster an der Peripherie der EU weiterhin stärker geltend machen. Die inzwischen fast zur Gewohnheit gewordenen Entschuldigungsbitten und Bußgesten persönlich unbelasteter Repräsentanten europäischer (bzw. westlicher) Staaten im Hinblick auf zum Teil weit zurückliegende Massenverbrechen mögen bisweilen schon einen routinierten und oberflächlichen Eindruck machen, doch haben sie dazu beigetragen, das Klima für eine mehr als ansatzweise gesamteuropäische Erinnerungskultur zu schaffen, die die nationalistischen Reflexe überwindet.
Hier soll indessen argumentiert werden, dass neben der schwarzen Linie von Unterdrückung und Massakern eine geschichtliche Substanz existiert, die die Besonderheit Europas, teilweise auch nur eines sich geographisch verschiebenden Kerneuropas, ausmacht. Es geht dabei nicht einfach um die Zusammenstellung dessen, was aus heutiger Sicht als wertvoll anzusehen ist, sondern um diejenigen Entwicklungen und Weichenstellungen, die die Voraussetzungen dessen geschaffen haben, was die Europäische Union heute darstellt und was sie nach den eigenen Bekundungen darstellen soll.
Da die Ökonomie weiterhin in erheblichem Maß die Integration Europas antreibt, liegt es nahe, zunächst die spezifische Gestaltung desjenigen Modells in den Blick zu nehmen, welches als ›Rheinischer Kapitalismus‹ bzw. als ›koordinierte Marktwirtschaft‹ bezeichnet wird (Skandinavien gehört an dieser Stelle maßgeblich dazu) und einen eigenen Typus darstellt. Er weist im Vergleich mit anderen wirtschaftlichen Großräumen eine Reihe wichtiger Gemeinsamkeiten auf. In mehr als einem Jahrhundert hat sich auf Branchenebene eine technologie- und exportorientierte Kooperationsmentalität herausgebildet, der regionale, durch enge Lieferbeziehungen verflochtene Unternehmenscluster zugrunde liegen. Dazu passen neben dem Finanzierungssystem und der Berufsausbildung eingespielte Mechanismen und institutionalisierte Regelungen der Zusammenarbeit der Unternehmen und ihrer Verbände mit den staatlichen Instanzen und der Arbeitnehmerschaft, betrieblich wie überbetrieblich. Formelle Mitbestimmungsregelungen gelten in elf EU-Staaten. Dieses Set an Einrichtungen und Verfahrensweisen ermöglicht es den Europäern weiterhin, über ihre »diversifizierte Qualitätsproduktion« auf den Weltmarkt zu reüssieren.
Typisch europäisch ist, daran anknüpfend, der Sozial- oder Wohlfahrtsstaat, der nicht allein von der sozialistischen Arbeiterbewegung erstritten, sondern von unterschiedlichen politisch-sozialen Kräften seit dem späten 19. Jahrhundert aufgebaut und gestaltet worden ist. Der radikale Rückbau des Sozialstaats in Europa ist schwer vorstellbar und erscheint kaum durchsetzbar.
Dass die Industrialisierung als welthistorischer Prozess in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Großbritannien startete, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (neben den USA) Teile West- und Mitteleuropas und gegen Ende von dessen zweiter Hälfte auch die europäische Peripherie erfasste, ist allgemein bekannt. Damit die industriekapitalistische Produktionsweise zum Durchbruch kommen konnte, waren weit zurückreichende Vorprägungen vonnöten, die im Hinblick auf die basale Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung den europäischen Kontinent auszeichneten und ihn – trotz zivilisatorischen Rückstands gegenüber zumindest China und dem Orient über Jahrhunderte – in einer eigentümlichen »Verkettung von Umständen« schon frühzeitig einen fruchtbaren »Sonderweg« (C. Meyer) einschlagen ließ. Mit der Durchsetzung der Roggen und Hafer produzierenden Getreidewirtschaft, der Dreifelderwirtschaft und der Grundherrschaft im Frühmittelalter sowie dem avancierten Stand der Energiegewinnung und Metallurgie im Spätmittelalter, mit der gattenzentrierten Familie, dem Lehns- und Ständewesen, der hoch organisierten Papstkirche, die im Hochmittelalter das Römische Recht wiederentdeckte und die umwälzende Innovation des Rechtswesens durch Verschriftlichung, Systematisierung und Rationalisierung einleitete, sowie den Frühformen der Massenkommunikation in Predigt und Buchdruck, entstanden bereits vor Beginn der Neuzeit Grundlagen des modernen Europa.
Bis ins 19. Jahrhundert hinein fand Kapitalakkumulation im großen Stil fast ausschließlich in der Zirkulationssphäre, im Fernhandel und im Bankgeschäft, statt. Doch entwickelte sich, verstärkt im 18. Jahrhundert, unter der Dominanz großer Kaufleute in der Organisationsform des ›Verlags‹ ein, vor allem ländliches, Großgewerbe, das zusammen mit der Tradition des städtischen Handwerkes, mit den naturwissenschaftlichen Fortschritten des 17. und den Erfindungen des 18. Jahrhunderts sowie – nicht zuletzt – mit der Effektivierung und der Kommerzialisierung der Landwirtschaft, schließlich mit der Herausbildung des modernen souveränen Staates den Durchbruch der Industrialisierung im 19. Jahrhundert und später dann, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, den Übergang zum Konsumkapitalismus ermöglichte.
Der einmaligen wirtschaftlichen und sozialen Dynamik Europas, namentlich Nordwesteuropas, nicht erst in der Moderne, entsprach auf der Ebene der Einstellungen und des alltäglichen Verhaltens die Hochschätzung des gewöhnlichen tätigen Lebens, auch der einfachsten Arbeiten, und damit der Selbstverwirklichung in der und durch die Arbeit. Nur Europa kannte zudem den Grundsatz des fast uneingeschränkten Privateigentums. Typisch europäisch ist nicht zuletzt die Idee der Freiheit, nach den antiken Vorläufen zunächst als geistliche Freiheit der Christenmenschen. Die nach heutigem Verständnis untrennbar damit verbundene rechtlich-politische Gleichheit, wie sie in der Neuzeit schrittweise realisiert wurde, beruhte gedanklich auf der Gleichheit der Gläubigen vor Gott. Auch wenn der Islam weite Gebiete des geographischen Europa über mehr als ein Jahrtausend mitgeprägt und den Kontinent über Wissenstransfer beeinflusst hat, ist die kulturelle Überlieferung des Kontinents im Kern eine christliche bzw. jüdisch-christliche, namentlich in der lateinischen Variante. Nur aus dem dort entstandenen, nach und nach institutionalisierten Dualismus von geistlicher und weltlicher Herrschaft konnte das europäische Freiheitsprinzip erwachsen.
Das Denken trennte sich sehr allmählich vom Glauben; mit der abendländischen Rationalität, zunächst innerhalb der Theologie, trat frühzeitig auch eine spezifische Reflexivität in Erscheinung. Intensiver als in anderen Kulturen begaben sich seit der Antike konkurrierende Ideen in einen Wettstreit der Argumente. Die Kirche, die das Lateinische schon im 5. Jahrhundert als Liturgiesprache verankert hatte, trug das intellektuelle Erbe der griechischen wie römischen Antike durch das Mittelalter hindurch bis an die Schwelle der Neuzeit, als die Renaissance, der Humanismus, die Reformation und die katholische Kirchenreform (›Gegenreformation‹) neue Horizonte der empirischen Aneignung der Wirklichkeit und der Individualisierung eröffneten. Die Erfahrung der blutigen innerchristlichen Religionskriege (oder als solche gedeuteten Auseinandersetzungen) im 16. und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts bahnte dann über mehrere Stationen dem Grundsatz der Freiheit des Bekenntnisses und der religiösen Toleranz die Bahn.
Wenn immer wieder betont wird, das europäische Selbstverständnis beruhe wesentlich auf der Differenz, dann findet diese These ihre realgeschichtliche Fundierung in der, naturgeographisch begünstigten, Dezentralität und Pluralität von Herrschaft sowie in dem Nebeneinander von herrschaftlichen und genossenschaftlichen Elementen in den zusammengesetzten Gemeinwesen Alteuropas. Die abgestufte feudale Zersplitterung war das Eine, die starken Selbstverwaltungsbefugnisse von Städten und Dörfern waren das Andere. Auch die oberste monarchische Spitze hatte, meist gewohnheitsrechtliche, Begrenzungen ihrer Macht zu respektieren, wenn sie nicht verklagt oder mit bewaffnetem Aufruhr konfrontiert werden wollte. Die späteren Menschenrechtsdeklarationen gehen letztlich auf das, zunächst adelige, von bestimmten Naturrechtslehren bestärkte Widerstandsrecht zurück.
Die gesamtgesellschaftliche Reformbewegung der Aufklärung zielte dann mit ihrem öffentlichen Diskurs auf ein (sozial faktisch eng begrenztes) europaweites Publikum. Als ein »zutiefst europäisches Modell« (Giesen 2002: 77) fand sie im neuen, die Stände übergreifenden Vereinswesen und in der Leseöffentlichkeit ihre Ausdrucksformen. Einer der klassischen identitätsrelevanten Leittexte der Aufklärung, Immanuel Kants Zum ewigen Frieden (1795) – hier beispielhaft genannt – thematisierte die Einigung Europas ebenso wie die freiheitliche Gestaltung der politischen Ordnung. Dabei schloss die von den Aufklärern propagierte Universalität der Vernunft die Anerkennung und Förderung der Besonderheit der Völker nicht aus, wie deren Beiträge zur Herausbildung nationaler Kulturen und zur Durchsetzung nationaler Hochsprachen, nicht zuletzt in Deutschland, zeigen.
Nachdem der frühneuzeitliche Staat in der Form der ständischen oder der absoluten Monarchie schon die feudale, vielfach anarchisch anmutende politische Gemengelage des Mittelalters abgelöst hatte, schuf erst der in seiner Form teils revolutionäre, teils reformerische Ordnungswandel, der das Ancien Régime in Europa zwischen 1789 und 1871 durch den nationalen Verfassungsstaat ersetzte, ein europäisches Staatensystem, das auf geschlossenen Nationalstaaten beruhte, »eine der eigentümlichsten, prägenden Hervorbringungen Europas« (Krüger 2006: 14). Dieses hörte dadurch nicht auf, ein großer Kommunikationsraum zu sein, der die primären nationalen Kommunikationsräume umspannte – vor allem wirtschaftlich –, doch waren die Zugehörigkeitsvorstellungen bis mindestens Mitte des 20. Jahrhunderts ganz vorrangig national orientiert, nachdem in der Frühphase der emanzipatorischen Nationalbewegungen, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts das brüderliche Bündnis der europäischen Völker gegen die Kräfte der Reaktion, eine Art Internationalismus der Nationen, als Leitbild verbreitet gewesen war.
Während nationale Identitäten oftmals durch bewaffnete Aufstände und Befreiungskriege geprägt worden sind und das Empfinden europäischer Zusammengehörigkeit erst unter dem Eindruck äußerer Bedrohung, so durch das Osmanische Reich vom 15. bis zum 17. Jahrhundert, aktiviert worden war, ist das moderne europäische Selbstverständnis vielmehr das Ergebnis einer bewussten Absetzung von der kriegerischen Vergangenheit des Kontinents mit dem zentralen Ziel der Vermeidung weiterer militärischer Konflikte. Sofern die Selbstbehauptung Europas in der Welt ein wesentliches Motiv war und ist – von der Verunsicherung des europäischen Überlegenheitsgefühls durch den Aufstieg der USA zur wirtschaftlichen und politisch-militärischen Supermacht bis zum Aufkommen neuer Weltmarktkonkurrenten in Asien und Lateinamerika –, wurde sie allenfalls noch in einem defensiven Sinn militärisch verstanden. Vielmehr wurde die gemeineuropäische politische Kultur nach 1945 mehr und mehr als eine der friedlichen Konfliktregelung und des friedlichen Interessenausgleichs wahrgenommen. Der europäische Nationalstaat bestand fort, aber er wandelte sich zu einem kooperativen, integrierten und reflexiven Staat.
Die im Vorangegangenen präsentierten Ergebnisse der Meinungsforschung und der historischen Analysen haben gewissermaßen das Rohmaterial einer europäischen politischen Identität anschaulich gemacht, jedoch noch nicht die Sache selbst bezeichnet. Diese »entsteht einerseits aus Integration, ermöglicht andererseits erst die Integrationsleistung einer politischen Gemeinschaft« (Kotzur 2010: 173). Die der Identitätsbildung zugrunde liegende Kohärenzbildung ist laufend im Gange und keineswegs abgeschlossen. Die EU und die in ihr aufgegangenen wie die neben ihr weiterexistierenden Europäischen Gemeinschaften (so der Europarat und die OSZE) sind hervorgegangen aus völkerrechtlichen Verträgen, insofern Schöpfungen des Rechts und als zwischenstaatliche Organisationen zugleich Quellen des Rechts, so dass es nahe liegt, sie »zuallererst Rechtsgemeinschaften« (Pache 2002: 1161) zu nennen. Die Rechtsstaatlichkeit ist eines der basalen Prinzipien eines europäischen Wertekanons, zu dem ebenso – als eine Art anthropologische Prämisse – die Menschenwürde, ein umfassendes Verständnis von Menschen- und Bürgerrechten sowie die individuelle und kollektive Selbstbestimmung (und damit Pluralismus und Demokratie) gehören.
Nun besteht das Paradoxe der inhaltlich wie prozedural bestimmten Europäizität darin, dass es sich um universelle Prinzipien und Verfahrensweisen handelt, deren weltweite Gültigkeit erstrebt wird, selbst wenn ihr Ursprung in Europa zu verorten ist. Auch nichteuropäische Staaten, namentlich solche, die sich einer ›westlichen Wertegemeinschaft‹ zugehörig fühlen, berufen sich darauf. Deshalb kann das Identitätskriterium der Abgrenzung, im Sinne der (unaggressiven) Betonung der Besonderheit des Eigenen, nicht ganz außer Acht gelassen werden, auch wenn auf Dauer nichts davon unveränderlich sein mag. Selbstverständlich ist die EU kein exklusiver »christlicher Club«, wie der türkische Ministerpräsident Erdogan polemisch formuliert hat. Aber ganz Europa ist kulturell in einer Weise vom Christentum geprägt worden (in zweiter Linie auch vom Judentum und vom Islam), die die christliche Überlieferung zum kulturellen Erbe aller Europäer, auch der Nichtchristen und Ungläubigen, gemacht hat. Und unmittelbar daran anschließend darf man feststellen, dass die Dialektik von Religion und Aufklärung das Geistesleben im größten Teil des europäischen Kontinents in den letzten Jahrhunderten unvergleichlich charakterisiert hat. Auf der politischen Ebene hat sich zweifellos ein spezifisch europäisches Demokratie- und Grundrechtsverständnis entwickelt, das Sozialstaatlichkeit und soziale Grundrechte als unverzichtbar einbezieht und sich dadurch vom Demokratie- und Grundrechtsverständnis etwa der USA unterscheidet. Schließlich beinhalten die stufenweise Konstituierung der Europäischen Union, deren unverwechselbare Struktur und Funktionsweise wie ihr praktisches Wirken viel Identitätsprägendes.
Was oft als Schwäche der EU erscheint, der Zwang, immer wieder Kompromisse aushandeln zu müssen, ist im Kern – Verbesserungen sind nötig und möglich – die Kehrseite der Zukunftstauglichkeit des europäischen Modells: der mühsam erworbenen Fähigkeit zur friedlichen Lösung von Konflikten, zum Ausgleich unterschiedlicher Interessen. Nirgendwo auf der Welt findet sich ein dermaßen weit entwickeltes übernationales Regulierungsvermögen, gegründet auf gemeinsam fixiertem Recht, das seinerseits auf der spezifischen Geschichte Europas, namentlich seiner Rechtskultur, beruht. Gerade der untypisch kühne Versuch, durch den währungspolitischen Vorgriff der Euro-Zone (ohne engere politische und Fiskalunion) den Einigungsprozess voranzutreiben, könnte sich als fataler Fehler erweisen, auch im Hinblick auf die Identitätsbildung.
Die EU entstand als Wirtschaftsgemeinschaft, als ›gemeinsamer Markt‹, nicht als gemeinsamer Staat und auch nicht als politische Union. Es entspricht der Logik dieser Entstehungsgeschichte, dass die Befugnisse der Europäischen Kommission vor allem die Bedingungen des Wirtschaftens im europäischen Markt betreffen – und zwar mit dem Ziel seiner fortlaufenden Liberalisierung. Die Finanzpolitik der Einzelstaaten mit allen gesellschaftspolitischen Implikationen spielt nur insofern eine Rolle, als über die Einhaltung der Defizit-Kriterien für die nationalen Budgets gewacht werden soll. Auf die einzelstaatliche Steuerpolitik hat die Kommission keinen Einfluss, der Rat de facto auch nur wenig.
Die Bedeutung der EU als Freihandelszone wird erheblich relativiert durch das, was wir als Globalisierung bezeichnen. Diese ist durch den immer ungehinderteren Fluss von Waren und Dienstleistungen weltweit ebenso definiert wie durch das frei und (auch aufgrund der heutigen technischen Möglichkeiten) blitzschnelle globale Agieren des Finanzkapitals. Für die Investitions- und namentlich auch die Übernahmeentscheidungen eines internationalen Konzerns mit Hauptsitz außerhalb Europas sind die Außengrenzen der EU heute keine höhere Hürde als die Grenzen der europäischen Nationalstaaten. Und andererseits: Für den Standort- und Deregulierungswettbewerb in Europa ist die Europäisierung wegen des nach wie vor überragenden Anteils des EU-internen Wirtschaftsverkehrs gravierender als die Globalisierung. Die Europäisierung erweist sich auf dieser Ebene der Analyse als besonders effektiver Teilprozess, die EU als eine Art Transmissionsriemen der Globalisierung.
Genau diese Funktion der EU wird von einem nicht unerheblichen Teil der nationalen Führungseliten befürwortet, am eindeutigsten in Großbritannien, deutlich weniger in Frankreich. Parteipolitisch-ideologisch gesehen, finden sich die größten Skeptiker deutlich links von der Mitte und gleichzeitig – aus unterschiedlichen Motiven – rechts von den etablierten bürgerlichen Hauptströmungen, die entschiedensten Apologeten in der liberalen Mitte und im gemäßigten Mitte-Rechts-Spektrum, weniger ausgeprägt aber auch bei Teilen der Sozialdemokratie. Die Ablehnung des Europäischen Verfassungsvertrags durch die Franzosen (wie durch die Niederländer) bezog sich offenbar vor allem auf ein in neoliberalem Sinn globalisiertes Europa. Man macht es sich zu einfach, wenn man den Widerstand gegen den Verfassungsvertrag allein als Erfolg der Demagogie von Nationalisten, Linksextremen, Populisten und Opportunisten wertet. Ich muss hier nicht betonen, dass ein Teil der Befürworter des Vertrags gerade von dem Motiv getragen war, die politischen Interventionsmöglichkeiten der EU-Institutionen zu verbessern, um dem entgegenzuarbeiten, wogegen sich der Unmut weiter Volksschichten richtete.
Die marktliberale Schlagseite der EU resultiert in gewisser Weise schon aus der Zielsetzung der Römischen Verträge. Es ist eben nicht zuletzt die Aufgabe der Brüsseler Kommission, über Liberalisierung, Deregulierung und Privatisierung den freien Wettbewerb zu fördern. Wünschenswerte Strategien zur Förderung der wirtschaftlichen Konjunktur und zur Harmonisierung oder wenigstens fixierten Stufung der nationalen Steuersysteme können im allenfalls zuständigen Rat mit 27, auf Einstimmigkeit verpflichteten Mitgliedern nicht ausgearbeitet und durchgesetzt werden. Die Mehrheit der Europäer vermisst offenbar, dass die EU dort die Schutzfunktion gegenüber den globalen Akteuren der internationalen Kapitalgruppen übernimmt, wo die Nationalstaaten dazu nicht oder nicht mehr imstande sind. Unverzichtbare Staatsfunktionen dürfen nicht einfach verschwinden, sondern müssen, soll unsere politische Ordnung nicht ad absurdum geführt werden, nötigenfalls auf der europäischen Ebene neu angesiedelt werden.
Das Verhältnis zwischen Nationalstaaten und Europäischer Union wird auch dann heikel bleiben, wenn es gelingen sollte, die »Gemeinschaft der Staaten« durch eine weitergehende Mitwirkung der Völker bzw. Bürger Europas zu ergänzen. Der demokratische Nationalstaat in Europa, sei er mehr unitarisch oder mehr föderativ strukturiert, konnte deswegen im 19. und 20. Jahrhundert bestimmend werden, weil er sich über positive Integration und über institutionalisierte Teilnahme des Volkes, des Demos, eine historisch neuartige und grundlegende Legitimität verschaffen konnte. Inwieweit kann die vielsprachige und komplexe Europäische Union diesbezüglich an die Stelle der Nationalstaaten treten oder diese ergänzen? Es geht dabei ja nicht nur um Parlamentswahlen und eventuell um Plebiszite. Die für die moderne Demokratie unverzichtbaren partizipativen Einrichtungen im staatlich-politischen, sozialen und kulturellen Feld, namentlich die der politischen Öffentlichkeit, von Parteien und Gewerkschaften (wie auch anderen Interessenorganisationen), verharren bisher ganz überwiegend auf der nationalen Ebene. Aller Voraussicht nach wird eine Angleichung – oder besser Harmonisierung – der einzelstaatlichen Besonderheiten hier noch mehr Zeit beanspruchen als bei der Regelung des Gefüges der Spitzeninstitutionen.
Die Alternative einer Koexistenz souveräner Nationalstaaten (»Europa der Vaterländer«) versus ihrer Auflösung in einem europäischen Staat (»Vaterland Europa«) ist irreführend. Der souveräne Nationalstaat alten Typs gehört unwiderruflich der Vergangenheit an. Die reale Entwicklung ist über ihn hinweggegangen, und ständig verliert er weiter an Substanz, indem die Mitgliedstaaten der EU Rechte abgeben. Und dennoch wäre es nicht nur abwegig zu erwarten, dass die Nationen Europas als soziale und mentale Entitäten sich auflösen »wie der Zucker im Kaffee« (E. Eppler). Auch die Nationalstaaten werden lange Zeit überdauern, zumindest als Bausteine des großen europäischen Hauses. Sie haben weiterhin Aufgaben zu erfüllen, für die bislang – soweit absehbar – keine anderen Einheiten zur Verfügung stehen.
Das bedeutet: Wenn Europa in einem demokratischen Sinn voll handlungsfähig werden soll, müssen auch die Nationalstaaten handlungsfähig bleiben bzw. im europäischen Rahmen wieder werden. Das betrifft natürlich die institutionelle Seite, hat aber auch eine psychologische Dimension. Wenn es stimmt, dass Europa und seine Nationalstaaten in gewisser Weise aufeinander angewiesen sind, dann benötigen wir nicht nur eine Verständigung darüber, einen Minimalkonsens dessen, was wir als Substanz des europäischen Projekts betrachten wollen – wozu m.E. auch das Problem seiner geographischen Grenzen gehört; wir benötigen zugleich einigermaßen sichere nationale Identitäten im Sinne spezifischen nationalen Selbstverständnisses und kritisch-selbstkritischen nationalen Selbstbewusstseins. Im deutschen Fall waren es bekanntlich vor allem zwei Gründe, die dem in den Jahrzehnten der Nachkriegszeit entgegenstanden: erstens die Teilung des Landes bei gleichzeitiger, auch alltagskultureller, Westorientierung der Bundesrepublik, zweitens die Erinnerung an die Geschichtskatastrophe des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs. Ich vermag nicht zu sehen, wie die vorpolitischen Elemente der nationalen Identitäten, die dem Gemeinwesen erst die notwendige emotionale Grundierung liefern, von einer europäischen Identität komplett übernommen werden könnten.
Es kann sich bei der Einigung Europas nicht darum handeln, die tradierten Nationen als soziale, Bewusstseins- und Gefühlsgemeinschaften in einem Schmelztiegel aufzulösen; sie werden auf absehbare Zeit weiter bestehen und sich günstigenfalls kulturell gegenseitig befruchten, wenn es gelingt, das Verhältnis zwischen den Völkern und Staaten Europas solidarisch zu organisieren. Überwunden werden sollen nicht die Nationen, sondern der absolute Souveränitätsanspruch der alten Nationalstaaten. Die ›Globalisierung‹ stellt nicht nur die überkommene Nationalstaatlichkeit in Frage, sondern weil die Demokratie bislang nur nationalstaatlich abgesichert ist, mit ihr auch die demokratische Staatsordnung.
›Globalisierung‹ und ›Standortwettbewerb‹ tangieren aber ebenso die politische Substanz des europäischen Einigungsprozesses einschließlich manches bisher schon Erreichten, da sie einer in großem Stil ausgleichenden Budget- und Strukturpolitik entgegenstehen. Die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, so die Massenzuwanderung aus anderen Kulturkreisen, stellen sich dem europäischen Verbund nicht wesentlich anders als seinen nationalstaatlichen Mitgliedern. Die Konsequenz des Zusammenbruchs der EU oder ihrer Rückentwicklung zu einer reinen Freihandelszone wäre wohl nicht ein kooperierendes »Europa der Vaterländer«, gegründet auf nationale Unabhängigkeit und Gleichberechtigung aller, sondern die Herausbildung neuer konkurrierender Gebilde, die durch die Vorherrschaft jeweils eines der größeren Staaten bestimmt wären.
Nur als Bausteine eines vereinten Europa, dessen Verfassung staatenbündische und bundesstaatliche Elemente historisch neuartig kombinieren wird, haben die alten Nationalstaaten eine konstruktive Zukunft. Nur vereint hat Europa eine Chance, gegen die destruktiven Tendenzen eines global vagabundierenden Finanzkapitals, eines uneingeschränkten Marktliberalismus die eigenen zivilgesellschaftlichen, kulturellen, demokratischen und sozialstaatlichen Errungenschaften zu verteidigen, und – unter Einbeziehung der ökologischen Dimension – weiterzuentwickeln. Dieses wäre zudem die Voraussetzung dafür, auch auf globaler Ebene in effektiver Weise menschheitlich solidarisch zu handeln.
Auch in:
Peter Brandt, Europäische Identität – Identitäten in Europa, in: ders. (Hg.), Perspektiven der Unionsgrundordnung. Gewidmet Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Dimitris Th. Tsatsos zu seinem 75. Geburtstag. Erträge des Symposiums des Instituts für Europäische Verfassungswissenschaften an der Fernuniversität in Hagen am 4. Mai 2008 (Veröffentlichungen des Dimitri-Tstatsos-Instituts für Europäische Verfassungswissenschaften, Bd. 12), Berlin 2013. [-> dort mit ausführlicheren Literaturangaben, Anm. d. Red.]
Literaturangaben:
Benedict Anderson, Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts, 3. Aufl., Frankfurt am Main 1998.
Rémi Brague, Europa. Eine exzentrische Identität, Frankfurt am Main 1993.
Bernhard Giesen, Europäische Identität und transnationale Öffentlichkeit. Eine historische Perspektive, in: Hartmut Kaelble u.a. (Hg.), Transnationale Öffentlichkeiten und Identitäten im 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main 2002, S. 67-84.
Andreas Haratsch/Peter Schiffauer/Dimitris Th. Tsatsos, Einleitung: Der Verfassungszustand der Europäischen Union, in: Dimitris Th. Tsatsos (Hg.), Die Unionsgrundordnung – Handbuch zur Europäischen Verfassung, Berlin 2010.
Eric J. Hobsbawm, Nationen und Nationalismus. Mythos und Realität seit 1780, 2. Aufl., Frankfurt am Main 1992.
Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf. Anhang mit Texten zur Rezeption 1796-1800, hrsg. v. Steffen Dietzsch, Leipzig 1984.
Wolfgang Kaschuba (Hg.), Kulturen – Identitäten – Diskurse. Perspektiven Europäischer Ethnologie, Berlin 1995.
Markus Kotzur, Zur politischen Identität der europäischen Staaten, in: Tsatsos (Hg.), Die Unionsgrundordnung, S. 165-180.
Peter Krüger, Das unberechenbare Europa. Epochen des Integrationsprozesses vom späten 18. Jahrhundert bis zur Europäischen Union, Stuttgart 2006.
Eckhard Pache, Europäische und nationale Identität, in: Das Deutsche Verwaltungsblatt v. 01.09.2002, S. 1154-1167.
Wolfgang Schmale, Perspektiven der Europaforschung, in: Bernd Schönemann/Hartmut Voit (Hg.), Europa in historisch-didaktischen Perspektiven, Idstein 2007,
S. 121-131.