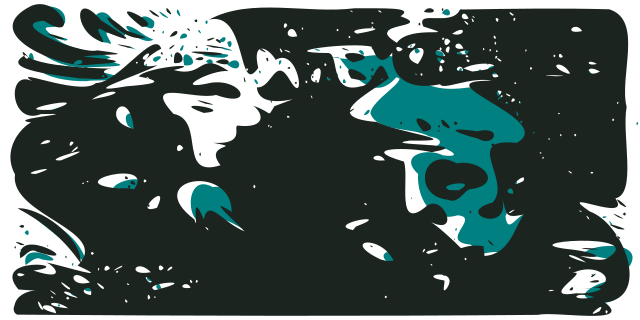von Roland Wehl
Gegenseitiges Unverständnis
Im Streit um die Flüchtlingskrise ist das gegenseitige Unverständnis groß. Kritiker und Verteidiger der jetzigen Flüchtlingspolitik werfen sich gegenseitig Verantwortungslosigkeit vor, weil sie in der Analyse zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Unbestritten ist, dass es sich um ein globales Problem handelt.
Daraus folgern die einen, dass es nur eine globale Lösung geben könne. Deutschland sei mitverantwortlich für die Krisenherde in der Welt und müsse deshalb die Folgen mittragen. Die Aufnahmefähigkeit sei auch Ende 2015 noch lange nicht erreicht, und die Zahl der Asylsuchenden werde auch wieder sinken. Andere sprechen dagegen vom Beginn einer neuen Völkerwanderung, die sich durch die Verbesserung (!) der Lebensverhältnisse in der Dritten Welt sogar weiter verstärken werde (Gunnar Heinsohn). Unabhängig von dieser Diskussion besteht in weiten Teilen unserer Gesellschaft Einigkeit darüber, dass diejenigen Flüchtlinge, die über ›sichere Drittstaaten‹ zu uns kommen, weiterhin Aufnahme finden sollen. Denn die katastrophale Situation der Flüchtlinge in der Türkei und anderswo ist ein Teil des Problems.
Fragen beantworten
Der Satz ›Wir schaffen das‹ hat eine kollektive Selbstermutigung ausgelöst. Die deutsche Willkommenskultur der vergangenen Monate war sympathisch – und naiv zugleich. Wie gut sind wir auf die Integration der Zuwanderer vorbereitet? Haben wir aus den Fehlern früherer Jahre gelernt? Können wir der Frage der Begrenzung und Steuerung auf Dauer ausweichen? Oder sollen es andere Staaten für uns richten? Ist die jetzige Politik der ›offenen Grenzen‹ wirklich so human, wie wir meinen, oder wird sie als Einladung ins ›Paradies‹ missverstanden? Werden Menschen, die noch nicht auf gepackten Koffern sitzen, durch falsche Signale dazu gebracht, ihre Heimat zu verlassen?
Manchmal werden solche Fragen nur gestellt, um vom eigenen Egoismus abzulenken und jede Hilfsbereitschaft zu verweigern. Menschen, die nichts abgeben wollen, hat es schon immer gegeben. Sind die Fragen deshalb unberechtigt? Wer die Aufnahmebereitschaft in unserer Gesellschaft erhalten will, muss sich den Fragen inhaltlich stellen, statt sie pädagogisch zu ›entsorgen‹. Wer nicht zu sagen wagt, dass unsere Aufnahmefähigkeit begrenzt ist, stärkt die Wohlstandschauvinisten und Fremdenfeinde.
Wohlstandschauvinismus und Rassismus …
Einer davon ist der Thüringer Politiker, der im Herbst 2015 auf einer Kundgebung in Erfurt blonde Frauen vor angeblichen Übergriffen durch Asylbewerber warnte – und sich damit selbst entlarvte. Einige Tage später war er in einer Talkshow zu Gast. Dort zog er zu Beginn der Sendung eine Deutschlandfahne aus der Tasche – und löste damit bei vielen, denen die Farben Schwarz-Rot-Gold etwas bedeuten, ein Gefühl des Fremdschämens aus. Soll der Mann einem leidtun? Sein Verhalten ist kein Einzelfall.
An abstoßenden Beispielen besteht kein Mangel. Dazu gehört auch das sexistische Video, mit dem im Jahr 2015 die Jugendorganisation der österreichischen FPÖ um neue Anhänger warb. In dem Film ist eine junge Frau zu sehen, die sich in einem Swimmingpool vergnügt. Ihre Botschaft lautet: ›Das Wasser steht uns bis zum Hals‹. Die junge Frau steht nicht vor der Gefahr des Ertrinkens. Es geht auch nicht um den Wasserstand des Swimmingpools, sondern um die Zuwanderung. Als ich das Video im Sommer 2015 sah, wünschte ich der jungen Frau reflexhaft den ungefragten Besuch vieler Menschen aus fernen Ländern, die sich des Swimmingpools bemächtigen. Meine Reaktion war ebenso rassistisch wie die Botschaft des Videos selbst – nur umgekehrt. Vor lauter Abscheu hatte ich vergessen, dass ich selbst die Politik der ›offenen Grenzen‹ kritisiere.
So schnell kann es passieren, dass man dem politischen Gegner ›auf den Leim‹ geht und sich verirrt. Man will möglichst weit weg sein von dem, was der andere sagt, und flüchtet sich deshalb in die anscheinend entgegengesetzte Position: kein seltenes Phänomen in politischen Debatten – auf allen Seiten. Auch die Diskussion über die ›Flüchtlingskrise‹ leidet darunter. Die Bachmänner und Höckes dieser Welt ziehen daraus Nektar.
… und umgekehrter Rassismus
Auch der ›umgekehrte‹, nach innen gerichtete Rassismus ist menschenverachtend. Er ist in unserer Gesellschaft häufiger anzutreffen als anderswo. Denn auch 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und den NS-Verbrechen sind wir von einem reflektierten, humanen Selbstverständnis noch immer weit entfernt. Wenn gelegentlich in Diskussionen gefordert wird, in den östlichen Bundesländern den Anteil der Einwohner anderer Hautfarbe zu erhöhen, damit die Gesellschaft im Osten ›bunter‹ werde, ist das ebenso Ausdruck eines ›umgekehrten Rassismus‹ wie die Parolen ›Nie wieder Deutschland‹ oder ›Deutschland, du mieses Stück Scheiße‹, die auf manchen Demonstrationen gegrölt werden. Der Selbsthass, der aus diesen Parolen spricht, weist Parallelen zum Fremdenhass auf. Darüber wäre dringend zu reden. Nicht zuletzt mit den Jungsozialisten.
Im November 2015 verabschiedeten die Jusos auf ihrem Bundeskongress einen Antrag für den SPD-Parteitag, in dem die ersatzlose Streichung der §§ 90, 90a und 90b StGB gefordert wird. Das Gesetz verbietet die Verunglimpfung unseres Staates. Ohne das Gesetz wäre die Parole ›Deutschland, du mieses Stück Scheiße‹ also nicht mehr strafbar. Das ist den Jungsozialisten anscheinend wichtig. In ihrem Antrag für den SPD-Parteitag beziehen sie sich ausdrücklich auf diese Parole. Ordnungsrufe der SPD haben die Jusos kaum zu befürchten. Der politische Irrsinn ist zeitgemäß – und nicht auf die Jusos beschränkt. Auch die Zeitung Neues Deutschland, an der die Partei Die Linke indirekt beteiligt ist, offenbart ein merkwürdiges Verhältnis zu unserem Land. Der Slogan ihrer Werbekampagne lautet: ›links – nicht deutsch‹.
Einfacher kann man sich politisch nicht ins eigene Knie schießen und deutlich machen, dass man zur Frage des Selbstverständnisses unserer Gesellschaft nichts beizutragen hat. Die Vertreter der alten deutschen Arbeiterbewegung würden sich wohl im Grab umdrehen, wenn sie wüssten, was ihre (Ur-)Enkel heute treiben.
Gesellschaftlicher Zusammenhalt
Die Integration der Zuwanderer wird durch solche Allüren nicht erleichtert. Wer will sich schon einer Gesellschaft zugehörig fühlen, die mit sich selbst nicht im Reinen ist? Bei der Frage der Integration geht es eben nicht nur um Sprachkenntnisse und ein Bekenntnis zum Grundgesetz, sondern auch um unsere (demokratischen) Traditionen, unsere Kultur und unser Selbstverständnis. Wie wollen wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt bewahren, wenn wir das ›Eigene‹ geringschätzen? Die Menschen, die sich gestern aus dem Libanon und heute aus Syrien und anderswo auf den Weg zu uns gemacht haben, wollten die bisherigen Verhältnisse hinter sich lassen. Deshalb ist es absurd, sie nach den Terroranschlägen von Paris unter Generalverdacht zu stellen. Stattdessen sollten wir alles tun, dass die Verhältnisse, denen diese Menschen entflohen sind, nicht auch bei uns irgendwann Wirklichkeit werden. Wir brauchen eine Politik der ›offenen Herzen‹ – und des klaren Verstandes. Das ist etwas ganz anderes als die jetzige Politik der ›offenen Grenzen‹. Die unkontrollierte und unbegrenzte Zuwanderung gefährdet nicht nur die sozialen Sicherungssysteme, sondern auch den Rechtsstaat. Das geht zu Lasten der Schwächsten der Gesellschaft – und der Integration.
Zu denen, die eine politische Kurskorrektur fordern, gehört die Theologin, Lehrerin, Flüchtlingshelferin und Mitbegründerin der Grünen, Eva Quistorp. Nicht um denjenigen den Schutz zu verweigern, die dessen heute bedürfen, sondern um den Schutz auch morgen gewährleisten zu können. Eva Quistorp fordert, dass wir bei der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern genauer hinsehen als bisher. Und nicht nur das. Sie fordert auch eine bessere Willkommenskultur für diejenigen ein, die schon hier sind.
Wie soll es weitergehen?
Eva Quistorp geht es um den Respekt gegenüber allen sozial Schwachen – und um das Wohl für Leib und Seele. Dazu gehören der Austausch von demokratiefreundlichen Migrantenmilieus und Flüchtlingen untereinander, die Vermittlung von Kenntnissen über europäische Leitkulturen, über jüdische und christliche humanistische Kulturtraditionen sowie über die neuen sozialen Bewegungen. Der syrische Student, der in Berlin am Alexanderplatz lecker und variantenreich für Obdachlose kocht, der Flüchtlingschor in Dresden, der O Tannenbaum singt, die Handwerker, die Flüchtlinge ausbilden: sie alle geben ein Beispiel dafür, auf welchen Wegen Integration stattfinden kann. Patenschaften sind ein weiteres Instrument. Wer die Patenschaft für einen Flüchtling übernimmt und ihm hilft, sich bei uns zurecht zu finden, leistet für die Integration einen wichtigen Beitrag.
Angesichts der Not der Flüchtlinge fällt die Diskussion darüber, wie es weitergehen soll, nicht leicht. Das ändert nichts daran, dass sie ehrlicher als bisher geführt werden muss. Nur wenige Politiker wagen sich aus der ›Deckung‹. Dass der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel von der Notwendigkeit spricht, die ›staatliche Kontrolle‹ wiederzugewinnen, ist ihm hoch anzurechnen. Es kann uns doch nicht egal sein, wohin sich das Land entwickelt. Offenheit dürfen wir nicht mit Gleichgültigkeit verwechseln. Sonst sind wir selbst das größte Integrationshindernis. Und unsere Offenheit nicht viel wert.
Auszug aus meinem Einleitungsreferat auf der Veranstaltung mit Eva Quistorp, die am 20.11.2015 in Berlin im »Kohlenkeller am Mexikoplatz« stattfand, und an der auch der Globkult-Autor Werner Stanglmaier teilgenommen hatte.