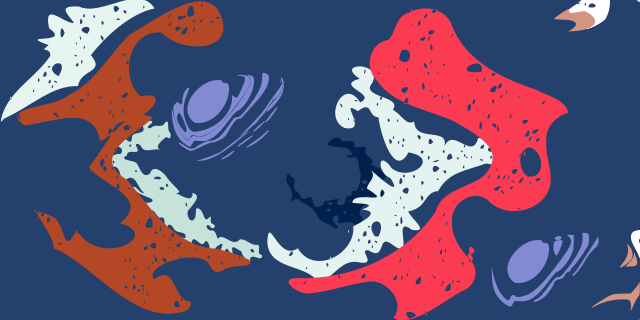von Peter Brandt
Im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung sind in den vergangenen Monaten in den USA und im Vereinigten Königreich vermehrt Denkmäler historischer Akteure umgestürzt, enthauptet oder auf den Kopf gestellt worden. Dabei handelt es sich vorrangig um Figuren, die mit der Ausrottung, Unterdrückung und Versklavung nichtweißer Ethnien belastet seien, so etwa die berühmten Generäle der Südstaatenarmee im amerikanischen Bürgerkrieg von 1861-65. Kompliziert wird die Sache dadurch, dass nicht wenige der symbolisch Attackierten oder Exekutierten ganz unterschiedliche Eigenschaften verkörpern. Etliche der Gründungsväter der USA, des ersten modernen Verfassungsstaats, waren sklavenhaltende Agrarier, so etwa der hauptsächliche Verfasser der Unabhängigkeitserklärung von 1776 und dritte Präsident der Union, Thomas Jefferson, ein Aufklärer und Universalgelehrter. Obwohl kein rigoroser Verteidiger der Sklaverei, hielt er die Schwarzen, anders als die Indianer, für eine minderwertige Art Menschen.
Stürzen würden aufgebrachte Militante, wenn dieses nicht sicher bewacht würde, das Standbild Andrew Jacksons, eines ehemaligen Kriegshelden, vor dem Kapitol in Washington. Es steht außer Frage, dass gerade unter Jackson die Vertreibung der Indianerstämme aus dem Land östlich des Mississippi organisiert und brutal betrieben wurde. Damit begann der Genozid in großem Maßstab. Jacksons Präsidentschaft (1829-37) steht aber auch für einen nachhaltigen politischen Demokratisierungsschub, wenngleich dieser nur den weißen US-Amerikanern zugute kam. Sind nun die hier in zwei Fällen angedeuteten persönlich zuzurechnenden Fortschritte für die USA wie für die Menschheitsentwicklung wegen offenkundiger Zwiespälte im Denken und Handeln, sogar eindeutiger schwerer Missetaten der Beteiligten obsolet? Natürlich nicht! Prinzipien des Konstitutionalismus, der Menschen- und Bürgerrechte sowie der Demokratie wurden später vielmehr zur geistigen Waffe im Kampf gegen Sklaverei und Unterdrückung.
Hierzulande geht es bislang hauptsächlich um die Umbenennung von Straßen. Vom Antisemitismus-Beauftragten der Bundesregierung Felix Klein kommt der Vorschlag, die Pacelliallee (nach Eugenio Pacelli, dem späteren Papst Pius XII.) in Berlin Dahlem umzubenennen – zugunsten der früheren israelischen Ministerpräsidentin Golda Meir. Damit hat sich Klein der Initiative der Historiker Julien Reitzenstein und Ralf Balke angeschlossen. Nun ist Pius der XII. in der Tat im Hinblick auf seine Haltung gegenüber dem Faschismus bzw. dem Nationalsozialismus seit langem umstritten, wozu Rolf Hochhut 1963 mit seinem Theaterstück Der Stellvertreter erheblich beigetragen hat. Sogar unter katholischen Historikern und Theologen gibt es verschiedene Einschätzungen des Papstes.
Klar ist, dass Pacelli, seit 1917 bzw. 1920 Nuntius, also Botschafter für den Vatikan in Deutschland, politisch-ideologisch konservativ-antiliberal – wie die damalige römisch-katholische Amtskirche generell – und dezidiert antikommunistisch orientiert war. Die NSDAP und völkische Bestrebungen, die eher im protestantischen Milieu verbreitet waren, lehnte er aus dieser Einstellung heraus ab. Als Kardinalstaatssekretär in Rom war er ab 1930 der wichtigste außenpolitische Berater des Papstes Pius XI. Dass sich Pacelli zwecks Erhaltung der Autonomie der Katholischen Kirche und der Glaubensfreiheit in Deutschland nach wie vor der Übernahme des Pontifikats im Frühjahr 1939 nur sehr vorsichtig zur NS-Diktatur äußerte (er hatte 1933 das Reichskonkordat ausgehandelt), ist ebenso unstrittig wie die Tatsache, dass der Vatikan über die Judenverfolgung und Vernichtung einiges wusste, aber nicht mehr als die alliierten Regierungen; auch er hatte keine gesicherten Informationen über die Todesfabriken. In verklausulierter Form, aber durchaus erkennbar kritisierte Pius XII., zuerst zu Weihnachten 1942, das Vorgehen gegen die Juden, und Ende Oktober 1943 initiierte er eine große Rettungsaktion der Klöster und anderer kirchlicher Einrichtungen zugunsten untergetauchter römischer Juden.
Auch dieses Beispiel kann zeigen, wie ambivalent sich das Verhalten nicht weniger historischer Personen darstellt – je nach dem Blickwinkel, aus dem man sie betrachtet. Gewiss ist Eugenio Pacelli keine Identifikationsgestalt für progressive Demokraten einschließlich der Katholiken unter ihnen, aber darum geht es nicht. Wo ist die Grenze des zu Tolerierenden? Man findet immer etwas aus spezieller heutiger Sicht Problematisches, auch bei den am meisten bewunderten Menschen wie etwas Mahatma Gandhi und Nelson Mandela.
Allemal gilt das, wegen der Palästinenserfrage, für eine führende Politikerin Israels wie Golda Meir, die anstelle Pacellis als Namensgeberin der eingangs erwähnten Straße zwischen dem Platz am Wilden Eber und dem U-Bahnhof Dahlem-Dorf vorgeschlagen worden ist. Damit es keine Missverständnisse gibt: Es wird hier nicht davon abgeraten, eine Straße oder einen Platz in Berlin nach Golda Meir zu benennen. Widersprochen werden soll nur der Vorstellung, als gäbe es dagegen keine plausiblen Einwände. Übrigens war es Golda Meir, die Pius XII. bei dessen Tod 1958 als ›einen der bedeutendsten Wohltäter unseres jüdischen Volkes‹ bezeichnete.
Immer mehr der herausragenden, auf Denkmälern oder durch Straßennahmen geehrten Vorväter geraten in den Verdacht, den Negativkriterien des mangelnden Abstands zu Nationalsozialismus und Faschismus bzw. Militarismus, Rassismus und Antisemitismus nicht zu genügen. Bislang fast uneingeschränkt akzeptierte positive Bezugnahmen, so auf Martin Luther und auf Otto von Bismarck, werden infrage gestellt. Insbesondere Luthers Judenfeindschaft und seine hetzerische Schrift gegen die aufständischen Bauern sind seit langem Gegenstand kritischer Debatten, ebenso das von Bismarck 1878 eingebrachte Ausnahmegesetz gegen die Sozialdemokratie, der von ihm in Gang gesetzte Kulturkampf gegen die Katholiken, auch seine Einigungskriege zwischen 1864 und 1871 und anderes mehr. Dennoch hätte bis vor Kurzem kaum jemand, – über das ganze politisch-weltanschauliche Spektrum hinweg – ihm die Bedeutung eines ungewöhnlich fähigen, ›großen‹ Staatsmannes, einer Zentralfigur der modernen deutschen Geschichte – wenn auch für viele ambivalent zu beurteilen – abgesprochen, ebenso wenig Luther seine historischen Verdienste als Reformator des Christentums, Befreier des individuellen Gewissens und Pionier-Gestalter unserer hochdeutschen Sprache. Auch von katholischer Seite hat man das stets toleriert.
Und wenn man beim kritischen Blick zurück schon ins frühe 16. Jahrhundert vorgestoßen ist, warum – so könnte man ironisch fragen – dann nicht auch die diversen mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Fürsten unter die Lupe nehmen? Nach den heute vielfach angelegten Maßstäben waren sie fast durchweg Halunken, schon durch die unzähligen Kriege, die sie führten. Der Krieg war indessen bis ins 20. Jahrhundert nicht grundsätzlich geächtet, auch nicht aufseiten der Republikaner und Sozialisten.
Nehmen wir uns kurz den brandenburgischen Markgrafen Friedrich II. vor, genannt ›der Eiserne‹ oder ›Eisenzahn‹; er regierte von 1440 bis 1470. Eine Straße in Berlin-Wilmersdorf zwischen Hohenzollerndamm und Kurfürstendamm erinnert an ihn. Sein Spitzname rührt daher, dass er mit harter Hand gegen die adelig dominierten Landstände, aber auch gegen das Autonomiebestreben der Städte vorging, so Berlins, wo er gegen den starken ›Unwillen‹ der Bewohner – ein mehrjähriger Machtkampf – das Berliner Stadtschloss errichten ließ.
Nicht ganz außer Acht lassen sollte man auch die Dynamik, die entstehen könnte, wenn Rechtsgerichtete, Liberal-Konservative oder Sonstige, wie vereinzelt schon geschehen, ihrerseits anfingen, ihnen unsympathische, von Linken verschiedener Couleur indessen geschätzte Straßennamen ändern zu wollen. Man hat zwar nach 1989/90 in der Ex-DDR reichlich Umbenennungen vorgenommen, teilweise nur deshalb, weil bestimmte Personen vordem geehrt und geachtet worden waren, doch blieben die zahlreichen Karl-Marx- und sogar Ernst-Thälmann-Straßen meist unangetastet. Die Neuköllner, also Westberliner Karl-Marx-Straße existiert unter diesem Namen seit 1946. Im vergangenen Herbst forderte nun die Monatszeitung Jüdische Rundschau, eine Gegengründung zur Jüdischen Allgemeinen, herausgegeben vom Zentralrat der Juden in Deutschland, in einem Offenen Brief an die Berliner Verkehrsbetriebe den U-Bahnhof Karl-Marx-Straße wegen ›Antisemitismus‹ des jüdischen Deutschen Marx (›übelster Rassist, Antisemit und Menschenfeind Deutschlands‹) umzubenennen. In der Tat hatte dieser keine freundliche Einstellung zum spezifisch Jüdischen, aber ›Antisemitismus‹ trifft die Sache so wenig wie der psychologisierende Ausdruck vom ›jüdischen Selbsthass‹. Will man solche abstrusen Diskussionen künftig auch noch führen müssen?
Wir bleiben bei Beispielen aus der Hauptstadt. Die Fraktion der Grünen in der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg strebt die Umbenennung von Straßennamen mit militärischen Bezugspersonen an, so in dem in Charlottenburg mit der Tauentzienstraße beginnenden ›Generalszug‹ bis zur Gneisenaustraße in Kreuzberg und einschließlich der U-Bahnhöfe Wittenbergplatz und Nollendorfplatz, benannt nach Schlachten des Jahres 1813. In diesem Fall scheint keine Rolle zu spielen, dass hier speziell leitende Offiziere der antinapoleonischen Befreiungskriege von 1813/14 und 1815 sowie der neben Scharnhorst bedeutendste Militärreformer Preußens und einer der entschiedensten Reformer überhaupt, nach 1806 geehrt worden sind – Anfang der 1860er Jahre zweifellos in der Absicht, sie in eine militaristische und antidemokratische Traditionslinie einzureihen. Doch solchen Vereinnahmungsversuchen widersprachen Liberale und dann auch Sozialdemokraten – und am entschiedensten später die SED und die DDR, für die die preußische Reformära und die folgenden Unabhängigkeitskriege zum emanzipatorischen Erbe gehörten. (Vgl. auch den kritischen Artikel des Verfassers zur Umbenennung der Greifswalder Ernst-Moritz-Arndt- Universität, in: NG/FH).
Eine frühere Entscheidung der Bezirksverordnetenversammlung von Friedrichshain-Kreuzberg wirkt geradezu kurios: Der Moses-Mendelssohn-Platz vor dem Jüdischen Museum, benannt nach dem jüdisch-deutschen Aufklärer des 18. Jahrhunderts, konnte so nicht bestehen bleiben, weil ein Grundsatzbeschluss des Bezirks verlangte, dass fünfzig Prozent aller Straßen nach Frauen benannt werde müssten und bis dieser Prozentsatz erreicht sei, Frauen stets der Vorzug zu geben sei. Da man davor zurückschreckte, den höchst ehrenwerten und allgemein anerkannten Namen Mendelssohn abzuschaffen, heißt der Platz seit acht Jahren Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz. Man hat die Gattin hinzugefügt, deren Bedeutung mit mehr als einem Fragezeichen zu versehen ist, aber immerhin eine Frau.
Auf denselben historischen Zusammenhang bezieht sich die Umbenennung der Beuth-Hochschule für Technik, erst 2009 benannt nach dem preußischen Ministerialbeamten und Reformer der handwerklichen-technischen Bildung Peter Christian Beuth (1781-1853). Die Angelegenheit ist hier weniger klar, weil Beuth, wenn auch nicht ganz zweifelsfrei gesichert, in der 1811 gegründeten Berliner Tischgesellschaft, eine Gruppierung vorwiegend von Gegnern und Skeptikern der Staats- und Gesellschaftsreformen, an der aber auch Reformer und eher fortschrittliche Nationalpatrioten beteiligt waren, eine judenfeindliche Rede hielt, die selbst für seine Zeit ungewöhnlich rüde war – die preußische Krone und Regierung unter Staatskanzler Hardenberg erließen am 12. März 1812 das Edikt zur (weitgehenden, noch nicht vollständigen) Judenemanzipation.
Müsste man nach dem Kriterium des Antisemitismus bzw. Antijudaismus nicht auch einen Namensgeber wie den grandiosen Komponisten Richard Wagner eliminieren, der ab Mitte des 19. Jahrhunderts mit einschlägigen Äußerungen hervortrat, doch noch im Mai 1849 in Dresden für die fortschrittliche Paulskirchenverfassung auf den Barrikaden gestanden hatte. Was bedeuten reaktionäre und antihumane Auffassungen, zumal wenn sie öffentlich geäußert werden, in Abwägung zur Gesamtlebensleistung des oder der Betreffenden?
Die Stadt Düsseldorf hat eine viel beachtete Entscheidung getroffen und 2018 eine Historikerkommission unter Vorsitz des Leiters der Mahn- und Gedenkstätte sowie des Leiters des Stadtarchivs, berufen, deren Aufgabe darin bestand, sämtliche Straßennamen zu überprüfen und konkrete Empfehlungen abzugeben (entscheiden kann nur der Rat der Stadt), um ständig neu aufkommenden Vorschlägen und Kontroversen zuvorzukommen. Überprüft worden sind nur die (im Hinblick auf die Untersuchungsschwerpunkte Kolonialismus, Militarismus, Nationalsozialismus und Antisemitismus) nach 1870 gestorbenen Namensgeber; im Januar 2020 ist ein 300seitiger Abschlussbericht mit 79 Einzelgutachten vorgelegt worden. Es werden letztlich nur zwölf Namen zur Umbenennung vorgeschlagen, so etwa die einem selbst nach 1945 antisemitisch hervorgetretenen Komponisten gewidmete Pfiznerstraße. Richard Wagner soll, wie andere ins Visier gelangte Berühmtheiten, nicht getilgt werden. 42 Straßennamen der Kategorie B (teilweise belastet/diskussionswürdig) sollen mit erklärenden Tafeln versehen werden. Allgemein wird betont, dass unbedingt der historische Kontext zu beachten sei. Eine selektive Bewertung oder eine solche nach ausschließlich gegenwärtigen Moralvorstellungen weist die Düsseldorfer Kommission zurück.
Selbstverständlich lässt sich über die Zuordnung einzelner Personen diskutieren. Ob nun beispielsweise Feldmarschall Erwin Rommel (wegen zeitweiliger Nähe zum antihitlerischen Widerstand) würdiger ist (Kategorie B) als Generalstabschef Alfred Graf von Schlieffen, der Verfasser des 1914 modifiziert angewandten deutschen Vormarschplans zur raschen Niederwerfung Frankreichs (Kategorie A), versteht sich jedenfalls nicht von selbst und macht deutlich wie strittig in Abwägung die Würdigkeit der Namensgeber beurteilt werden wird, sobald die Gruppe der großen NS-Verbrecher und anderer Schlächterpotentaten, so der schon 1961 in der DDR eliminierte Name Stalins, als selbstverständlich außer Betracht bleibt.
Die Mohrenstraße in Berlin-Mitte soll künftig den Namen Anton Wilhelm Amo, erster afrikanischer Geisteswissenschaftler an einer preußischen Universität im frühen 18. Jahrhundert, tragen. In dieser Sache hatte sich seit Jahren eine Initiative engagiert, die auf den abwertenden und rassistischen Beiklang des Wortes abhob und eine Änderung verlangte. Ob ›Mohr‹ gleich Schwarzer wirklich so pejorativ besetzt war wie unterstellt, scheint nicht sicher. (›Mohr‹ war im 19. Jahrhundert z.B. der Spitzname von Karl Marx wegen dessen dunklen Teints.) Allerdings war die Sprache und speziell die Begrifflichkeit in älteren Zeiten überall stärker klischeehaft. Aber kann man das heutige Empfinden von sich betroffen Fühlenden zum ausschlaggebenden Kriterium machen, was immer von diesen hervorgebracht wird? Kaum ein Angehöriger der ›Mehrheitsgesellschaft‹ (die als ›weiß‹ charakterisiert und zur Verantwortungsgemeinschaft erklärt wird, obwohl es ja Rassen selbst in dem eingeschränkten Verständnis von räumlich zuzuordnenden, aufgrund äußerlicher Merkmale unterscheidbarer menschlicher Großgruppen schlechterdings nicht mehr geben soll – vermeintlich alles ›Konstruktionen‹ wie die Geschlechter auch) wird es ernst nehmen können, dass der Name ›Mohr‹ in den Ohren einer gewissen Zahl von Mitbürgern angeblich so schrecklich klingt, dass man ihn nicht einmal als Eigennamen ausspricht und stattdessen M*straße schreibt und sagt, inzwischen sogar in amtlichen Verlautbarungen.
Das ebenso verpönte N*-Wort (Neger) galt bis vor einigen Jahrzehnten jedenfalls nicht als diskriminierend, anders als das aus den Südstaaten der USA kommende herablassende ›Nigger‹. Neger (negro, aus dem Spanischen) bedeutet ja nichts anderes als Schwarzer. Natürlich ist zu respektieren, wenn der von den ›Negern‹, auch den emanzipierten und kämpferischen lange selbst benutzte Ausdruck nicht gewünscht wird, aber man sollte nicht der Vorstellung aufsitzen, dass der Kolonialismus und der Neokolonialismus durch eine Sprachpolizei bewältigt wird.
Wir wissen aufgrund der diskurstheoretischen und linguistischen Forschungen heute besser als vor einem halben Jahrhundert, dass und wie sehr Sprache das Denken verformt, aber sprachliche Hürden durch strikte Benennungsregeln schaffen für die Normalmenschen aus den breiten Volksschichten faktisch Kommunikationssperren. Die Meisten haben sich auch früher nicht unbedingt ›politisch korrekt‹ ausgedrückt. Die heutzutage öfter zu hörende Klage, man dürfe ja nicht mehr alles sagen, stammt eben nicht nur aus den Ressentiment-Küchen der äußersten Rechten, sondern auch aus eigenen Wahrnehmungen wenig reflektierter Normalos. Die sozialdemokratischen Arbeiter Berlins nannten den langjährigen zweiten Parteivorsitzenden von 1890 bis 1911, den jüdischen Bekleidungs-Fabrikanten Paul Singer, übrigens gern ›Judenpaule‹. Das war liebevoll gemeint. Zu Singers Beerdigung am 5. Februar 1911 kamen fast eine Million Menschen – der größte Trauermarsch in der Geschichte Berlins.
Von ähnlicher Art wie die inzwischen entschiedene Kontroverse um die Mohrenstraße ist die angehobene Diskussion um die Onkel-Tom-Straße und den U-Bahnhof Onkel-Toms-Hütte in Berlin Zehlendorf, ausgelöst durch die verletzten Empfindungen einiger Afro-Berliner. Denn in den USA ist Onkel Tom, eine Figur aus Harriet Beecher Stowes sensationellem Erfolgsroman Uncle Tom’s Cabin (zuerst 1852), seit der Radikalisierung der Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren der Inbegriff des unterwürfigen Schwarzen. Allerdings: In den 1850er Jahren bedeutete der sentimentale, religiös inspirierte Roman eine unschätzbare Unterstützung für die Abolitionisten, die Bewegung weißer US-Amerikaner (darunter übrigens viele deutsche Einwanderer) für die Abschaffung der Sklaverei im Süden der Vereinigten Staaten. Nach den Maßstäben heutiger Antirassisten waren im 19. Jahrhundert selbst die entschiedensten Demokraten, die überzeugtesten Sozialisten ›rassistisch‹ eingestellt – national überheblich und, um noch einen weiteren der inflationär benutzten »Blindbegriffe« (Reinhard Koselleck) aufzugreifen: ›menschenverachtend‹ ohnehin. Man lese z. B. Friedrich Engels‘ Auslassungen in einem Brief an August Bebel vom 17.11.1885 über Serben, Bulgaren, Griechen und anderes Räubergesindel nach, keineswegs eine vereinzelte Entgleisung. Dabei gibt es themenbezogen durchaus reale Probleme: Die Rede ist, pars pro toto, vom Afrikanischen Viertel im Berliner Wedding. Die Straßennamen dort sind geprägt durch die koloniale Vergangenheit Deutschlands von den 1880er Jahren bis zur Kriegsniederlage im Ersten Weltkrieg einschließlich einer teilweise äußerst blutigen sogar genozidalen Realität. Dieser Aspekt deutscher Geschichte ist im Bewusstsein der Deutschen wie bis zu einem gewissen Grad der Bewohner der ehemaligen Kolonien zurückgetreten, weil eine britische oder französische Kolonialherrschaft folgte mit ebenfalls wenig erfreulichen Zügen.
Seit Jahren wird angestrebt, wenigstens die Namen der schlimmsten Repräsentanten des deutschen Kolonialismus aus dem Straßenbild des Afrikanischen Viertels zu tilgen, in erster Linie den von Carl Peters (›Hänge-Peters‹), dann auch den von Adolf Lüderitz und Gustav Nachtigal, letzterer meist eher als Naturforscher bekannt. Das Problem Peters hatte man vermeintlich schon 1986 durch Umwidmung auf einen ehrenwerten Lokalpolitiker namens Hans Peters gelöst, denn den Straßenschildern fehlte der Vorname. Sicherlich keine überzeugende Lösung, wenn eine noch so bescheidene politisch-pädagogische Aufklärungsabsicht hinter einer solchen Änderung stehen sollte. Anwohner und ansässige Geschäftsleute sind aus naheliegenden praktischen und Kostengründen, auch wegen gewohnheitsbedingter Identifikation mit dem Bekannten, stets skeptisch bis offen ablehnend eingestellt, und die SPD legt in der Regel mehr Wert darauf als die Initiativen und die Grünen die Menschen ›mitzunehmen‹. Eine Initiative ›Pro Afrikanisches Viertel‹ – mit einer Rechtsanwältin als Sprecherin und unterstützt von über 400 Bürgern – will möglichst keine Umbenennungen, ist aber offen für das Anbringen von Tafeln, die das Wirken der Namensgeber in ihrer Zeit kritisch beleuchten.
Symbolkämpfe mögen in manchen historischen Situationen sinnvoll oder gar unvermeidlich sein wie in der Weimarer Republik der Streit zwischen den schwarz-rot-goldenen Farben der gesamtdeutschen Demokratie seit dem frühen 19. Jahrhundert und den aus dem Schwarz-Weiß Preußens und dem Rot-Weiß der Hansestädte traditionslos zusammengesetzten Schwarz-Weiß-Rot des Kaiserreichs, das dann aber von weiten Kreisen angenommen wurde. Nach 1918/19 waren Millionen an der Auseinandersetzung zwischen Schwarz-Rot-Gold und Schwarz-Weiß-Rot beteiligt. Auch wenn nur kleine Minderheiten direkt involviert sind und die Mehrheit sich zunächst bestenfalls gleichgültig verhält, mag es in einzelnen Fällen erforderlich sein, für die Änderung eines untragbaren Namens einzutreten. Symbolkämpfe binden aber Kräfte.
Es ist kein Zufall, dass die hohe Konjunktur der Umbenennungen bei uns wie der Denkmalstürze in den USA und Großbritannien in eine historische Phase fällt, in der ein beträchtlicher Teil des linken Spektrums statt auf die soziale Frage und auf gesamtgesellschaftliche Perspektiven auf die Betonung von Gruppenidentitäten rassischer, ethnischer und sexueller Art (wo inzwischen eine Unzahl an Geschlechtern behauptet wird) und deren Anerkennung im Gemeinwesen umgeschwenkt ist. Aus einer Unterschätzung ist in den hier gemeinten Kreisen eine Verabsolutierung geworden. Die Negativparole von den ›alten weißen Männern‹ mag in den USA einen begrenzten Sinn haben; in Deutschland ist sie albern und irreführend. Wer im Großen Ganzen gestalten und verändern will, braucht Mehrheiten aus den unteren und mittleren Schichten des Volkes, auch wenn diese heterogener zusammengesetzt sind als vor einem halben Jahrhundert. Dieser Mehrheit der innergesellschaftlichen Unterprivilegierten (und auch global nur in einem sehr relativen Sinn Bevorzugten) als ›den Weißen‹ das Büßergewand überstreifen zu wollen, ist sachlich unhaltbar und politisch kontraproduktiv.