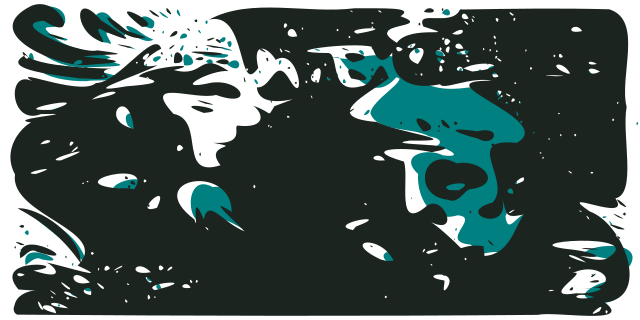von Fritz Schmidt
Das Verhältnis Eberhard Koebels, ›tusk‹, des Gründers des Jugendbundes dj.1.11, Deutsche Jungenschaft vom 1. November 1929, zur Demokratie war zeit seines Lebens von Aversion geprägt. Hierzu gehört der Besuch bei Hitler von 1925 ebenso wie seine Äußerungen in verschiedenen seiner Publikationen, wonach er sich z. B., im Sommer 1928 von der Freischar-Führung zu einem internationalen Pfadfindertreffen in Luxemburg abgeordnet, weigerte, die schwarzrotgoldene Flagge der Weimarer Republik zu hissen. Statt dessen pflanzte er die an das Kaiserreich erinnernde schwarzweißrote Fahne auf, die offensichtlich als Handelsflagge diente: »Ich hatte keine Sympathie zu Republik und Schwarz-rot-gold.« (Der Eisbrecher H. 4/Jan. 1933, S. 99) Wie Verdrängungsmechanismen funktionieren exemplifizierte Koebel nach Tisch, 1949, indem er konstatierte: »Dreizehn Jahre lang wehten die Farben Schwarz-Rot-Gold als Nationalflagge, aber nicht als internationales Hoheitszeichen, denn die Väter der Weimarer Verfassung getrauten sich nicht, sie im Ausland zu zeigen.« (Deutschlands Stimme Nr. 20, 15. 5. 1949, S. 3)
Die die sogenannte Weimarer Republik – in schlechten wie in wenigen guten Zeiten – repräsentierende politische Partei war ohne Zweifel die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die SPD. Zwar war sie, entgegen weitverbreiteter Meinung, nicht allzu oft an den wechselnden Regierungen beteiligt, aber es war die SPD, welche ‒ zwar von Bedenken durchsetzt ‒ die Republik von dem Augenblick an bejahte und stützte, als sie Philipp Scheidemann (1865−1939) am 9. November 1918 ausrief, bis zum 24. März 1933, als Otto Wels (1873−1939) die eindrucksvolle ablehnende Rede − ›Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht‹ – anlässlich der Abstimmung zum sogenannten Ermächtigungsgesetz hielt − ein Gesetz, das Hitler persönlich ermächtigte, Gesetze zu erlassen, was für zwölf Jahre das Ende der Demokratie in Deutschland bedeutete und dem Nationalsozialismus als Synonym der ›legalen Revolution‹ diente. Indes war das ›Ermächtigungsgesetz‹ alles andere als legal, wurde die Zustimmung doch durch Drohungen befördert; die kommunistischen und einige sozialdemokratische Abgeordnete konnten an der Abstimmung weil in Haft befindlich nicht teilnehmen, was das Gesetz allein schon als rechtswidrig kennzeichnet.
Es waren aber auch SPD sowie Zentrumspartei, die sich ebenfalls zur Republik bekannte, denen in demagogischer Absicht die Verantwortung für den Versailler Vertrag angedichtet wurde, mussten doch ihre Vertreter in der Tat den Vertrag unterzeichnen. Die wahren Schuldigen, Monarchie und Oberste Heeresleitung, welch letztere zwar den militärischen Offenbarungseid geleistet hatte, lancierten die ›Dolchstoßlegende‹ und stahlen sich ansonsten aus der Verantwortung.
Eberhard Koebel (1907‒1955), in Stuttgart im deutschnationalen Milieu aufgewachsen und erzogen, vom Soldatentum von Jugend an begeistert, sah in seinen jungen Jahren Politik in schwarzweißen Kategorien. In gewisser Weise begleitete diese Sicht den auf anderen Gebieten Begabten, in Sprache und Sprachen, als Naturforscher, Grafiker und Fotograf sowie vor allem als innovativer Jugendführer im vorhitlerischen Sinne, ein Leben lang. Im Mai 1931 fasste er sein politisches Kredo folgendermaßen zusammen: »Politik fängt eigentlich erst an, wo die deutschen Grenzen aufhören. Politik sind die Angelegenheiten, die das Reich mit anderen Reichen zu erledigen hat. Was man hier meist unter Politik versteht, ist gar keine Politik. Vielmehr ist das die Betätigung der Parteien, um möglichst viele Anhänger zu erwerben.« (Das Lagerfeuer 5, Mai 1931, S. 9) Kein Gedanke z. B. daran, dass die soziale Frage, die Ende des 19. Jahrhunderts den Aufstieg der Sozialdemokratie eingeleitet hatte und die Koebel selbst noch beschäftigen sollte, eine höchst politische sein könnte.
Zu einem Bericht von Jürgen Riel in den »Briefen an die deutsche Jungenschaft« (11/1929), dass unter dem Eindruck des Wandervogels im ›Bund der Roten Falken‹ auch Arbeiterjungen auf Fahrt gingen und nicht mehr unter dem Einfluss von Lehrern und Pfarrern stünden, merkte tusk süffisant an, »sondern von sozialdemokratischen Parteisekretären«. Weitere Seitenhiebe in Richtung SPD finden sich im ›Protokoll der Besprechungen auf dem Reichshortenlager 1931/32‹: Es habe sich in völliger Klarheit gezeigt, dass der Weg der SPD falsch gewesen sei. »Heute fühlen sich die Wähler der SPD verraten. Obendrein ist eine widerliche Korruption in der Partei eingebrochen.« Da verwundert es schon, daß tusk noch 1933 einen Aufsatz veröffentlichte mit dem Titel: »Diktatur oder Demokratie?«, worin er, neben der grundsätzlichen Führer-Führungsgewalt, sogar konzedierte, dass es der Autorität des Jungengruppenführers keinen Abbruch täte, wenn er die Gruppe über kulturelle Belange auch einmal abstimmen ließe ... (Der Eisbrecher 10/Juli 1933, S. 264) (Wer einer Gruppe angehört hat, weiß, daß solche Abstimmungen zum Gruppenleben gehören.)
Selbstverständlich gerierte sich tusk als Gegner des Versailler Vertrags: »Der Versailler Friedensvertrag hat Danzig und Memel vom Reich gerissen, hat Ostpreußen von Kerndeutschland getrennt, hat Deutschlands Heer viel schwächer als das polnische gemacht. Die Jugend der herrschenden Länder, die Skauts, treffen sich heuer auf ehemals deutschem Gebiet, in Gdingen, einem neuen polnischen Hafen. Litauen will Memel, Polen will Danzig und Ostpreußen. Drohung und Herausforderung ringsumher.« (Das Lagerfeuer 4/1932, S. 32)
Dies hielt tusk nach der Hinwendung zur Kommunistischen Partei fest, mit der er 1932 in der Jugendbewegung Furore machte. Allerdings hatten sich sämtliche Parteien der weitgehend ungeliebten Republik, von rechts außen bis zur KP, die Gegnerschaft zu Versailles auf die Fahnen geschrieben, sodass obige Erklärung kein Dissens zu tusks KP-Bekenntnis ist. Zwar agierte die KPD in der Weimarer Republik noch als demokratische Partei, aber dem aufmerksamen Beobachter konnte nicht verborgen geblieben sein, dass KPD wie NSDAP auf die Vernichtung der Demokratie hinarbeiteten. (Dass hieran auch die deutschen Wirtschaftseliten nicht unbeteiligt waren, soll nur angemerkt sein.)
Bereits an Ostern 1933 verabschiedete sich tusk vom Kommunismus. Arno Klönne meint, eine ›weltanschauliche Wende‹ vom Kommunismus zum Nationalsozialismus müsse bei ihm keine große Kehre bedeutet haben, weil seine politischen Ideen wissenschaftlich-analytisch nicht so tief begründet gewesen seien. Mit letzterer These dürfte Arno Klönne zwar nicht falschliegen, aber tusks Abwendung vom Kommunismus und seine Hinwendung zum NS kann ihm nicht schwergefallen sein, berücksichtigt man seine Herkunft aus deutschnationalem Bürgertum und Antikommunismus sowie seine Vergangenheit als Anhänger Hitlers. Seine Mutter war seit 1929 NSDAP-Mitglied.
Nach dem Abschied von der KPD wandte sich tusk wieder seiner dj.1.11 zu. Das NS-Regime stellte er sich als autoritären, kriegsbereiten Staat vor, mit dem man kooperieren könne. Ebenso mit der Hitler-Jugend. Ab den Osterlagern 1933 propagierte er: ›Hinein in die Hitler-Jugend‹, was auch damit zusammenhängen wird, dass sich dj.1.11-Gruppen der Hitler-Jugend anschlossen, wie er z. B. bei einem Besuch in Ludwigsburg feststellen musste. In einem Gruppenheft über das Osterlager 1933 dort heißt es zum Schluss: »Viel an Äußerlichkeiten haben wir geopfert. […] Und der eine arbeitet hier, der andere dort in der Staatsjugend, die alle aufbauenden jungen Kräfte umfaßt. Und wir brauchen keine graue Fahne [der dj.1.11, F. S.] mehr, denn wir haben eine bessere« ‒ die Hakenkreuzfahne …
Um eine Überlebenschance für seine kleine dj.1.11-Jungenschaft verhandelte tusk Ende 1933 in Stuttgart mit dem HJ-Gebietsführer sowie dem Leiter des Württembergischen Politischen Landespolizeiamts, der späteren Gestapo, über die Jahreswende 1933/34 hielt er in Muggenbrunn ein Skilager in einem festen Haus ab, wozu noch eine Reihe Getreuer erschienen. Am 18. Januar 1934 wurde tusk auf Befehl aus Berlin verhaftet, einer seiner Stuttgarter Gesprächspartner, der Gestapo-Chef Dr. Mattheiß, als einziger Württemberger nach dem 30. Juni 1934 ermordet, was damit zusammenhing, dass ›Reichsführer-SS‹ Heinrich Himmler für einen höheren SS-Führer einen Posten brauchte, der Württemberger jedoch nicht weichen wollte. Das brachte ihn als SA-Mann auf die Abschussliste des 30. Juni.
In Gestapo-Haft in Berlin fügte sich tusk bei Suizidversuchen schwere Verletzungen zu. Nach seiner verletzungsbedingten Freilassung und notdürftiger Heilung emigrierte er. Auf dem Weg ins Exil machte er unterschiedliche Erfahrungen, sehr schlechte in der Musterdemokratie Schweden, in der er sich vergebens Aufnahme und Arbeitsmöglichkeit erhofft hatte. Besser erging es ihm in seinem endgültigen Asyl England. Sicherlich bedeutete der Wechsel dorthin einen Einschnitt im Leben der Koebels – tusks Frau Gabriele, Gabi (1906‒2003), war ihm bereits nach Schweden gefolgt, und mit Hilfe eines ehemaligen Patienten ihres Vaters bekamen sie im britischen Königreich Aufenthaltserlaubnis. Was ja nicht hieß, dass nun Milch und Honig flossen. In den wenigen Briefen über die erste Zeit in Großbritannien, die ich auffinden konnte, berichtet tusk über London: »Ich habe gemeint, die Berliner Hysterie sei Weltstadtsymptom. Aber ich habe jetzt gelernt, daß sie eine Berliner Hysterie ist. Hier sind die Menschen konzentriert, gefaßt und prompt.« (Brief an Heinz Ibrügger u. a., vermutl. Ende 1934) Ein paar Jahre später setzte die Gestapo in England einen Spitzel auf ihn an, nach dem Krieg waren es unter anderen Vorzeichen britische Stellen und zum Schluss die Staatssicherheit der DDR, die ihn überwachten.
Von Politik ist in den oben angeführten Briefen nicht die Rede, dagegen gingen ihm seine Verhaftung und Flucht nach: Kritische Erlebnisse hätten ihn zu der Frage gezwungen, was eigentlich wesentlich sei und was nicht, berichtete tusk nach Zürich an Carl Gustav Jung (Brief v. 16. 10. 1935, ETH-Bibliothek Zürich), dem er den Text des ›Brennenden Dornbuschs‹ geschickt hatte. Der »Brennende Dornbusch«, eine Geschichte der Erleuchtung von Moses bis zu Shoseki Kaneko, einem japanischen Denker, die ihn in den Anfangsjahren der Emigration beschäftigte und die er auf ca. 200 Typoseiten niederschrieb. »Die ›innere Richtung‹ kann definiert werden: ›unerschütterlichen Glauben an die Realität von Erleuchtung‹. Daraus ergibt sich […] das eigene Lebensziel«, bekannte tusk. (Brief an Heinz Ibrügger v. 18. 7. 1935) – Eberhard Koebel war stets überzeugt, ein konsequentes Leben zu führen, aber er orientierte sich öfter um, was ihm den Vorwurf des Opportunismus einbrachte; dieser Vorwurf lässt die widersprüchlichen Zeitläufte außer acht, die den darin Verwickelten zum Umdenken veranlassten. Nach den Ereignissen von 1934 ist deshalb die Suche nach metaphysischem Lebenssinn Koebels verständlich: »Wie sehnte er sich selbst nach einem solchen Erlebnis!« befindet sein Freund Hans Seidel. (Gedächtnisrede auf E. K., in Grauer Reiter 17/1955, S. 9) Dieses blieb ihm letztlich versagt.
Als authentische zeitgenössische politische Äußerungen können Passagen in Briefen Koebels an Helmut Hirsch (s. F. Schmidt: Helmut Hirsch. Ein junges Leben vom Nationalsozialismus gewaltsam ausgelöscht. Baunach 2015) gelten, welch letztere erhalten geblieben sind. Ihn ließ er im Oktober 1935 wissen, zur KPD sei er nur gegangen, weil er sie als die einzige radikale Anti-NS-Organisation erkannt gehabt hätte. Proletariat etc. sei ihm »wurscht« gewesen; hätte er den Ausgang gewusst, wäre er gleich zu Strasser! In einem weiteren Brief vom 7. Dezember 1935 präzisierte er: »... denn an K.P.-Sieg glaube ich nicht. Der Bolschewismus ist wesentlich unschöpferisch. Seine Grosstaten sind intellektuell. Aus ihm kann kein Nietzsche, kein van den Bruck, nicht einmal ein Spengler entstehen.« (Briefwechsel E. K.‒H. Hirsch in Brandeis University Waltham/Mass., USA) Sicherlich verfolgte er die Ereignisse in der Sowjetunion von 1937, denn bereits in einem Brief an Klaus Zwiauer vom 15. November 1935 (NRWH Düsseldorf, Rep. 17, Nr. 292/293/294) weist er auf den Kirow-Mord sowie auf weitere Mordtaten hin und stellt sie in einen Zusammenhang mit der Gestapo – ›Großtaten‹ indes, die alles andere als intellektuell waren ... Dazu muss ergänzt werden, dass nach dem wenigen, was uns vorliegt, der eigentliche Beweggrund für die Hinwendung zur KPD die Not der Heimat in der Weltwirtschaftskrise gewesen ist und nicht in erster Linie die Gegnerschaft zum NS, die selbstverständlich in der KP mit angelegt war. Zum Hauptfeind wurden die Nazis erst nach tusks Festnahme am 18. Januar 1934.
Das Leben tusks, wie es verlaufen ist, ist ohne Heinz Krohn nicht erklärbar, was oft übersehen wird. Dagegen dürften gelegentliche Kontakte zu Richard Scheringer oder Ludwig Renn nur eine Nebenrolle gespielt haben. tusk hatte Heinz Krohn im Atlantis Verlag in Berlin, wo er ab 1930 als Hersteller arbeitete, als Kollegen angetroffen. Heinz, aus Kall, Kreis Schleiden/Eifel stammend, von Beruf Buchhändler, machte alsbald bei dj.1.11 mit und wurde Bundessekretär. Andererseits war er Kommunist und hat tusk mit Sicherheit im Sinne der KP bestärkt, nachdem dieser die ärmlichen Lebensbedingungen des Proletariats in seiner ersten Untermiete am Halleschen Tor erfahren hatte. Nach tusks Umdenken 1933 trennte sich Heinz, der arbeitslos geworden war, von ihm und dj.1.11. Er blieb der KP treu und folgte ihren Aufrufen; bei ihm wurden von der Polizei Drucksachen und Flugblätter gefunden, letztere des Inhalts, dass die KP den Schulterschluss mit der SPD suche: ›SPD-Genossen, der Sieg ist unser, wenn ihr einschlagt −‹ (nachdem die KP vorher die SPD als ›Sozialfaschisten‹ bekämpft hatte!). Heinz Krohn (1909−1943) wurde am 22. Juli 1933 verhaftet und kam nach Verurteilung erst 1935 aus dem Gefängnis wieder frei, wobei das Gericht festgestellt hatte, dass die inkriminierten Taten bereits vor dem Verbot der KP geschehen seien … (BArch, Zwischenarchiv Dahlwitz-Hoppegarten, NJ 1272) Zwar wollte die KPD-Genossin Milda Voss in einem Statement gegen tusk suggerieren, dass Heinz Krohn aufgrund eines Verrats Koebel-Tusks, wie er sich nach dem Krieg nannte, von der Gestapo verhaftet worden sein könnte, doch fehlt dafür jeglicher Beweis. Der Verhaftungsgang Krohns war ein völlig anderer. (Von Heinz Krohns weiterem Lebensweg ist nur bekannt, dass er im Krieg um Aufnahme in die deutsche Wehrmacht nachsuchte und als Soldat in der Ukraine vermisst ist. Diese Tatsache lässt ahnen, wie Krohns Leben im NS-Regime verlaufen war. Meines Wissens hat sich Eberhard Koebel nach dem Krieg nicht mehr nach Heinz Krohn erkundigt.)
1937 wurde der Koebel-Vertraute Klaus Zwiauer mit weiteren ehemaligen dj.1.11-Angehörigen und -Sympathisanten wie Hans Scholl verhaftet und vor Gericht gestellt. Im Gestapo-Verhör gab er, lt. Akten / Vernehmungsprotokoll zum Verfahren des Sondergerichts Stuttgart 19 Js 113/37 (NRWH Düsseldorf, Rep. 17, Nr. 292/293/294) u. a. an, dass Koebel im Jahre 1933 den Kommunismus endgültig abgelegt gehabt habe, weil er das, was er im Kommunismus gesucht hätte, nicht gefunden habe und auch seine Ziele nicht darin verwirklichen konnte. (Mir ist aus zuverlässiger Quelle bekannt, dass Klaus Zwiauer bei den Verhören durch schwäbische Gestapo keinen Pressionen ausgesetzt war.)
Die Zerschlagung illegaler dj.1.11-Gruppen und Verhaftung von Freunden 1937 schnitten tusk von Deutschland ab, und er wandte sich wieder dem Kommunismus und diesem nahestehenden Jugendorganisationen zu. Doch noch 1940, zur Zeit des Hitler-Stalin-Paktes, trug er in sein Tagebuch, zwar eher referierend, wiederum das bolschewistische Russland und das Deutschland Hitlers in einem Atemzug ein: von beiden Ländern würden in Großbritannien mit Entrüstung Fälle erzählt, wonach Klassen- und Staatsinteresse mehr wögen als Familienbande! (Archiv der deutschen Jugendbewegung Burg Ludwigstein (AdJb), NL E. K. N 6) Gegen Kriegsende, als er von einer Tbc gesundet war, näherte er sich wieder dem Kommunismus und einer in Gründung befindlichen Freien Deutschen Jugend (FDJ) an.
Nach Kriegsende nahm Koebel umgehend Kontakt zu ehemaligen Freunden in Deutschland auf, und umgekehrt wendeten sich solche an ihn in London. So auch Horst Schenk-Mischke, ehemals dj.1.11 Berlin. Diesen hatte es ins Westfälische verschlagen. In einem ersten Brief vom 17. Januar 1947 berichtete er tusk, dass er am Wiedererstehen der Jungenschaft Interesse hätte und publizistisch dafür wirken wollte. Nachdem einige Briefe hin- und hergegangen waren, teilte ihm tusk mit, dass er der SED nahestehe, und Schenk-Mischke retournierte, er und Georg Neemann gehörten aktiv der SPD an. Das kam bei tusk nicht gut an: »Dass Du in der SPD bist, beunruhigt mich ein bißchen. Kannst Du diese Parteizugehörigkeit denn mit Deiner Loyalität zu mir und dj.1.11 in Einklang bringen?« schrieb er am 1. Januar 1948. Darauf antwortete Schenk-Mischke am 26. u. a.: »Warum sollte sich meine Zugehörigkeit zur SPD mit meiner Einstellung Dir gegenüber nicht in Einklang bringen lassen? Ich bin Demokrat, und zu den obersten Grundsätzen der Demokratie gehört die Toleranz Andersdenkenden gegenüber.« Darauf erwiderte tusk am 2. Februar: »Als ich meiner Beunruhigung wegen Deiner S.P.D.-Aktivitäten Ausdruck verlieh, dachte ich an die anti-deutsche Stellung der S.P.D. in den nordschleswiger Wahlen und dem Saar-›Plebiszit‹, ferner an ihre Sabotage des Volkskongresses [1. Deutscher Volkskongreß für Einheit und gerechten Frieden am 6./7. 12. 1947 in Berlin, von der SED veranstaltet und dominiert, vom SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher abgelehnt, F. S.] oder des vorangegangenen CDU-Versuchs, eine nationale Vertretung herzustellen. Daß alle diese Schritte unter der Nebeldeckung anti-bolschewistischer Propaganda gemacht werden, ändert an ihrem anti-deutschen Charakter nichts, erinnert aber peinlich an Hitler. Ich nehme an, daß Du in diesen Punkten opponierst. Aus dem Teil I der Gegenw.[arts]-Geschichte geht auch meine Abneigung gegen die Politik der damaligen (wie jetzigen) S.P.D. hervor, fremdes Kapital nach Dtld. zu schleusen und dafür eine Hypothek auf die deutsche Handlungsfreiheit aufzunehmen. Wenn Du diese Politik mit unserer damaligen gleichsetzt (›Ich bekenne mich auch heute noch zu ihr‹), dann ist das bedenklich.«
Bemerkenswert an dieser Verlautbarung tusks ist seine nationalistische Einstellung – Schenk-Mischke begründete seine politische Überzeugung am 28. März mit den Erfahrungen im NS-Regime und sechs Jahren Krieg: »Du hast den Nazismus aus eigener Anschauung sicherlich äußerst unangenehm, aber dafür auch nur kurz genossen.« Er hielt tusk verschiedene Widersprüchlichkeiten der kommunistischen Parteien vor und vergaß dabei den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt von 1939 nicht. (Briefwechsel im Nachlass Horst Schenk-Mischke in AdJb) Doch soll uns das nicht weiter beschäftigen; seine politische Haltung und sein Politikverständnis, insbesondere gegenüber der Weimarer Republik, hat Koebel oben dargelegt. Eine klare politische Vorstellung ist darin nicht zu erkennen. Angemerkt soll noch sein, dass sich tusk gegenüber Georg Neemann äußerst misstrauisch verhielt, aus welchen Gründen auch immer. Letzterer, später für die SPD im Bundestag, hatte Schenk-Mischke die Anschrift tusks vermittelt; auch er wollte sich am Aufbau der Jungenschaft beteiligen. – Koebel kehrte im Sommer 1948 nach Berlin zurück.
Außer den ›Londoner‹ und ›Berliner Briefen an die Deutsche Jungenschaft‹ und ›Gegenwartsgeschichte‹, die hier außen vorgelassen werden, kenne ich keine weiteren einschlägigen zeitgenössischen Überlieferungen; die sonstigen erhaltenen Stellungnahmen sind rückblickend und müssen kritisch gesehen werden. Denn wie in einem Lebenslauf (AdJb, NL E. K.) beteuert tusk in einem 34seitigen Dokument, »Ergänzende Informationen zu meinem am 1. September 1951 bei der Zentralen Partei-Kontrollkommission eingereichten Einspruch gegen den am 2. Februar 1951 erfolgten Ausschluss aus der Wohngruppe 105 – (Kreis Berlin-Pankow)«, seine »restlos positive Haltung zur Sowjetunion«. Gegen diese habe er nie gekämpft (BStU, MfS 589/57, Bd. 2, Bl. 93) ‒ sich wohl aber distanziert gehabt, was er natürlich für sich behielt.
Diese 34 Seiten mit dem etwas sperrigen Titel sind insofern bemerkenswert, weil Koebel darin einiges über sein Leben in der Emigration auf der britischen Insel berichtet. Nichts jedoch über seine religiös-religionsgeschichtliche Phase und die Suche nach einschlägiger Erleuchtung 1934/35.
Ebenfalls über den Aufenthalt im Exil gibt »England wohin« einigen Aufschluss. (AdJb, NL E. K.) Gleich zu Anfang heißt es darin: »Die kleine Arbeit erscheint zu einer Zeit, in der die Welt in zwei Lager gespalten ist: das vielfältig blühende und aufbauende Friedenslager, und das Lager der imperialistischen Kriegsvorbereiter und Angreifer.« In »England wohin?« lässt Koebel im nachhinein wenig gutes Haar an dem Gastland, das ihm und seiner Familie – auf der Insel wurden ihm zwei Söhne geboren – Zuflucht gewährt hatte. Anlässlich eines Besuchs im Parlament prangert er das britische Wahlsystem an, einschließlich von – allgemeinmenschlichen – Auswüchsen wie Ränkespielen, Korruption und Nepotismus, sowie Börsenspekulation. Nicht erwähnt zu werden braucht eigentlich, dass dies alles den Kapitalismus meint, unter besonderer Berücksichtigung der damaligen britischen Klassengesellschaft mit den tatsächlich prekären Lebensverhältnissen der Unterschicht. Eingerahmt von diesen Befindlichkeiten mit den den Kontinentaleuropäer belustigenden wie irritierenden Gebräuchen und ›spleens‹ in Parlament und Alltag (was sich neuerdings im ›Brexit‹ austobt), hat Koebel einige Erzählungen aus seinem Leben in den schicksalhaften Jahren 1933/34 platziert, von denen man nicht weiß, wieweit sie Dichtung sind oder der Wahrheit entsprechen? Immerhin bezeichnete er »England wohin?« als einen ‹antiimperialistischen Emigrationsroman‹, für den er freilich keinen Verlag fand.
Ist die vorgenannte Abhandlung voll von antibritischen Sentiments, lästs eine Aussage von Karl Siemens aufhorchen. Ihm gegenüber soll Koebel-Tusk geäußert haben, er müsste einmal England kennenlernen, dann erhielte er eine ganz andere Auffassung von wahrer Demokratie! (BStU, MfS 604/56, Bl. 95) Nach Lage der Dinge käme hier nur die parlamentarische Demokratie in Frage. In der Tat muss er Verbindungen zu britischen Parlamentariern unterhalten haben, z. B. zu Kronanwalt Denis Nowell Pritt, einem linksstehenden ehemaligen Labour-Abgeordneten. Pritt (1887−1972) hatte sich, einem Lebenslauf Koebel-Tusks zufolge, für seine Rückkehr nach Deutschland eingesetzt, ebenso wie »ein anderer Labourist« (ebd.). (AdJb, NL E. K.) Womöglich war dieser ›Labourist‹ Richard Crossman. Nach einer Quelle hatte Koebel-Tusk in England Kontakt zu dem Labour-Politiker Richard Crossman – wozu passen würde, dass tusk 1942 nach eigener Aussage als Fremdsprachenabhörer bei der BBC arbeitete, seine Frau wohl längere Zeit ebenfalls dort. Crossman, 1907−1974, hinwiederum war Chef der Psychological Warfare Division, derjenigen Institution, welcher die alliierte Öffentlichkeitsarbeit wie auch die Propaganda gegen die Achsenmächte mittels Radio u. a. oblag.
1958 erschien als letztes Heft der ohne Koebel gegründeten, nun insolventen Nachkriegs-Zeitschrift »Das Lagerfeuer« eine durcheinandergewürfelte Zusammenstellung von Zitaten aus Koebelschen Publikationen (verantwortlich Henning Meincke), die geeignet war, das so schon verwirrende Leben des Protagonisten noch zusätzlich zu verzerren, wenn nicht zu diskreditieren. Unter dem Titel »In schlechter Gesellschaft« wurde eine Passage von James P. O’Donnell aus der »Welt« vom 10. November 1956 übernommen, wonach Koebel, hier Köbel, während des Krieges für den britischen ›Soldatensender Calais‹ unter Sefton Delmer gearbeitet habe. In diesem Artikel wurde das Engagement für den ›Soldatensender Calais‹, insonderheit derjenigen Zeitgenossen, die es in die DDR verschlagen hatte, als besonders schmierige Tätigkeit hingestellt; indes brachte das Heft gegenüberstehend eine Stellungnahme von Paul Haubrich, Journalist aus Köln, Koebel seit langem verbunden, aus der »Welt« vom 13. November 1956, die besagte, daß »Herr Koebel« […] »niemals zum Stab des Soldatensenders Calais« gehört, sondern mit Ausnahme von zehn Monaten die Jahre 1940 bis 1944 an Tbc leidend in Krankenhäusern verbracht habe.
Damals, in den 1950er Jahren, nach dem Tod von Koebel am 31. August 1955 in Ost-Berlin, hatte dies offensichtlich Bedeutung, waren doch auch die Beteiligten des 20. Juli 1944 noch vielfach geächtet. Eberhard Koebel-Tusk, wie er sich in der DDR als Schriftsteller nannte, war 1951/52 aus der SED ausgeschlossen worden, nicht ohne Zutun der bereits erwähnten Milda Voss, die teils unwahre Anschuldigungen erhoben hatte. Den Rest seines Lebens verwandte Koebel-Tusk vergebens darauf, wieder in die Einheitspartei aufgenommen zu werden. In bemerkenswerter Eindimensionalität gefangen – die Arzt-Freund Seidel auch auf psychische Erkrankung zurückführte –, wollte er offensichtlich bis zuletzt seine Abwendung vom Kommunismus kompensieren.
Politik war nicht das Feld des mit genialischen Momenten ausgestatteten Jugendführers im eingangs angedeuteten Sinne, wo sich dieser Begriff zwar auch schillernd, aber nicht totalitär verstand.