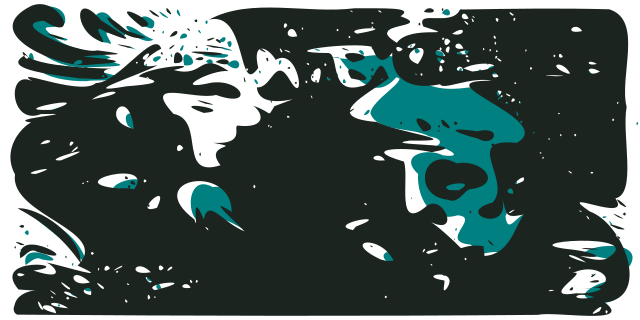von Kay Schweigmann-Greve
Rüdiger Ahrens: Die Bündische Jugend. Eine neue Geschichte 1918-1933, Göttingen (Wallstein) 2015, 477 Seiten
Das hundertjährige Jubiläum des Meißnertages 1913, eines wichtigen Treffens der bürgerlichen Jugendbewegung, die sich bis heute als ›bündisch‹ versteht, liegt gerade zwei Jahre zurück. Dort waren zwei »dunkeln Seiten der Jugendbewegung« kontrovers wie ein jüngst erschienener Beitrag titelte. Während die ›Blüherei‹, der pädophile Missbrauch insbesondere von Jungen in verschiedenen Bünden der Jugendbewegung auf dem Meißnerlager 2013 selbst Thema war, war die Frage des politischen Selbstverständnisses und der eigenen politischen Geschichte durch den Ausschluss bestimmter Bünde von dieser Erinnerungsparty der großen Mehrheit der heutigen Bünde verbannt.
Unter den Hinauskomplimentierten befanden sich die Fahrenden Gesellen ein Bund, der bereits 1913 auf dem Meißner vertreten war und dessen deutschnationale und antisemitische Frühgeschichte bekannt ist. Mit den Deutschen Gildenschaften war eine Organisation betroffen, die bis heute an der Schnittstelle zwischen demokratischem Konservativismus und radikaler Neuer Rechten angesiedelt ist. Bei dem dritten betroffenen Bund, dem Freibund handelt es sich um eine jüngere Organisation, die als Abspaltung vom Bund Heimattreuer Jugend unstreitig aus dem rechtsradikalen Spektrum stammt, aber für sich in Anspruch nimmt, sich in einem bewussten Prozess von diesem Hintergrund gelöst zu haben. Von diesen, als ›völkisch‹ apostrophierten Gruppen grenzte sich die Mehrheit der heutigen bündischen Jugend entschieden ab.
Das Meißnerlager 2013 war jedoch nicht die einzige jugendbewegte Aktivität in jenem Jahr: Neben dem eindrucksvollen Kothen- und Jurtenlager am Hohen Meißner gab es eine ›Meißnerwanderung‹ der ›rechten Bünde‹. Die Nerother Wandervögel, immerhin ein Bund, der auf eine historische Kontinuität bis zurück in die Zwanziger Jahre verweisen kann, feierte, wie sein Bundesführer verlauten ließ, ganz für sich allein. In Weimar fand ein weiteres Lager statt, ausgerichtet von der SJD-Die Falken, als der auf dem Meißner wie vor einhundert Jahren unerwünschten historischen Erben der Arbeiterjugendbewegung. Ende August traf man sich in der Goethestadt und stellte eine Verbindung zum Weimarer Arbeiterjugendtag 1920 her. Ebenfalls dort vertreten waren der sich als politisch fortschrittlich verstehende Bund Deutscher Pfadfinder (BDP), Einzelne aus verschiedenen bürgerlichen Bünden, eine Vertreterin des israelischen Jugendbundes Hashomer Hazair, als Nachfahrin der Jüdischen Jugendbewegung, marokkanische Gäste des BDP und Vertreterinnen des Bundes der Alevitischen Jugendlichen, der sich hierzulande formierenden migrantischen Jugendbewegung. Doch die unangenehme Frage nach der rechten eigenen Vergangenheit und das heutige Verhältnis zur bündischen politischen Rechten der Meißnerfahrer 2015 ließ sich nicht per Beschluss erledigen: Selbst die Jugendburg Ludwigstein, mit dem Archiv der Deutschen Jugendbewegung, der Burgstiftung und der Bildungsarbeit eine Art geistiges Zentrum der bürgerlichen deutschen Jugendbewegung, sah sich mit dem Vorwurf konfrontiert, sie betreibe ›rechte Milieubildung‹.
Nun liegt mit der Dissertation von Rüdiger Ahrens Bündische Jugend. Eine neue Geschichte 1918-1933 eine faktengesättigte Studie vor, an der die historische Diskussion über Organisationen, Gedankengut und Praxis der bündischen Jugend nicht mehr vorbei gehen kann. Ahrens betrachtet die bündische Jugend als einen distinkten Teil der allgemeinen Jugendbewegung, die in Folge der Industrialisierung und der raschen Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse im letzten Jahrzehnt des 19 Jh. entstanden war und in der ersten Hälfte des 20. Jh. in allen Teilen der deutschen Gesellschaft eigene Formen hervorbrachte: »In diesen Zusammenhang kann die bündische Jugend eingeordnet werden. Sie verstand sich als Fortsetzung und zeitgemäße Aktualisierung des Wandervogels, nahm aber auch Anregungen der ursprünglich aus England stammenden Pfadfinderbewegung auf und integrierte neu entstehende, dezidiert politisch ausgerichtete Gruppen. Gegenüber anderen Jugendorganisationen, die etwa in Anlehnung an Parteien und Kirchen oder im Arbeitermilieu entstanden waren und sich ebenfalls als Teil der Jugendbewegung sahen, war die bündische Jugend auf Abstand bedacht.« (S. 10) Nicht nur jugendkulturell, sondern auch politisch ordnet er die bündische Jugend klar zu: »Die bündische Jugend gehört in den Zusammenhang der deutschen politischen Rechten, die das ›Volk‹ als historisch-genetischen Abstammungsverband gegen den Individualismus der Liberalen und den Klassenkollektivismus der Linken zum Subjekt der Geschichte erklärte.« (ebd.)
Mehrfach betont er zu Recht, dass der Begriff ›bündisch‹ bereits in den Jahren der Weimarer Republik von erheblich mehr Gruppen verwandt wurde, als er selbst als solche anspricht und dass der dynamische jugendlich-›bündische‹ Stil von Fahrt, Lager, Lebensgemeinschaft und charismatischer Führung auf viele Gruppen, selbst jenseits der bürgerlichen Jungendbewegung, ausstrahlte. »Doch welche Gruppen gehörten zur bündischen Jugend? Ein analytischer Begriff des ›Bündischen‹ ist nicht zu gewinnen, zu unspezifisch sind die Charakteristika der Organisations- und Lebensform ›Bund‹. Problematisch ist auch der Bezug auf die Selbstbezeichnung einer Gruppierung als ›bündisch‹, denn die große Verbreitung des Attributes macht es unmöglich, klare Grenzen zu ziehen.« (S. 10) Sinnvoll erscheint ihm daher ein Zuschnitt des Untersuchungsgegenstandes als Kommunikationsgemeinschaft. Vier Charakteristika macht er für diese Gruppe aus: - den Anspruch, legitimer einzige Nachfolger der Wandervögel der Vorkriegszeit zu sein,
- die Unabhängigkeit von anderen Gruppen,
- die wechselseitige Anerkennung als ›gleichgeartet‹
- und eine weitgehende politische Übereinstimmung.
»Die bündische Jugend bildete eine ›Szene‹ im Sinne eines themenfokussierten Netzwerkes, das sich durch Kommunikation und Interaktion, nicht durch scharf abgrenzbare ›Mitgliedschaft‹ konstituierte.« (S. 19) Die Probe aufs Exempel bilden hier die jüdischen Jugendbünde, welche die beiden ersten Kriterien durchaus erfüllten. Aufgrund der antisemitischen, völkischen politischen Übereinstimmung der Bündischen konnten Vertreter der jüdischen Jugendbünde nicht in deren ›überbündischen‹ Organen publizieren und wurden zu den entsprechenden Treffen auch nicht eingeladen.
Dies Argument ist stark: Bereits die Gründung des Jüdischen Wanderbundes Blau-Weiß war Folge weit verbreiteter Ablehnung jüdischer Mitglieder im WV der Vorkriegszeit. Auch die Gründer des Haschomer Hazair, der seine entscheidende Ausprägung unter galizischen jungen Juden fand, die während des Ersten Weltkrieges als Flüchtlinge in Wien lebten und den Wandervogel sehr bewunderten, konnten von einem Gespräch – gar auf Augenhöhe – mit dem österreichischen WV nicht einmal träumen. (Lamm, Zvi: Youth takes the lead. The Inception of Jewish Youth Movements in Europe. Yad Yaari, Givat Haviva, 2004.) Die österreichischen WV hatten bereits seit 1913 einen ›Arierparagraphen‹ in ihrer Satzung, der nicht nur Juden, sondern auch ›Welsche‹ (Menschen des romanischen Kultur- und Sprachkreises) und Slawen von der Mitgliedschaft ausschloss. Auch Guy Stern (geb. 1922), Hildesheimer Mitglied des jüdischen Schwarzen Haufens berichtet von der im Antisemitismus begründeten Isolation seines Bundes auch schon vor der Machtübergabe an die Nationalsozialisten. (In einem Vortrag am 23.11.2013 in der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover.)
Nach der langen antisemitischen Vorgeschichte im deutschen Bürgertum dürften die Mitglieder der meisten jüdischen Bünde in den Weimarer Jahren jedoch auch selbst kaum noch Interesse an näherer Berührung gehabt haben, ihr Anliegen war die Förderung jüdischen Selbstbewusstseins und jüdischer Selbstachtung. Auch assimilierte deutschnational eingestellte jugendbewegte Juden, wie sie die Kammeraden organisierten, waren zunächst bemüht, die jüdische Selbstachtung der Mitglieder ihres Bundes zu fördern, dies galt noch mehr für nationaljüdische Bünde. Grundlage hierfür war ein konfessionalisiertes Verständnis ihres Judentums als ›deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens‹, die Arbeit war nach innen gewandt, ähnlich wie bei christlich konfessionellen Bünden. Soweit die Bünde zionistisch ausgerichtet waren, diente ihre Arbeit ohnehin der Vorbereitung auf die ›Alia‹, den Aufstieg nach Palästina, und war am Kontakt zu deutschen Bünden nicht interessiert. (Als ›Palästinenser‹ bezeichnete man damals die dort eingewanderten Juden, während noch niemand daran dachte die dortigen Araber oder ›Fellachen‹, die sich von denen im heutigen Libanon, Syrien oder Jordanien kulturell ja nicht unterschieden, so zu bezeichnen.) In diesem Zusammenhang hätte man jedoch gerne etwas über den jüdischen Religionsphilosophen und Historiker Hans-Joachim Schöps gelesen, der lebenslang seine Prägung durch die bündische Jugend betonte und immerhin noch im Februar 1933 den Jugendbund Deutscher Vortrupp, Gefolgschaft Deutscher Juden gründete. Als dezidiert antirepublikanischer, der konservativen Revolution zuzurechnender Denker, stand er im Kontakt beispielsweise zu Ernst Niekisch, wie war aber war sein Verhältnis zu den Bündischen?
In Folge des gewählten Zuschnitts geraten auch die christlich konfessionellen Bünde aus dem Fokus, Ahrens weist selbst darauf hin, dass sie von ihm allenfalls als Randphänomen betrachtet würden. Denkt man jedoch an Gruppen wie den katholischen Quickborn, einen keineswegs kleinen Bund mit erheblicher Ausstrahlung in die übrige Jugendbewegung, so wird deutlich, dass in dem gewählten Ansatz eine Verengung liegt.
Grundlage der Auswahl der Bünde, die den Untersuchungsgegenstand bilden, ist eine zeitgenössische Selbstdarstellung von Günther Ehrenthal (Ehrenthal, Günter: Die deutschen Jugendbünde. Ein Handbuch ihrer Organisation und ihrer Bestrebungen, Berlin 1929), selbst Mitglied des Jungnationalen Bundes (JuNaBu). Auf Grundlage der zuvor dargelegten Kommunikationsgemeinschaft ein sinnvoller Zugang, der aber bereits voraussetzt, was gezeigt werden müsste, dass nämlich der dem Selbstverständnis eines Mitgliedes dieses Bundes entsprechende Zuschnitt des Untersuchungsgegenstandes der Fragestellung wirklich adäquat ist. Kann der JuNaBu zu Recht als Kerngruppe der bündischen Jugend angesprochen werden? Hervorgegangen ist er durch Abspaltung 1921 aus dem Deutschnationalen Jugendbund, einem von Generälen und monarchistischen Honoratioren gegründeten antirepublikanischen Jugendorganisation zur Sammlung der kaisertreuen, auf politische Restauration zielenden Jugend. Ahrens stellt deutlich dessen Scharnierfunktion zwischen der Deutschnationalen Volkspartei und dem rechten Flügel der Jugendbewegung dar. (S. 77-82) Auch der JuNaBu stand in der Tradition kaiserlich-deutscher Wehrkraftertüchtigung und unterhielt enge Beziehungen zur DNVP. Er wurde nach seiner Gründung von Admiral Reinhard Scheer, einem ›Weltkriegshelden‹ der Marine geführt, bevor 1922 Heinz Dähnhard Bundesführer wurde. Handelte es sich hier nicht primär um eine politische Kampforganisation gegen die Weimarer Republik? Ahrens stellt das Spezifische des Austrittsbundes prägnant dar: Der DNJ war primär eine politische Sammlungsorganisation, »Der jungnationale Ansatz zielte dagegen auf eine langfristige Ausrichtung, die die Gegenrevolution aus ihren Terminzwängen lösen konnte [d.h. kein kurzfristiges, in der politischen Situation der frühen Zwanzigerjahre aussichtloses politisches Programm formulierte], und machte eine Elitebildung für Deutschland zu seinem Projekt.« (S. 85) Das Jugendbewegte an dieser Position war nicht die auch anderswo zu findende ›völkische‹ politische Ausrichtung, sondern der Anspruch ›Charakterbildung‹ bei den Mitgliedern zu betreiben. »Es ging um nichts Geringeres als um das totale Engagement der ganzen Person. Deutsch-Nationaler war man in der Freizeit, Jungnationaler immer und aufgrund einer Lebensentscheidung.« ( S. 85 in indirekter Wiedergabe eines Zitates von Heinz Dähnhardt) Die Differenz zur eigentlichen Jugendbewegung – auch zu ihrem großen völkischen Flügel – bestand in der veränderten Praxis, wie sie auch Ahrens darstellt: »Die Erziehungsarbeit des Junabus bedeutete die Abkehr vom offenen Vereinsleben, wie es der DNJ praktiziert hatte. Schulungstage für die Führungsschicht und dezentrale Arbeit in den Ortsgruppen waren die Säulen der neuen Praxis… Die Rede über Freizeitaktivitäten bekam dabei einen ernsthaften Klang, als seien Zweckfreiheit und Müßiggang angesichts der gesellschaftlichen Problemlagen nicht mehr tragbar.« (S. 88) Diesen Bund zu einer Zentralorganisation der bündischen Jugend zu machen erscheint problematisch. Sollte man ihn nicht vielmehr als eine Organisation zu betrachten, die ideologisch der konservativen Revolution zuzuordnen ist und sich auch ›moderner‹ dynamischer bündischer Formen in ihrer Verbandspraxis bediente? Ihre Zuordnung zur bündischen Jugend folgt jedoch konsequent aus deren eingangs zitierten Verortung im Lager der völkischen Rechten. Bereits in der Definition dessen, was die bündische Jugend umfasse, war ja (S. 10) von der »Integration dezidiert politisch ausgerichteter Gruppen« die Rede gewesen.
Das erste Kapitel widmet sich der ›Vorgeschichte‹, den Wandervögeln und den Pfadfindern im Kaiserreich. In knapper Darstellung werden die beiden bürgerlichen jugendpädagogischen Ansätze skizziert. Während die Pfadfinder mit der Übernahme eines ausgearbeiteten britischen Konzeptes und seiner Anpassung an die deutschen Verhältnisse sich weniger elitär gebärdeten und dicht z.B. an den bayerischen Wehrkraftverein anlehnten, war das Konzept der Wandervögel deutlich elitärer auf das Bildungsbürgertum zugeschnitten. In ihrem Selbstverständnis bedeutete das Treiben der Wandervögel Ausbruch aus dem engen bürgerlichen Rahmen, wie jedoch ein Blick auf die massive Unterstützung durch Lehrer und Eltern zeigt, bewegte er sich in gesellschaftskonformen Bahnen. Die ungeregelte Fahrt, das Natur- und Gemeinschaftserlebnis wurden von den Erwachsenen durchaus in ihrem pädagogischen Wert anerkannt. Von besonderer Bedeutung neben dem Wandern war die kulturelle Produktion – ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zu den Pfadfindern: Volkslieder und Tänze, traditionelles Kunsthandwerk sollten die Verbindung der städtischen Jugend mit einer besonders auf dem Lande anzutreffenden romantisch imaginierten deutschen Volkskultur ermöglichen. Verbunden war diese Weltsicht mit einem teilweise manifesten Antisemitismus. Angesichts der sozialen Trägerschicht ist dies wenig erstaunlich: Der Alldeutsche Verband, das Zentrum der antisemitischen Bewegung des Kaiserreiches rekrutierte sich ebenfalls zu einem ganz wesentliche Teil aus Lehrern, Pastoren und Professoren, wie sie im WV eine tragende Rolle spielten. In dieser treffenden Beschreibung fehlt jedoch das, was in vielen Lebenserinnerungen und Selbstbeschreibungen eine wichtige Rolle spielt: Der Wandervogel bot einen individuellen zweckfreien Raum jenseits der Anforderungen von Elternhaus und Schule, der das freie Gespräch und damit eine individuelle und kollektive Selbstverständigung der jungen Leute ermöglichte. Dieser Aspekt jugendlicher Selbstorganisation war für die damalige Gesellschaft so ungewöhnlich, dass seine Ausstrahlung jüdische Flüchtlinge aus Galizien, die vor der zarischen Armee nach Wien geflohen waren, nur wenige Jahre später veranlasste, ihre stark scoutistisch geprägte jüdische Pfadfinderorganisation nach diesem Vorbild vollkommen umzugestalten, wie Manes Sperber berichtet.
Den zentralen mentalen Einschnitt bildete, wie in der gesamten deutschen Gesellschaft, auch in der Jugendbewegung die Kriegserfahrung. Ahrens beschreibt in dem folgenden Kapitel ›Formierung‹ die Aktivitäten rechter Wandervögel in den Freicorps der Nachkriegszeit und die zentrale Funktion, die ein entindividualisierter Totenkult um die nicht nur in Langemark gefallenen Angehörigen der Jugendbünde für die ideologische Verarbeitung der Kriegserfahrung und der deutschen Niederlage hatte. Nach der Darstellung der Aktivitäten der Wandervogel-Hundertschaft an der deutsch-polnischen Grenzen in Schlesien und des berüchtigten Freicorps Oberland, in dem viele ehemalige Wandervögel aus Bayern und Österreich Mitglied waren, das aber aus der »radikal antisemitschen Münchner Thule Gesellschaft Rudolf von Sebottendorfs« hervorgegangen war, kommt er zu dem Resümee: »Auf das Ganze gesehen gab es eine einheitliche Freikorpserfahrung der Wandervögel ebenso wenig wie eine einheitliche Erfahrung des Weltkrieges. Allerdings lässt sich festhalten, dass das freiwillige militärische Engagement in der Nachkriegszeit so häufig vorkam, dass es als typisches Element vieler Wandervogelbiographien gelten kann.« (S. 57) Nicht Gegenstand seiner Untersuchung sind die Wandervögel und Freideutschen, die aufgrund des Kriegserlebnisses dezidiert pazifistische Positionen einnahmen. Der Nachkriegsbund der Entschiedenen Jugend, dem nur wenige Zeilen gewidmet sind, (vergl. S. 109) wäre hierfür ein auch quantitativ relevantes Beispiel gewesen. Gar keine Erwähnung finden die, bisher wohl systematisch nicht untersuchten Wandervögel, die ihren Weg in die sozialdemokratische Arbeiterjugend fanden: Figuren wie der ursprüngliche Braunschweiger Wandervogel-Gauführer Hermann Neddermeyer, der Gründer der Braunschweiger sozialdemokratischen Kinderfreunde und Vater des Konzepts der ›Kinderrepubliken‹ oder auch weniger bekannte frühere fahrende Gesellen und Wandervögel wie die Brüder Lorenz und Ernst Främke, später Kinderfreunde und im Widerstand der Sozialistischen Front gegen das NS-Regime engagiert, aus Hannover. (Schweigmann-Greve, Kay: »Jugendbewegte Lebensläufe« am Beispiel der Kinderfreunde in Hannover. Zwischen Fahrenden Gesellen und Sozialistischer Front. In: Historische Jugendforschung. Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung. NF Band 8/2011, Schwalbat/Ts 2012, S. 300-322)
Das von persönlicher Trauer und dem Andenken an konkrete Individuen weitgehend gelöste ›Heldengedenken‹ ermöglichte es nicht nur dem Tod – gemessen an der Gesamtbevölkerung waren mit circa einem Viertel der einberufenen Wandervögel überdurchschnittlich viele gefallen – einen Sinn zu unterlegen, darüber hinaus konnte für die heimgekehrten Feldwandervögel und die jüngere Generation der Kriegsjugend eine gemeinsame Verpflichtung konstruiert werden, das nur unterbrochene ›Völkerringen‹ durch eigene Taten zukünftig zu einem besseren Ende zu bringen, dass ›Deutschends Ehre und Größe‹ wieder herstellen sollte. Ein weiterer zentraler Punkt der Konstituierung der antidemokratischen Rechten in der Jugendbewegung war die begeisterte Rezeption der Schriften Spenglers und Moeller van den Brucks, verbunden mit der Konstruktion von ›Jugend‹ individuell als altersunabhängiger ›Haltung‹ und gemeinsam als politisches Subjekt. »Der Begriff ›Jugend‹ wurde so von einer genetisch biologischen Basis weitgehend gelöst.« (S. 61) Die ›Jungen‹ waren diejenigen, die den ›Alten‹ in Verwaltung, Justiz, Militär und Wirtschaft gegenüberstanden und berufen waren, diese zur Verwirklichung ihrer Mission für Deutschland zu verdrängen und zu ersetzen. Die Selbstverpflichtung der Bündischen auf ständige persönliche Fortentwicklung, auf Charakterschulung und Üben von Verantwortungsübernahme war mit dem Anspruch verbunden, sich auf die Führungsämter in Staat und Gesellschaft vorzubereiten.
Ein weiteres zentrales Element war die Radikalisierung der Volkstumsromantik der Vorkriegswandervögel zu einer ›völkischen‹ Position, wie sie etwa von Frank Glatzel, einer Zentralfigur des Jungdeutschen Bundes sie formulierte: »Ein Volk ist ein Zweig der Menschheitsentwicklung, der nach Abstammung, Kultur und Geschichte besondere Züge trägt und sich nach eigenen Gesetzen entwickelt… die Sonderart [ist] als Gesamtbild rassisch und geistig so bestimmt herausgebildet, daß in der Menschheit die Zweige der Entwicklung sich deutlich abheben.« Gegenbegriff zu völkisch/Volk war der Begriff der Menschheit, wie ihn die internationalistisch gesonnene Linke verwendete. Dies alles war keineswegs deskriptiv gemeint, sondern als Rechtfertigung der eigenen politischen Mission, so fährt er fort: »Diese Gestalt für das deutsche Volk aus seinem inneren Sehnen herausbauen zu helfen, wird unsere Hauptaufgabe sein… Die dieses Wissen und Wollen haben, nennen sich völkisch.« (Glatzl, Frank: Der Jungdeutsche Bund (1920), zitiert nach Ahrens, S. 74) Derselbe Glatzl hatte bereits 1919 in dem von ihm formulierten ›Lauensteiner Bekenntnis‹ des Jungdeutschen Bundes, der Sammelpunkt der völkischen Menschen in der Jugendbewegung sein wollte, die Differenz zur Meißnerformel deutlich gemacht. Hieß es 1913: »Die Freideutsche Jugend will nach eigener Bestimmung, vor eigener Verantwortung, in innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten. Für diese innere Freiheit tritt sie unter allen Umständen geschlossen ein…«, so gelobten die Jungdeutschen 1919: »Wir Jungdeutschen wollen aus der Kraft unseres Volkstums eigenwüchsige Menschen werden, unter Überwindung der äußeren Gegensätze eine wahrhafte Volksgemeinschaft aller Deutschen schaffen und ein Deutsches Reich als Grundlage und Gestalt unseres völkischen Lebens aufbauen helfen.« (S. 73) Damit waren der Individualismus und der Rückbezug auf das eigene Gewissen der Meißnerformel zugunsten einer ganz innerhalb des ›Volkstums‹ agierenden Perspektive aufgegeben. Es sollte nicht mehr eigenverantwortlich eine offene Zukunft gestaltet, sondern das Deutsche Reich auf der Grundlage des völkischen Lebens aufgebaut werden. Ohne sich an eine konkrete politische Partei zu binden, war dies ein politisches Programm: Das Deutsche Reich auf der Grundlage des völkischen Lebens bedeutete, den deutschen Staat mit dem deutschen Volk in Deckungsgleichheit zu bringen, die gerade im Versailler Vertrag akzeptierten Gebietsabtrennungen, die Teile des deutschen Volkes außerhalb des Deutschen Staates ließen, mussten rückgängig gemacht werden. Nach innen galt es die ›Volksgemeinschaft‹ zu schaffen, d.h. gegen die Spaltung der Nation in Klassen und für die Ausscheidung ›volksfremder‹ Elemente einzutreten.
Es folgt eine Darstellung der Bünde, die nach Ahrens zentral für die weitere Entwicklung waren und eine Rekonstruktion ihres weltanschaulichen Selbstverständnisses: Nach DNJ und JuNaBu folgt der Bund der Adler und Falken, eine in völkischer Hinsicht radikalisierte Form des Wandervogels, bei dem, jugendbewegungstypisch, Fahrten, Gemeinschaftsleben und künstlerische Betätigung das Zentrum der Tätigkeiten bildeten. Anders als beim in dieser Frage ambivalenten Vorkriegswandervogel war der Antisemitismus hier ausdrücklich Teil des Programms. Die Entwicklung der Pfadfinder des DPB parallelisiert er mit der im DNJ: Auch hier spalten sich mit den Neupfadfindern und den Ringpfadfindern Gruppen ab, die das Bundesleben intensivieren wollen. Auch die Protagonisten dieser Reformbestrebungen waren Kriegsheimkehrer (in dieser Generation war das wohl die Regel), sie bedienten sich einer mystischen emotionalen Sprache und predigten ein Streben nach Askese, Vervollkommnung und ›Reinheit‹, das Blatt der Neupfadfinder heißt Der Weiße Ritter. Auch hier ging es um ein den ganzen Menschen erfassendes Streben, dass letztlich über das Individuum hinauswies. Das ›Reich‹, für das die ›Ritter‹ leben sollten, war jedoch nicht platt wie beim JuNaBu das deutsche, sondern ein mythologisch umwobenes unkonkretes etwas, das eher die Züge heutiger Fantasy trägt. Dennoch war, so Ahrens, insbesondere bei Martin Völkel, der auch Mitglied der DNVP war, ein Bezug zum ›Deutschtum‹ und ein gewisser Antisemitismus deutlich erkennbar. Dass dies nicht nur bei den Ringpfadfindern Völkels der Fall war, lasse sich aus dem enttäuschten Rückzug Alexander Lions, des Gründers der deutschen Pfadfinderbewegung, aus dem DBP entnehmen. Auch dort muss es Anlass für diesen Schritt gegeben haben, und niemand dort bat den früheren Kolonialoffizier jüdischer Herkunft zu bleiben. Teil des Bildes ist auch die Betonung des ›Führerprinzips‹: Im ›Prunner Gelöbnis‹ der Neupfadfinder von 1919 hieß es ausdrücklich ›Wir wollen unseren Führern, denen wir Vertrauen schenken, Gefolgschaft leisten‹.
Auch die Wandervögel gruppierten sich neu: Der Wandervogel e.V. entstand erneut als Einigungsbund, in dem sich die liberaleren Kräfte zusammenfanden, dynamischer, geschlossener und kleiner war der Alt-Wandervogel, der sich unter Ernst Buske 1920 von seinen weiblichen Teilnehmer trennte, woraufhin sich der Deutschwandervogel abspaltete, der die Geschlechtertrennung ablehnte. »Die Alt-Wandervögel verstanden sich als ›Hauptträger‹ einer ›völkischen Zukunft‹, die vom dezidiert männlichen ›Führertum‹ des Bundes profitieren sollte.« (S. 105) Die neu entstehenden WV-Bünde, wie der Nerother Bund im Rheinland und der Wandervogel-Jungenbund in Sachsen und Baden waren von vorneherein als reine Jungenbünde konzipiert. Von den Fahrenden Gesellen spalteten sich ›Geusen‹ ab, die deren völkische Orientierung beibehielten, aber auch Mädchen aufnahmen und sich über den ›Stand‹ der Handlungsgehilfen hinaus öffneten. Die liberalen Gruppen entwickelten weniger Anziehungskraft, »Das Prinzip des geschlossenen, elitären Bundes setzte sich Anfang der 20er Jahre gegenüber der offeneren Konzeption durch«. (S. 106)
Die heimkehrenden Feldwandervögel organisierten sich im Wesentlichen in drei Älterenbünden, der Entschiedenen Jugend, die bald durch den Wechsel der Aktiven zur KPD aus der Jugendbewegung ausschied, den gemäßigt linken Freideutschen, die daran scheiterten, der Zusammenschluss der Älteren überhaupt zu werden, und dem Kronacher Bund der alten Wandervögel, eine Gründung, die direkt aus dem Feldwandervogel hervorging. Dezidiert nationalistisch-rechte kriegsheimkehrende Wandervögel schlossen sich eher den Adlern und Falken, DNJ und JuNaBu, den Akademischen Gildenschaften (einer der Jugendbewegung nahestehenden Studentenverbindung) oder dem bereits bestehenden WV-Älterenbund Jungdeutscher Bund an. Ahrens rechnet auch die Kronacher der politischen Rechten zu, obwohl sich diese von den der konservativen Revolution nahestehenen Bünden deutlich unterschieden: Auf ihrem ersten Treffen im fränkischen Kronach verarbeiteten sie ihre Kriegserfahrung auf eigene Weise: »Verkleidet und unter verballhornten Kommandos zogen diese ehemaligen Wandervogelsoldaten durch das Städtchen und ironisierten die eigenen Erlebnisse«, ein Beispiel dafür, dass auch innerhalb der Jugendbewegung »das Kriegserlebnis nicht automatisch Revanchegelüste und entsprechende Aktivitäten nach sich ziehen musste.« (S. 110) Auch wenn ein Mitglied, unter Verweis auf die in den Älterenbund nachrückenden nationalistischer gesonnenen Jüngeren bezweifelte, dass ein »internationalisierender Völkerbündler sich nach seiner ganzen Einstellung bei uns wohlfühlen wird, obgleich wir Politik und Religion jedermanns eigene Angelegenheit sein lassen wollen« (S. 110f.), scheint mir die Differenz eher die zwischen bürgerlichem und proletarischem Lebensgefühl zu sein und nicht an der Frage der Demokratie orientiert.
Die Formierungsphase abschließend beschreibt er das ›Fichtelgebirgstreffen‹ 1923 der von ihm als bündische Jugend angesprochenen Bünde, das in Konkurrenz zu dem von den Freideutschen einberufenen Nachfolgetreffen zum Hohen Meißner einberufen wurde. Zentrales Anliegen war die ›Grenzlandarbeit‹ – der Schulterschluss mit den auslandsdeutschen Minderheiten – unter dem schwarzen Balkenkreuz auf weißem Grund, dem Symbol des Deutschen Ordens. »Allerdings äußerten sich die reformorientierten linken Freideutschen ablehnend gegenüber dieser eindeutigen Positionierung und der damit verbundenen Parteinahme für eine ›konservative alldeutsch-antijüdische Gedankenwelt‹« (S. 114) Selbst der Alt-Wandervogel Ernst Buske warnte vor dieser Politisierung. Auch hier wird der enge Zuschnitt des Unterschungsgegenstandes deutlich: Nicht nur die Freideutschen, auch die konfessionellen Bünde, der katholische Quickborn oder der evangelische Bund Deutscher Jugendvereine (BDJ) – von der Arbeiterjugend ganz zu schweigen – waren abwesend, bzw. bei Konkurrenzveranstaltungen engagiert.
Das folgende lange Kapitel, überschrieben Konsolidierung und Opposition: 1923-1928 behandelt neben der Organisationsgeschichte als einer Form der Vereinheitlichung der Szene auch die Lebenspraxis und die spezifischen ideologischen Inhalte. Es wird die Transformation dieser Inhalte, etwa der ›Wehrhaftigkeit‹ in einen verinnerlichten persönlichen Habitus, eine bellizistische Überzeugung, verbunden mit dem Anspruch an körperliche Ertüchtigung und charakterliche Schulung zu Verantwortungsübernahme, Willensstärke, Härte gegen sich und andere usw. dargestellt. Seine Erlebnispraxis fand dieser Topos in den ›Grenzlandfahrten‹ zu den deutschen Minderheiten im europäischen Osten. ›Deutsch sein‹, ein Terminus, der zunehmend den Begriff ›völkisch‹ ersetzte, war kein rationales diskursfähiges Konzept, sondern ein existentialistisches, mystisch aufgeladenes Lebensgefühl, das die Identifikation des Gegners ermöglichte, ohne selbst zu konkreten politischen Vorstellungen zu verpflichten. Anschaulich wird die Hybridisierung und Indienstnahme deutscher Geschichte und ihrer Leitgestalten wie Luther, Ulrich von Hutten, Wallenstein, Friederich Schiller, Fichte, Lützow, Friedrich II und besonders Bismarck beschrieben. In einem Beitrag der Zeitschrift des DNJ, blicken z.B die beiden letzteren in Anwesenheit von Maria Theresia, Minister Stein, General Blücher und Wilhelm I + II angesichts einer Parade von Germanen, Wikingern, preußischen und österreichischen Soldaten aus dem germanischen Walhalla auf das Deutschland des Ruhrkampfes hinab und kommen zu dem kernigen Resumee: »Müssen alle sogleich hinabfahren und unsern Geist den Deutschen einhauchen, ehe das bleiche Händlergeschmeiß und die weltfremden Idioten ihnen wieder den Murr aus den Seelen quasseln und schmieren.« (S. 187) – man fragt sich, warum der doch eigentlich für diese Art Rettung des Vaterlands zuständige Barbarossa in diesem illustren Mummenschanz fehlt!
Erstaunlich ist der Befund, dass antisemitische Äußerungen in den Bünden der Weimarer Zeit nur eine untergeordnete Rolle spielen. Das von Ahrens untersuchte Spektrum umfasst die NS-nahen Geusen aber auch die Deutsche Freischar, deren Gau Schlesien intensive Beziehungen zu dem jüdischen Gelehrten Eugen Roenstock-Huessey unterhielt. Insgesamt scheint es sich beim Antisemitismus jedoch um eine geklärte Frage gehandelt zu haben, der antisemitische Konsens bedurfte weder der Manifestation noch der Diskussion, »er blieb aber gleichsam ein Antisemitismus auf Abruf – eine Judenfeindschaft, die nur explizit gemacht wurde, wenn sich die Notwendigkeit zeigte«. Zustimmend zitiert er Walther Laquer, der von circa 250 Juden – eine Zahl im Promillebereich – gesprochen hatte, die sich in der Bündischen Jugend engagiert habe. Von größerer Bedeutung seien Eugenik und ›Rassenkunde‹ gewesen, eine Ideologie, die mit ihrem pseudowissenschaftlichen Auftreten dem Distinktionsbedürfnis der Bündischen entgegenkam und gut in ihr völkisches Weltbild integrierbar war.
Wichtig ist die Einordnung der nationalistischen Bünde in das Lager der politischen Rechten, an verschiedenen Stellen in der ganzen Arbeit weist Ahrens auf die Doppelmitgliedschaften vieler Protagonisten in verschiedenen Bünden, der DNVP den Gildenschaften und anderen Organisationen des zersplitterten rechten Organisationsgeflechtes hin. Selbst mit dem Stahlhelm, zu dem das Verhältnis durch Konkurrenz geprägt gewesen sei, bestehe die Differenz nicht im Ziel der Revision der deutschen Grenzen und der Errichtung eines autoritären Staates, sondern in Fragen der Methode – auch hier kehrt der elitäre bündische Anspruch wieder, ›Qualität‹ der ›Masse‹ vorzuziehen. (Vergl. Ahrens, S. 230-232) Wichtig ist in der Beschreibung dieses ›Lagers‹ ein Begriff, den bereits Heinz Dähnhardt zur Selbstbeschreibung des ›nationalen Lagers‹ nutzte, dass dort weniger Einigkeit hinsichtlich ausgearbeiteter politischer Konzepte bestand als vielmehr ein Grundkonsens über die politischen Gegner (Liberale, Linke und die Republik) sowie ein diffuser Rekurs auf Volk, Nation und autoritären Staat in der Tradition Preußens und des Kaiserreiches, jedoch ohne konkrete Festlegung seiner zukünftigen Gestalt. In dieses Geflecht aus revanchistischen Vereinen und Verbänden, DNVP und rechten Splitterparteien ordnet er auch die NSDAP ein. Die entscheidende Differenz zu den vielen anderen Gruppen habe aber, zumindest bis 1933, nicht primär im Ideologischen, sondern in der strategischen Grundentscheidung der Nationalsozialisten gelegen, mit großem propagandistischem Aufwand auch die Massen anzusprechen, um so zur Macht zu gelangen. (S. 240)
»Die bündische Jugend lässt sich«, resümiert er am Ende des 3. Kapitels, »insgesamt in das skizzierte Modell [des Lagers der politischen Rechten] einordnen. Sie teilte die Erfahrung der Niederlage und den Schluss, durch aufopferungsvolle Arbeit an sich selbst zur Revision der Verhältnisse beizutragen. Sie sah sich durch die Entwicklung, die sie miterlebt hatte, legitimiert, an die Stelle der bestehenden Gesellschaft und des bestehenden Staates eine antiliberale Alternative zu setzen, die auf ihrer Vorstellung von ›Volk‹ beruhen würde. Im Sinne einer funktionalen Aufgabenteilung empfahl die bündische Jugend sich selbst für die Aufgabe einer langfristig angelegten Elitenerziehung.« (S. 242) Auch wenn diese Positionen in unterschiedlichen Bünden mit unterschiedlicher Intensität vertreten wurde – die gemäßigten Bünde wie etwa die Reichspfadfinder und die Deutsche Freischar öffneten sich durchaus politisch zur Republik – gehöre »der weitaus größte Teil der Bünde … jedoch ohne Vorbehalt in den Zusammenhang der Rechten.« (S. 243)
Etwa mit dem Jahr 1928 gerät die Republik in die Defensive und Teile der konsolidierten bündischen Szene politisieren sich. Im November diesen Jahres veröffentlicht Walther Kayser vom Jungnationalen Bund einen Aufruf an »die gesamte volksbewußte und bündische Jugend Deutschlands« in der er die »deutsche Freiheit« beschwor und noch einmal gegen die »Knechtschaft« der durch den Vertrag von Versailles begründeten Weimarer Staats- und Gesellschaftsordnung absetzte. »Auf engem Raum zusammengepfercht, um den Lebensraum der Freiheit betrogen, an gliederabschnürende Ketten gefesselt, siecht das deutsche Volk wie in einem Kerker dahin.« Abermals wird die Mission der ›Jungen‹ beschworen. Diese müssten ihren »Widerstand« – ein Schlüsselbsgriff des Textes – den bedrückenden äußeren Mächten entgegensetzen und die »innere Verknechtung« durch die Weimarer Republik bekämpfen. Symbol dieser nun aktiv kämpferisch verstandenen Haltung sollte die schwarze Fahne sein. Diese knüpfte an die schwarze Uniform des Freicorps Lützow im Kampf gegen Napoleon und die Tradition der Freicorps nach dem Weltkrieg an. JuNaBu, Adler und Falken, Fahrende Gesellen, Geusen und aber auch der Wehrjugendverband der Schilljugend, der im unmittelbaren Umfeld der NSDAP angesiedelt war, griffen dies auf und führten seither die schwarze Fahne, verbunden mit der eigenen oder ihrem auf der schwarzen Fahne drapierten Symbol (vergl. Ahrens, S. 251-255).
Ein wesentlicher Schritt der Vereinheitlichung der politischen Rechten war der Kampf gegen den Young-Plan, einer Neuregelung der deutschen Reparationsverpflichtungen, der einige Erleichterungen gegenüber den Ausgangsbedingungen brachte. Zentraler Kritikpunkt waren die neuerlich eingestandene deutsche Kriegsschuld sowie die lange Laufzeit – bis 1988 – die als Perpetuierung der alliierten Fesseln für Generationen angegriffen wurde. Hier artikulierten sich die Bündischen 1929 erstmalig zu einem großen Teil durch eigene Veranstaltungen und Beschlüsse zu einem tagespolitischen Kampfthema. Mit einem Aufruf des ›Nationalbolschewisten‹ Ernst Niekisch, der in der bündischen Zeitung Die Kommenden publiziert wurde, solidarisierten sich neben einer Vielzahl der bekannten rechten Bünde auch die Hitlerjugend und die NS-Schüler- und Studentenverbände. Hier lehnte man ausdrücklich nicht nur den Young-Plan, sondern ebenfalls den Vertrag von Locarno und den Eintritt Deutschlands in den Völkerbund ab (vergl. Ahrens, S. 255-259).
Bereits im März 1930 fanden öffentliche Kundgebungen statt, so vom Widerstandsblock Hamburg, dem auch bündische Verbände angehörten. Dort marschierten die Versammelten nicht nur unter der Schwarzen Fahne gegen den (bereits ratifizierten) Young-Plan, sondern führten eine ›Schriftenverbrennung‹ durch: »Hiermit übergebe ich den Versailler Vertrag, den Locarnopakt, den Dawes Vertrag und den Youngplan den Flammen. Und noch ein Heft folgt: Die Weimarer Verfassung als Werkzeug dieser Versklavungspolitik.« (S.259) Zwar hatten die Veranstaltungen dieser Art keine unmittelbaren Konsequenzen, sie waren jedoch ein öffentlicher Schulterschluss der beteiligten Bündischen mit der NSDAP.
Eine Sonderentwicklung stellten die dj.1.11, die Deutsche Jungenschaft vom 1. November 1929 und ihr Führer Eberhard Koebel-tusk dar. Sein Bemühen war es, die Jungenschaft als Gliederung der Jüngeren in den Bünden aufzuwerten und diese über die bestehenden Bünde hinweg zu einen. Dies war mit einem äußerst elitären Anspruch an seine Gefolgsleute, die ›Selbstringende‹ sein sollten, straffem Führungsanspruch und einem distinkten Stil in der Publikationsgrafik (Grafiken mit klarem Wiedererkennungseffekt, Kleinschreibung), im äußeren Auftreten (Jungenschaftsjacken, Kothen, Jurten) und einem eigenen Liedgut verbunden. Tusk und sein Bund im Bund wurden 1930 aus der Deutschen Freischar ausgeschlossen, kamen 1931 für einige Monate im DPB unter und blieben dann eigenständig. Ihr Versuch Gruppen aus anderen Bünden herauszubrechen war wenig erfolgreich. Schuld daran war sicher auch seine irrlichternde politische Entwicklung: »Hatte er sich in frühen Jahren als Hitler-Anhänger geriert und 1928 ein Lager verlassen, weil die schwarz-rot-goldene Fahne anstatt der schwarz-weiß-roten gehisst worden war, schwenkte er 1931 nach links. Mit Sinn für Provokation trat er am 20. April 1932, zu Hitlers Geburtstag, in die KPD ein. Ein Jahr darauf stellte er sich der nationalsozialistischen Reichsjugendführung zur Verfügung, die seine Dienste ablehnte – genauso wie später die FDJ, deren Führung er sich nach Jahren des Exils andiente.« (S. 282f.) Auch seine Rückkehr in die DDR und seine orthodox-marxistischen Publikationen konnten bis zu seinem Lebensende 1955 in Ostberlin hieran nichts ändern. »In der bündischen Zeit, also bis 1933, war Köbel eine Randerscheinung, eine energiegeladene Figur mit deutlichem Hang zur Selbstüberschätzung… [Er wurde dort] nur gelegentlich wahrgenommen, und zwar als ambitionierter und unbequemer Solitär mit eigenwilligen Vorstellungen, die für den je eigenen Bund nicht infrage kamen. …die größte Wirkung entfaltete er nicht als Jugendführer, sondern als Anreger, dessen Schriften und stilprägenden Errungenschaften zeitversetzt rezipiert wurden. Vor allen in den 50er und60er Jahren orientierten sich einflussreiche Gruppen [in Westdeutschland] maßgeblich an Köbels Ideen.« (S. 283)
Ahrens referiert die vielen ideologischen Übereinstimmungen (Bedeutung von Volk und Nation, antidemokratisches autoritäres Staatsverständnis, persönliches ›Führerprinzip‹ usw.) macht jedoch als deutlichen Unterscheidungspunkt den Antisemitismus aus: Während dieser für die NS-Ideologie ein unverzichtbarer zentraler Faktor war, spielte er für die Bündischen offensichtlich eine weit geringere Rolle. (S. 297) Bei aller inhaltlichen Nähe war es durchaus eine offene Frage für die Bünde, wie man sich der NSDAP gegenüber verhalten sollte. Dezidiert rechte Bünde, wie die Geusen, die Adler und Falken, die Freischar Schill und die Atamanen, die sich weitgehend uneingeschränkt zum Nationalsozialismus bekannten, versuchten bereits im August 1929 als bündische Vorfeldorganisationen der NSDAP anerkannt zu werden, was die HJ, die dies als Angriff auf ihren Alleinvertretungsanspruch ansah, zu verhindern wusste. (S. 310) Allein das Jungvolk/Bund der Tatjugend Großdeutschlands, das aus dem österreichischen WV hervorgegangen war und zu dieser Zeit etwa 700 Mitglieder hatte, war bereit 1931, jede Eigenständigkeit aufzugeben und konnte so offizieller Teil des NS-Organisationsgeflechts werden. (S. 311f.) Aus den anderen Bünden gingen jedoch Einzelpersonen, die ihre Karrierechancen in der wachsenden Organisation erkannten, oder ganze Gliederungen zur HJ über. Die Führer der verbliebenen Bünde besaßen zwar selbst oft bereits das Parteibuch der NSDAP hielten jedoch an ihrem Eliteanspruch – nun unter nationalsozialistischem Vorzeichen – fest und beanspruchten gegenüber der immer selbstbewusster auftretenden HJ – die als einzige NS-Gliederung den Bünden offen feindselig gegenüberstand – ihre organisatorische Eigenständigkeit. Die Fahrenden Gesellen reagierten 1931 sogar trotz ihrer inhaltlichen Nähe und vieler Parteimitglieder mit einem Unvereinbarkeitsbeschluss. Sie »kritisierten die demagogischen Methoden, die breite Zielgruppe und das undisziplinierte Auftreten der Nationalsozialisten.« (S. 324) Während in den dezidiert rechten Bünden seit 1930 die Frage des Verhältnisses zur NSDAP einen breiten Raum einnahm, schienen die Deutsche Freischar und die Reichspfadfinder – obwohl sich auch diese nach Ahrens Auffassung nach rechts bewegt hatten – den Nationalsozialismus zunächst zu ignorieren und ihre nach innen gerichtete Arbeit fortzusetzen. Erst nach den Märzwahlen 1933 bemühte sich die Freischar aktiv um eine Integration in den neuen Staat und den ideologischen Schulterschluss um ihre eigenständigen Strukturen zu retten. So erstaunt es nicht, dass für viele Bündische das Jahr 1933 trotz Verbot ihrer Bünde, das Ahrens plastisch nachzeichnet, und deren ganz überwiegende Selbstauflösung oder Überführung in HJ und Jungvolk eine deutlich geringere Zäsur bedeutete als der Kriegsbeginn 1939 oder das Jahr 1945. Ahrens erwähnt auch den bündischen Widerstand (S. 363-365), der nur von einer kleinen Anzahl früherer Bündischer getragen war, aber von der Jugendfront von Hans Ebeling und Theo Hespers im Holländischen Exil über Mitglieder im Kreisauer Kreis bis zum militärischen Widerstand nicht selten mit dem Leben bezahlt wurde.
Auch die sich selbst als ›bündisch‹ verstehenden Gruppen unangepasster, oft proletarischer Jugendlicher in Nazideutschland, am bekanntesten sind die Edelweißpiraten, finden Erwähnung. Ihre Aktivität steht jedoch nur in geringem Maße in persönlicher Kontinuität zu den 1933 aufgelösten Bünden und hat auch in ihrer Praxis mit dem am Ende oft quasimilitärisch strukturierten Auftreten der alten Bünde wenig gemein. Dennoch übernahm auch die Staatsgewalt mit der strafrechtlichen Verfolgung ›bündischer Umtriebe‹ die dort vorgenommene Umdeutung des Begriffes.
Ahrens verfolgt die Nachwirkung der Bünde auf verschiedenen Ebenen, darunter die modifizierte Übernahme von Elementen bündischer Jugendkultur in die Jugendarbeit der Nationalsozialisten. Hierbei interpretiert er die Versuche der Fortführung bündischen Lebens im Rahmen des NS als faktische aktive Selbstintegration. Für viele Bündische dürfte das zügige Ende der Bünde im Nationalsozialismus ernüchternd gewesen sein: Als nun das ersehnte Ende der Weimarer Republik endlich eingetreten war, zeigte sich der neue nationale Staat keineswegs interessiert an der selbsternannten Elite, die sich berufen fühlte, nun in die frei werdenden gesellschaftlichen Führungspositionen einzurücken. Im Gegenteil: Vom neuen Machtzentrum für marginal gehalten und ignoriert, bekamen sie zumindest ansatzweise den Repressionsapparat selbst zu spüren und hatten sich ob ihrer Sektiererei zu rechtfertigen. Dennoch wurde der Machtantritt der Nazis ganz überwiegend begrüßt, auf der persönlichen Ebene zog das bündische Engagement für die meisten Funktionäre der nun auch verbotenen rechten Bünde keine negativen Konsequenzen nach sich, die Zustimmung zur allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung überwog. Auch der Krieg, den man ja seit 1918 als für die Revision der Ergebnisse des Vorangegangenen für unvermeidlich hielt, wurde von vielen Bündischen als Erfüllung ihres Strebens begrüßt. Walter Kayser, der Initiator der Verwendung der schwarzen Fahne aus dem JuNaBu meldete sich von seinem »ruhigen Posten als Wehrmachtsbeamter freiwillig an die Front, was mit einer deutlichen Zurückstufung zum Leutnant einherging. Er verlor an der Ostfront sein Leben.« (S. 362 f.) Derartiger ›bellizistischer Idealismus‹ war kein Einzelfall. In der Selbstinterpretation parallelisierten die Bündischen derartige Lebensläufe mit dem Ernst Wurches aus der berühmten Novelle von Walter Flex, sowie mit dessen eigenem ›Heldentod‹ im Ersten Weltkrieg.
Der Neuanfang 1945 war für die rechten Bündischen nicht einfach, in beiden deutschen Staaten realisierten sich die gesellschaftlichen Vorstellungen der vormaligen Gegner. Persönlich profitierten sie genauso wie alle übrigen Täter und Mitläufer der NS-Regierung von der zügigen Restauration in Westdeutschland, sie waren teils in der freien Wirtschaft, teilweise im Staat, an den Hochschulen und in der Justiz durchaus erfolgreich. Eine Untersuchung des Schicksals vergleichbarer Personen in der DDR fehlt und wird auch von Ahrens, da neben seinem Thema gelegen, nicht geleistet. Alle unter diesem Gesichtspunkt betrachteten Personen lebten nach 1945 in Westdeutschland. Ob dies möglicherweise Folge einer Binnenmigration in die westlichen Sektoren war, bleibt offen.
Abschließend wirft er noch einen kurzen Blick auf die in der frühen Bundesrepublik neu entstehende jugendbewegte Szene. Eine Wiedergründung der meisten der untersuchten Organisationen wäre sicher am Einspruch der Alliierten gescheitert. Aufgrund ihrer absoluten Diskreditierung auch in bürgerlichen Kreisen scheint es auch in den Fünfziger Jahren keine relevanten Versuche gegeben zu haben. Kurz wird bis in die jüngste Vergangenheit das Fortleben extrem rechter Strömungen beschrieben, die in der Wikingjugend und im Bund Heimattreuer Jugend versuchen, das bündische Erbe für ihre Bestrebungen zu nutzen und die entschiedene Abgrenzung des jugendbewegten Mainstreams hiergegen. Auch der jugendbewegte Aspekt der Lippoldsberger Dichtertage, die von dem völkischen Dichter und Fahrenden Gesellen Hans Grimm ausgerichtet wurden, wird erwähnt. Ausnahmen in der organisatorischen Diskontinuität bildeten die Nerother Wandervögel, die Fahrenden Gesellen und die Gildenschaften. Erstere hatten mit Robert Ölbermann einen ihrer Führer im KZ verloren und galten den NS-Behörden bei der Verfolgung der ›bündischen Umtriebe‹ als neben der dj.1.11 ›gefährlichster‹, weil ausgesprochen unangepasster Bund. Offensichtlich bestand hier aus der Perspektive nach 1945 genug Distanz zum NS-Regime, um unter dem alten Namen und unter Führung des Zwillingsbruders Karl das Bundesleben wieder aufzunehmen. Eberhard Köbel-tusk ging von London nach Ostberlin und versuchte von dort erfolglos Einfluss auf die bald äußerst dynamische Jungenschaftsszene in Westdeutschland zu nehmen. Für seine Option für den Kommunismus hatten die neuen Jungenschaftler kein Verständnis. Dort orientierte man sich an Personen wie etwa Walther Scherf (tejo), die zwar an die Nordlandsehnsucht und die Russlandbegeisterung tusks anknüpften, aber weder dessen Führerattitüde, noch dessen linke wie rechte politische Ambitionen teilten. Die Bedeutung der nun tatsächlich stark selbstbestimmten, jugendpflege- und organisationsfernen Jungenschaftsszene für die Entwicklung demokratischen Bewusstseins hat u.a. Arno Klönne eindrücklich beschrieben. Die Pfadfinderszene wurde ebenfalls von Neugründungen dominiert, deren große Bünde im Unterschied zu den Zwanziger Jahren aktiv im Weltpfadfinderbund mitarbeiten. »Trotz merklicher Distanzierung zu maßgeblichen Inhalten und Formen ihrer bündischen Vorgänger waren in den ersten anderthalb Jahrzehnten nach 1945 bei beiden Strömungen Traditionsbezüge stark ausgeprägt, was in männerbündischen Formen, autoritärer Führung und elitärer Absetzung von der ›Masse‹ zum Ausdruck kam. Erst im Laufe der 60er Jahre lockerte sich, eingebettet in eine breitere gesellschaftliche Entwicklung, der selbstverständliche Vorrang solcher Elemente.« (S. 367) Bereits in den Fünfziger Jahren öffnete sich das bündische Singen, das noch immer einen sehr hohen Stellenwert in den Aktivitäten einnahm, ausländischem, fremdsprachigem Liedgut und die nach Skandinavien, ganz Westeuropa, Jugoslawien und sogar Nordafrika unternommenen Großfahren erweiterten den Horizont der Teilnehmer weit über den der bleiernen Adenauergesellschaft hinaus. Kennzeichnend für die veränderte Arbeit war »der Abbau autoritärer Strukturen, die intensive Reflexion pädagogischer Vorgänge und die Hinwendung zu gesellschaftlichen Fragen.« Erstaunlich ist, dass Ahrens hier nicht auf das Meißnertreffen 1963 Bezug nimmt: Bereits in der »Grundsatzerklärung der jungen Bünde«, die im Vorfeld des Meißnertreffens verabschiedet wurde hieß es: »Da unser Bemühen um Selbstverwirklichung nur in einem freien Staat gelingen kann, verpflichten wir uns, die uns anvertraute Jugend von der Idee des demokratischen Rechtsstaates zu überzeugen«. In der Rede des alten bündischen Helmut Gollwitzer positionierte sich die Jugendbewegung gesellschaftskritisch und offen. Der hier eingeschlagene Weg hatte jedoch bereits bei der Teilnahme Bündischer an der Bewegung gegen die Wiederbewaffnung und Anti-Atomtod-Bewegung begonnen und führte einen erheblichen Teil von ihnen in die Studentenbewegung der folgenden Jahre. Ahrens resümiert: »Wo schließlich von Erziehung zu ›Demokratie, Toleranz und einer offenen Gesellschaft‹ als einem Kernelement des ›Bündischen‹ die Rede ist, zeigt sich, dass die heutige Szene in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Um den Begriff ›bündisch‹ hierher zu retten, kann aber offenbar nicht auf eine kollektive Umdeutung der historischen Akteure in ›demokratische Vor- und Mitdenker ihrer Zeit‹ verzichtet werden, die einer näheren Überprüfung nicht standhält.« (S. 369f.) Ob das einer seit mindestens fünfzig Jahren demokratischen Werten verbundenen bündischen Jugend gerecht wird, ist nicht Thema des Buches, bereits Gollwitzer hatte sich 1963 ausdrücklich zur antidemokratischen Geschichte vieler Bündischer bekannt und festgestellt, dass eine Jugendbewegung – auch eine, die sich als ›Elite‹ stilisierte – nicht klüger sei, als die übrige Gesellschaft. Jugendliche teilen, das war bei der Arbeiterjugend nicht anders, die Werte und politischen Überzeugungen ihrer gesellschaftlichen Herkunftsschicht. Die vorgelegte Studie wirft so gesehen ein grelles Schlaglicht auf die Verwurzelung des Bildungs- und Kleinbürgertums der Weimarer Republik in antidemokratischem Gedankengut. Man staunt nach der Lektüre des Buches wie wenig historisch berechtigt der Bezug der heutigen Schwarzzeltvölker auf die Mehrheit der Bündischen Jugend der Weimarer Republik ist und wie ein Kernbegriff jugendbewegter Identität in einem Jahrhundert die Inhalte, für die er stand, nicht nur verändert, sondern geradezu in sein Gegenteil verkehrt hat. Zu wünschen wäre eine ebenso gründliche Arbeit über die bündische Jugend der Zeit nach 1945 bis in die Sechziger Jahre, die den Voraussetzungen und dem Wandel der politischen und pädagogischen Vorstellungen der Protagonisten nachgeht.
Ahrens schreibt eine gut lesbare und überzeugend argumentierende Geschichte der bündischen Rechten. Dabei droht aus dem Blick zu geraten, dass die bürgerliche Jugendbewegung, ja selbst die bündische Szene größer und breiter war, als die von Ahrens dargestellte Rechte. Für diese ist die Darstellung jedoch äußerst erhellend, insbesondere auch die dargestellten Beziehungen zu anderen Teilen des rechten Lagers. Das diffizile Verhältnis zur nationalsozialistischen Bewegung über anderthalb Jahrzehnte, ausgehend von aus dem Kaiserreich mitgebrachten weltanschaulichen Gemeinsamkeiten, der Erschütterung durch den Ersten Weltkrieg und der zunehmenden Radikalisierung in den Jahren ab 1928 veranschaulicht der Entwicklungsprozess dieser Gruppe über die schlichte Frage der Wegbereitung für Hitler durch die Bündischen hinaus.
(Bild: © Wallstein Verlag)