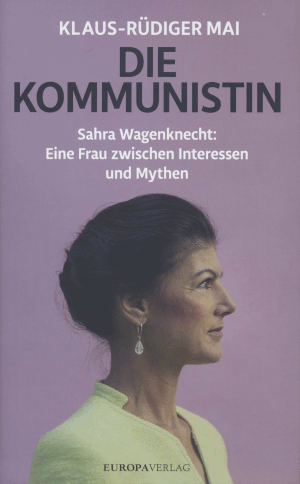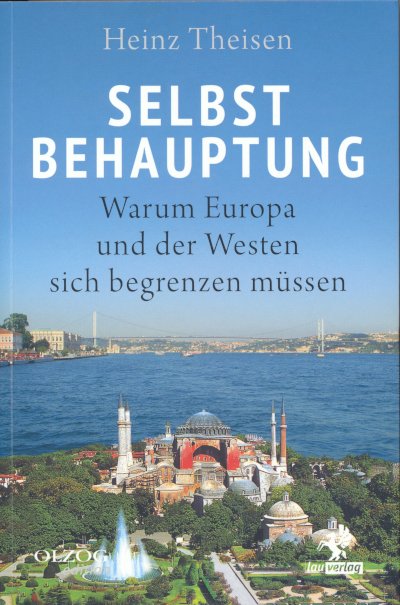von Ulrich Schödlbauer
Wieviel Vergnügen bietet eine Skulptur? An einem Ausstellungsort mag die Frage befremdlich klingen, mit einem leisen Beigeschmack des Ungehörigen, andererseits lautet sie doch grundsätzlich genug, um einmal gestellt zu werden. Gelegenheit macht Diebe und ich gestehe, es bereitet mir ein diebisches Vergnügen, sie nicht ungenützt verstreichen zu lassen, nachdem die Frage nun einmal unverpackt, wenn Sie so wollen, im Raum steht. Warum unverpackt, wird sich der eine oder andere fragen, und warum gerade hier, in diesem Raum? Ist das ein Spiel mit Worten? Und wenn... ist es nicht nur ein Spiel mit Worten? Vielleicht. Aber aus solchen Spielen entsteht die Welt, wir sollten sie daher nicht achtlos beiseite tun.
Vielleicht ist es meine Frage. Jedenfalls stellt sie sich mir, seit ich zum ersten Mal Gelegenheit bekam, Michael Schulzes plastische Arbeiten aus der Nähe zu betrachten, in diesem eigenartigen Raum, in dem sie ›wirklich‹ existieren oder zu existieren scheinen und der sich deutlich gegen die Ausstellungsräume abhebt, in denen man ihnen begegnet. Darauf möchte ich noch zurückkommen. In jedem Umgang mit Kunst, die uns berührt, findet sich ein Umkehrpunkt, von dem an das, was einen von Anfang an beschäftigt, sich aber noch nicht wirklich erschlossen hat, auf einen zurückzukommen scheint wie eine alte Bekanntschaft: in meinem Fall trägt dieser Punkt ein Datum. Seit ich zum ersten Mal der Gruppe mit dem Titel Verfolgt von Max E. im Rollstuhl, die hier als Blickfang und Anker im Zentrum steht, ansichtig wurde, bin ich ziemlich sicher, dass nicht ich es bin, der jene Frage stellt, sondern dass sie von diesen Objekten ausgeht – exakt gesprochen, dass diese Objekte als Frage an den Zuschauer formulieren, was sich der Betrachter gut und gern selbst fragen könnte, wenn er sich gegenüber nur aufrichtig genug sein wollte. An dieser Aufrichtigkeit scheint es oft zu mangeln. Jedenfalls hat, wer gern und oft in Ausstellungen geht, über kurz oder lang den Eindruck, dass das Vergnügen an plastischen Gegenständen an solchen Orten selten erhöht in Erscheinung tritt, stattdessen in der Regel eher als ersatzästhetische Größe aushelfen muss, um einer gewissen Beliebigkeit der Wahrnehmung die Schärfe zu nehmen.
Kunstwerke, so will es die Regel, geben Antworten, die verstanden werden wollen. Wenn sie Fragen stellen, so sind diese meist rhetorischer Art, das heißt, sie beantworten sich praktisch von selbst. Ein solcher Fall wäre unser Titel – die Frage, wer denn Max E. sei, steht zwar im Raum, aber sie ist keine Frage für jemanden, der Bescheid weiß. Dieses Bescheidwissen greift gewissermaßen auf die Skulpturenreihe über und man beginnt zu sehen. Worin besteht dieses Sehen? Mehr oder weniger mechanisch stellen sich Reminiszenzen an die Formensprache Max Ernsts ein und über kurz oder lang schält sich aus dem Nebel der Erinnerung die berühmte Capricorne-Gruppe, die selbst zu den ewigen Rätselgebern der Kunst gehört. Plötzlich betrachtet man das Werk ›mit anderen Augen‹, eine Aufmerksamkeit anderer Art ist angesprungen, als werde man unverhofft Zeuge eines halböffentlichen Um- oder Durchzugs, fast wie ein Fußgänger, den eine auf Rot gesprungene Ampel am Weitergehen hindert und der jetzt, neugierig und verwundert, aber auch, da in seinem Vorwärtsdrang gestoppt, unruhig und ein bisschen blasiert, den kleinen Demonstrationszug mustert, der da an ihm vorbeizieht.

Schulzes Objekte, so kommt es mir vor, sind solche unvermutet den Bewegungsraum kreuzenden Demonstrationen. Als solche stellen sie Fragen an ihre Betrachter, die sich keineswegs von selbst beantworten und letztlich in der einen zusammenfließen: Besitzt, was wir veranstalten, genügend Reiz für dich, um dich zu irgendeiner Form des Mitmachens zu bewegen? Ist die Kunst wirklich stark genug, um deine Welt zu verändern? An dieser Frage, ins Vage hinein gestellt, hängt viel, deshalb sei sie etwas genauer betrachtet. Deine Welt, meine Welt – das sagt sich leicht und provoziert, sobald man es ausspricht, die bereits leicht empörte Frage, in welcher Welt man überhaupt lebe, so als führe die Berichtigung meiner Weltvorstellung unmittelbar in die Welt hinüber, die wir gemeinsam bewohnen und deren Veränderung jeden Einzelnen in die Pflicht nimmt. Die Kunst wäre also ein Agens der wirklichen Welt, die vernehmbar an unsere Türen klopft, während wir noch in privatistischen Vorstellungen von Glück und Erfüllung, vielleicht auch vom Gegenteil befangen sind. Rasch wird das Vergnügen an der Betrachtung einer Skulptur dadurch zu einem Beitrag, den wir als Einzelne der Menschheit schulden. Doch leider liegen die Dinge nicht so einfach. Das abgenötigte Vergnügen bleibt schal und muss es bleiben, soll der Einzelne nicht Schaden nehmen.
Schulzes plastisch-kinetische Demonstrationen kreuzen unvermutet und en passant. Über die Mittel, mit denen er das erreicht, wird gleich zu sprechen sein. Lassen Sie uns einen Moment bei dem angeschnittenen Gedanken verweilen, weil er im Zusammenhang dieser Kunst bedeutsam erscheint. Bekanntlich war es Walter Benjamin, der die Figur des Passanten in die Kunstwelt einführte und angesichts des Warenuniversums der kapitalistischen Moderne als ›Flaneur‹ definierte. Das ist lange her und niemand dürfte in Schulzes Skulpturen eine weitere Demonstration der Warenästhetik vermuten. Der Passant, der sich hier auf wundersame Weise ausgebremst sieht, weiß Bescheid, er ist gewohnt, die richtigen Fragen zu stellen, es geht ihm wie einem Yoga-Adepten, der, um den Kreislauf stabil zu halten, bereit ist, sein tägliches ›Om‹ abzusondern, ohne sich mehr dabei zu denken als der Betrachter eines Gemäldes, dessen Blick den winzigen Widerstand des Bilderrahmens überwindet. Schulze selbst hat diesem Typus des Ausstellungsbewohners eine kleine Falle gestellt: »Das Schweigen von Marcel Duchamp wird überbewertet« liest man auf einer Folge von Radierungen mit dem Titel These, Antithese, Synthese, und: »Das Reden von Joseph Beuys wird überbewertet«. Reden und Schweigen, Grundattitüden einer im zwanzigsten Jahrhundert georteten Kunst der Anmaßung, werden auf diesen Blättern nicht etwa ›in Frage gestellt‹ – was nur einem weiteren Akt des Redens bzw. Schweigens gleichkäme –, sondern in einem dritten Schritt an den Betrachter zurückerstattet: »Das Verständnis von Markus Möglich wird überfordert«. Das leuchtet ein: die anonymisierten Möglichmacher der neuen, von Fetischen und Hierarchien gereinigten Welt werden fixiert, man könnte auch sagen: gebannt durch die mittels autoritärer Gesten erzwungene Überbewertung einer Kunst, die als Schweigen/Reden nach ihnen greift und sie so vergessen macht, dass sie es sind, die in diesem Raum das Sagen haben.
Jeder Kunstbeflissene glaubt zu wissen, wer mit Max E. ›gemeint‹ ist. Angenommen, dieses Wissen sei korrekt, so bliebe noch immer die Frage: Warum im Rollstuhl? Und, natürlich, die zweite: Warum als Verfolger? Das ist der Mechanismus: Die Kunst stellt Fragen und der Betrachter schweigt. Einmal wahrgenommen, kehrt sich das Verhältnis um: Der Betrachter redet und die Kunst schweigt. So kennt man es, daran sind beide Seiten gewöhnt. Angenommen allerdings, ›Max E.‹ wäre nicht der, für den man ihn hielte, sondern, analog zu Markus Möglich, ein X, sagen wir: ein zum Eigennamen hochgetriebener Ernst, so würde die verfolgende Instanz schon ein wenig greifbarer. Denn wirklich ergreift die Ahnung einer namenlosen Zumutung jeden, der sich ›im Ernst‹ den genannten Fragen widmet. Der vom Ernst der Kunst verfolgte Betrachter wiederum tut gut daran, seinen Verfolger genauer ins Auge zu fassen und die Behinderung nicht zu übersehen, die über den Ernst in sie eindringt und ihre Bewegungsart bestimmt – das heißt aber: den tendenziellen Unernst der vom Verfolger ausgehenden Bedrohung. Die dem Kunstwerk innewohnende Drohung, es besser zu wissen, erklärt sich, genau genommen, aus der Behinderung, die dadurch entsteht, dass der Künstler genötigt erscheint, in einem plastischen, das heißt nicht-diskursiven Material zu arbeiten, einem Material, das nicht durch die Dichotomie Reden/Schweigen bestimmt wird, sondern durch das Innen-Außen-Verhältnis, also dadurch, dass es als raumschaffende Oberfläche auf den Betrachter wirkt.
Man kann sich, angeregt durch die genannten Parolen, fragen, worin denn, sieht man einmal von der Behauptung als solcher ab, das überbewertete Schweigen Duchamps und das überbewertete Reden von Beuys übereinkommen mögen. Die historische Linie, die beide verbindet, ist die Eroberung des Kunstraums, repräsentiert vom musealen Raum, durch das ›Objekt‹: im Zweifel durch das Alltagsobjekt, das Urinal, die Badewanne, die Straßenbahnschiene etc., aber eben nur im Zweifel, denn natürlich haben beide Künstler, wie ihre Konkurrenten und Nachfolger, nicht gezögert, daneben höchst ambitioniert anmutende Kunst-Objekte zu schaffen. Beiläufig könnte man fragen, ob Gegenstände des intimen Gebrauchs wirklich als Alltagsobjekte hinreichend bestimmt sind oder ob sich hier nicht bereits wieder das Tabu einmischt, dem ihre Zurschaustellung eins auswischen soll.
Das Gemeinsame, um das es hier geht, besteht in der durch den Ausstellungsmodus gestifteten unmittelbaren Beziehung zwischen dem Objekt und dem Ausstellungsraum: in der Deklaration des Kunstobjekts durch den Ausstellungsakt als solchen und die ihn begleitenden Akte von der Anschaffung als Kauf und Aufnahme in den registrierten Bestand einer Sammlung bis hin zur Herausgabe von Dokumentationen und bestandspflegerischen Maßnahmen, etwa im restaurativen Bereich. Das Schweigen/Reden der Kunst auf der Linie Duchamp – Beuys verdankt sich, genau betrachtet, dieser Beziehung. Der Überlegung, ob es sich um Kunst handle, ein für allemal enthoben, entzündet sich an ihr der akademisch gesteuerte Dauerdisput um die Frage, was diese Art von Kunst historisch zwingend erscheinen lässt und was sie uns daher zu sagen habe. Kein Zweifel, das Wir, dem der Appell gilt, ist das Produkt einer veritablen Zwangsvergemeinschaftung. Wer sich entzieht, der zählt nicht, er schließt sich durch seine Ignoranz aus dem umbauten musealen Raum aus und darf sich glücklich schätzen, im Museumscafé und den angeschlossenen sanitären Anlagen einen reellen Gegenwert für sein Eintrittsgeld zu erhalten.
Dieser autoritäre Gestus der ästhetischen Moderne ist oft vermerkt worden und hat diverse Aufstände provoziert. In meinen Augen – und damit nähere ich mich erneut den plastisch-kinetischen Experimenten Schulzes – liegt darin ein Denkfehler. Denn die Kunst, soll heißen das im geformten Objekt aufscheinende Gestaltungspotential, geht in den autoritativen, auf Vermarktung ausgerichteten Gesten des Ausstellungsbetriebs und des Kunsthandels weitgehend unter. Jedenfalls sind ihre Chancen, eine Autorität sui generis zu entfalten, verschwindend gering. Auf sie trifft das früh formulierte, weitgehend folgenlos gebliebene Apercu zu: Der erste, der ein Readymade ins Museum schaffte, war ein Genie, der zweite ein Lakai, der dritte ein Idiot. Ein Künstler, der angesichts einer von vielen als idiotisch empfundenen Praxis – einer hoch entwickelte sozialen Kunst, die vielleicht das Überleben der Kunst überhaupt sichert – von der Wiedergewinnung künstlerischer Autorität träumte, weil er davon überzeugt ist, dass gerade diese Form der Autorität sich aus der Sache rechtfertigt, ein solcher Künstler müsste es sich daher zunächst angelegen sein lassen, die unmittelbare Beziehung zwischen Objekt und Ausstellungsraum aufzubrechen, also keine Museumskunst zu schaffen, sondern etwas, das sich dem Anspruch der kahlen Wände und des bedeutungstiftenden Oberlichts ein Stück weit entzieht, ohne deshalb – das wäre der andere Graben – die Straße und ihre schillernde Gegenwart mit wohlfeilen Botschaften beglücken zu wollen.
Aufrisshaft lässt sich an vielen Zeichnungen und Radierungen Schulzes die Verbindung von organischem und technischem Material studieren, die seinen Plastiken ihre spezifische, an die unbestreitbaren Erfolge der Prothesenchirurgie gemahnende Überlebendigkeit verleiht. Was dem Fortkommen hilft, ist willkommen. Was die mechanischen Anteile angeht, so handelt es sich, in Materialbegriffen gesprochen, um ›Gerümpel‹, soll heißen, um Abfall einer überholten Industrieproduktion, an dem bereits Erinnerungen an die Frühzeit der Collagen und Assemblagen einer heute ›klassisch‹ genannten Moderne hängen, falls er nicht direkt aus dem Industriemuseum entwendet scheint. Manche dieser hässlich-melancholischen, einen absurden Reiz ausstrahlenden Elemente besitzen einen Schalter, der sie in Bewegung setzt. Das ist insofern nicht ohne Belang, als es demonstriert, dass es alles in allem mit dem Fortkommen nicht so weit her ist. Die Bewegung bleibt stationär.
Bewegung, κίνησις, ist seit den griechischen Anfängen das A und O der plastischen Kunst Europas. Als künstlerisch gilt eine Plastik dann und nur dann, wenn sie Körper in Bewegung zeigt. Deshalb zählen scheinbar bewegungsferne Themen wie Schlaf, Schlummer, selbst Tod seit jeher zu den großen Herausforderungen der Kunst. Mimik, Gestik, Körperhaltung lassen eine Art von innerer Bewegtheit ahnen, die gut mit dem christlichen Seelenglauben harmoniert. Die Kunst des christlichen Kulturraums ist eine beseelte Kunst oder eine Kunst der Beseelung. Deshalb treffen die fröhlich in sich kreisenden und hüpfenden Installationen eines Jean Tinguely den Hauptnerv einer überreichen Tradition. Sie parodieren die Seele als den großen Beweger der Kunst ebenso wie den homme machine, den mechanischen Menschen der Aufklärung, der sich in seinen Schöpfungen aus Holz, Eisen und Elektrizität wiedererkennt.
Gegenüber einer solchen Kunst der Maschine beschränken sich die kinetischen Anteile an Schulzes Skulpuren auf partielle Helferfunktionen. Sie greifen dort ein, wo der Organismus stockt, ohne die Stockung beseitigen zu können. In gewisser Weise helfen sie, die Stockung sichtbar zu machen. Man könnte auch sagen: sie greifen dort ein, wo die produktive Wahrnehmung des Betrachters auszusetzen droht. Um eine solche Aussage zu verstehen, ist es sinnvoll, in der Geschichte der Kunstbegriffe ein paar Jahrhunderte zurückzugehen, genau gesagt bis zu Lessing, der im Laokoon als vom Künstler zu fixierenden Moment einer Handlung den ›fruchtbaren Augenblick‹ bestimmt, in dem die drei zeitlichen Dimensionen des Geschehens, also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sich an Position, Gespanntheit, Mimik usw. der dargestellten Körper unmittelbar ablesen lassen – vorausgesetzt immer, man kennt die Geschichte, die da ›erzählt‹ wird, oder man kann sie sich zumindest vorstellen. Das bedeutet: der steinerne oder bronzene Klotz, das bewegungslos den musealen Raum bevölkernde Monument setzt sich in Bewegung, sobald der Blick des Betrachters darauf fällt – nicht etwa auf die opto-mechanische Weise, mit deren Hilfe unsere moderne Technik dieses Problem lösen würde, sondern vor dem inneren Auge des Betrachters, das die Bewegtheit der eigenen Psyche und ihre assoziativ herangetragenen Momente, also etwa Erinnerungen an analog Erlebtes, auf das Objekt projiziert.
Soweit das theoretische Herkommen. Meine Wahrnehmung sagt mir, dass es sich bei einer Skulptur wie Verfolgt von Max E. im Rollstuhl gerade umgekehrt verhält. Es kommt mir so vor, als gerate der Auf- oder Durchmarsch ins Stocken, sobald mein Blick ihn fixiert. Nehme ich den Befund ernst, so bieten sich zwei Strategien an: ich kann die Gelegenheit des erzwungenen Stillstands benützen, um den Zug in allen seinen Einzelheiten eingehend zu betrachten – zu ›studieren‹, wie man gern sagt, wenn man geneigt ist, einem verständlichen Neugier-Impuls nachzugeben –, ich kann aber auch versuchen, aus dem Augenwinkel, also aus einer dezentralen Blickposition heraus, einen Blick auf den seiner Aufmerksamkeit ledigen Zug zu erhaschen – in der verrückten, doch nicht gänzlich grundlosen Hoffnung, er möge sich unter der Hand wieder in Bewegung setzen.
Analysiere ich meinen subjektiven Eindruck, so finde ich den Grund dafür in der mechanischen Instrumentierung des Faktors ›Bewegung‹, die das Wort ›Rollstuhl‹ prägnant zum Ausdruck bringt. Es ist die Maschine, die den Organismus über die ihm durch seine Schwächen auferlegten Grenzen hinaustransportiert – ob mit oder gegen seinen Willen, kommt dabei ebenso wenig in Betracht wie die Frage, wieviel an menschlicher Substanz in diesem Organismus ›zum Tragen kommt‹, wie die etwas unheimlich anmutende Vokabel lautet. Das als mechanische Spielfigur ausgeführte, rüstig die Bettstatt als das moderne Kampffeld durchschreitende androgyne Ich unterscheidet sich darin nicht sehr von den Geschöpfen der Tiefsee oder der Schlachthöfe, denen die technische Evolution auf den Bildern nebenan auf die Sprünge hilft.
Die Naturgeschichte des Menschen ist die Geschichte der vom Menschen erzwungenen zweiten Evolution der Natur. Dieses factum brutum des heutigen Weltbewusstseins drängt wie jedes andere vor und neben ihm zur Gestaltung. Wie die Fortschrittsgeschichten sind auch die Verlustgeschichten weitgehend geschrieben. Eine dieser Geschichten, die vom Verlust der vorsichtshalber ›traditionell‹ genannten Kunst angesichts leerer, von einer illusionsfreien Menschheit ›kreativ‹ zu füllender Räume (die, wie Theoretiker der dunklen Materie zu wissen glauben, so leer nicht sind) handelt, ist gerade dabei, sich zu verflüchtigen. Das muss einen, dem das Vergnügen an plastischen Gegenständen den Weg in die Ausstellung weist, nicht kümmern. Was er sieht, ist geeignet, das alte, nie ganz ausgeräumte Vorurteil zu widerlegen, man müsse sich der Kunst gleichsam auf Fußspitzen nähern, um über den Zaun der eigenen Unzuständigkeit hinweg einen Blick auf etwas zu erhaschen, das, nüchtern und von unten betrachtet, sich nicht sehr unterscheidet von dem, was einen alle Tage umgibt. Vergessen wir nicht: auch die Moderne entstand aus einem Überdruss, nicht anders als die Postmodernen und Post-art-Bewegungen, die auch schon wieder Vergangenheit sind. Der Kunst-Raum, in dem sich die Exponate dieser Ausstellung bewegen, ist nicht identisch mit den aseptischen oder forciert arbeitsweltlich möblierten Ausstellungsräumen der Moderne. Es ist, damit schließt sich der Kreis, einer, den das Kunstwerk sich selbst erschafft – im Kopf des Betrachters, wo denn sonst. Bleibt nur der Wunsch, dass Michael Schulzes plastische Erkundungen im Bereich der variablen Schnitte zwischen erster und zweiter Evolution, zwischen Werden und Entwurf, zwischen Entwurf und erdgeschichtlicher Wirklichkeit dauerhaft dort ankommen, wo sie hingehören – in den Köpfen.
Michael Schulze: Verfolgt von Max E. im Rollstuhl. Austellung vom 7. bis 27. 4. 2014, Galerie Phoenix, Köln, Wachsfabrik.