von Ulrich Schödlbauer
Wer täglich erfährt, wie sich die spielerische Erprobung der Differenz an den sogenannten ›Realitäten‹ bricht, der bildet leicht einen Respekt vor der Wirklichkeit aus, in dem die Kluft zwischen den Möglichkeiten des Einzelnen, sich zu unterscheiden, und den Unterschieden, die ohne ihn gemacht werden, deren Wirksamkeit er aber am eigenen Leib erfährt, unüberbrückbar geworden ist. Die anonyme Kommunikationsgesellschaft, die dem Bedürfnis nach einer bunteren Welt entgegenkommt, verschärft diese Disposition, weil sie Distanz gleichermaßen aufhebt wie schafft. Die mediale Präsentation von Fernverhältnissen, als seien es Nahverhältnisse, erzeugt jenen Orientierungsraum, in dem alle erdenklichen Optionen zwar gegenwärtig (und insofern real), aber nicht reell sind. Medienkonsumenten geht es da nicht anders als den Lesern historischer Romane, die sich als immaterielle Begleiter im Nahfeld eines Personals einnisten, welches ›in Wahrheit‹ längst verstorben und mitsamt der Konstellation, die sie hervorgebracht hat, im Abgrund der Zeit verschwunden ist.
*
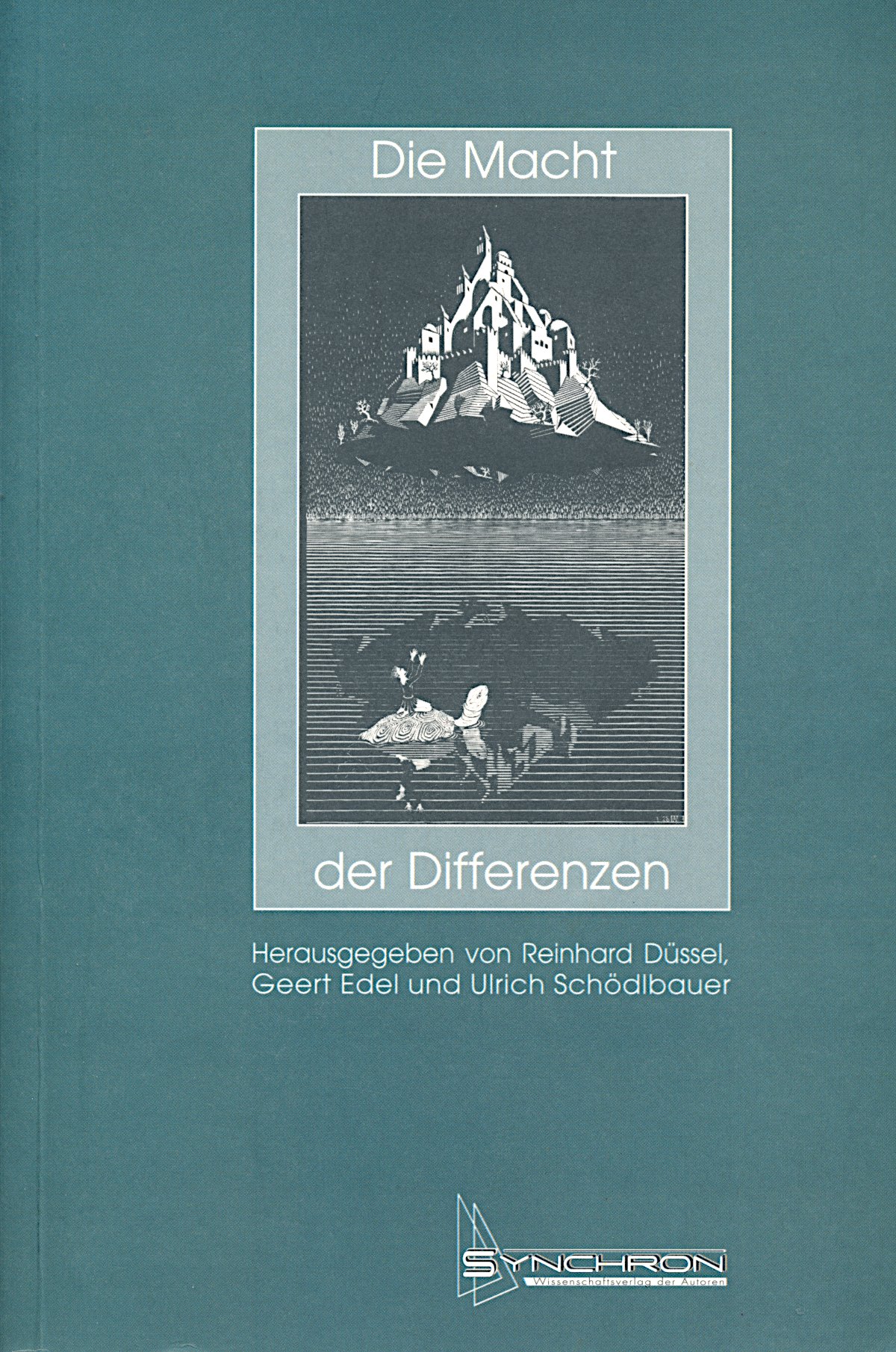
In der Konfusion von Nah- und Fernverhältnissen liegt bereits ein wesentlicher Aspekt der Kultur. Wenn man beispielsweise Ausdrücke wie ›Gruppe‹, ›Gruppenidentität‹, ›Gruppenritual‹ verwendet, um begreiflich zu machen, worum es im Kern geht, sobald von Kultur die Rede ist, aber vermeiden möchte, bestimmte privilegierte Träger wie Stämme, Nationen, Religionsgemeinschaften etc. vor anderen auszuzeichnen, dann zeigt man sich geneigt, Distanzverhältnisse in einer Weise als Nahverhältnisse zu interpretieren, die den Rezeptionsgewohnheiten fernsehender Zeitgenossen verdächtig nahe kommt. Man reproduziert den kulturellen Schematismus, während man ihn zu objektivieren unternimmt. Kultur stellt den Individuen ein teils imaginäres, teils reales Spielfeld zur Verfügung, auf dem sie Differenzen, die sie realiter erleiden, als gewordene und damit als produzierte wahrnehmen und dem eigenen Aktionsraum einverleiben können. Das schließt die Vergegenwärtigung des Gewordenen ebenso ein wie seine fortwährende Überschreitung. Eine Kultur ›lebt‹ oder sie ist ›tot‹. Was nichts anderes besagt, als dass sie in ihren jeweiligen ›Trägern‹ existiert oder überhaupt nicht. Kulturelle Zeugnisse besitzen Hinweischarakter, aber sie sind nicht die Sache selbst. Wer seine Aufmerksamkeit vollständig auf sie konzentriert, der haust sich in einer Abwesenheit ein, die sogar Verlustgefühle hervorzurufen imstande ist, auch wenn bei nüchterner Überlegung der Gedanke überwiegt, dass man etwas, das man als Person nie besessen hat, doch auch schlechterdings nicht verloren haben könne.
*
Die Unumgänglichkeit von Kultur ruft Bilder des Niedergangs, des drohenden Verlustes und der allgegenwärtigen Pervertierung hervor, die das Selbstbewusstsein der Sprecher keineswegs zu beeinträchtigen, sondern eher zu stärken scheinen. In ihnen figuriert Kultur zu gleichen Teilen als Aufgabe der Lebenden, als Übermächtigkeit des Vergangenen und als relative Ohnmacht gegenüber den Anderen, sprich: als Entlastung vom eigenen kulturellen Anspruch. Kultur trägt einen Vergangenheitsindex. Sie ist zwar nicht der primäre, wohl aber ein unumgänglicher Orientierungsrahmen, innerhalb dessen das Individuum sich als zeitliches Wesen verortet. Die ›Konfusion‹ von Nah- und Fernverhältnissen ist Ausdruck und Weise dieser Verortungsleistung. In ihr herrscht das Gesetz der Analogie ebenso wie das Persönlich-Nehmen von Verhältnissen, die nicht nur dem eigenen Einfluss entzogen sind, sondern möglicherweise nur als Konstrukte, als theoretische oder praktische Hirngespinste die eigenen Vorstellungen und Handlungen regieren. Kultur ist die je eigene Welt, verstanden als Ensemble von Kräften und Mächten, mit denen das Individuum kraft eigenen Wahrnehmens, Empfindens und Handelns in einem kontinuierlichen Austausch steht. Dieser Gedanke der Kontinuität ist wichtig. Ihr Abreißen wird als Desorientierung, als Verirrung, Verarmung, Versagen, nicht selten auch als Schuld oder Katastrophe wahrgenommen.
*
Formal gesprochen heißt das: Kultur konstituiert sich als aktives Wechselspiel von Innen- und Außendifferenzierung. Wobei als Grenze zwischen beiden sowohl die Grenze zwischen dem die Differenzen ›realisierenden‹ Individuum und den es umgebenden ›Mächten‹ als auch die zwischen der Gesamtheit der Konstituentien einer Kultur und den ihren Angehörigen ›fremd‹ bzw. ›befremdlich‹ anmutenden Zügen einer ansonsten un- oder unterbestimmt bleibenden Außen- resp. Mitwelt zu betrachten ist. Eine der ersten Erfahrungen von Kultur im Leben des Einzelnen ist das notwendige Auskundschaften dessen, was geht und was nicht geht, ohne dass die dafür angegebenen Gründe jemals zureichende Gestalt annähmen – falls sie überhaupt gegeben werden. Es wäre aber verfehlt, Kultur und Kulturen deshalb auf Regelbewusstsein oder auf Regelsysteme zu reduzieren. So hat die Diskussion über die kulturellen Folgen der Globalisierung drastisch deutlich gemacht, dass selbst Regelverletzungen größeren Ausmaßes – etwa im Bereich der ›Liberalität‹ bestimmter Kulturen – billigend in Kauf genommen werden, sobald die Überzeugung, im jeweils Eigenen bedroht zu sein, an Boden gewinnt. Es ist nicht nötig, dass sich eine kulturelle Gesamtheit erregt; anders etwa als Nationen sind Kulturen nicht als Subjekte konnotiert. Dem Begriff der Kultur ist die anthropologische Sehweise inhärent: die traditionell erste Bestimmung gilt dem Kulturwesen Mensch, das sich von seinen Mitgeschöpfen – oder Konkurrenten um die mehr oder weniger sparsam verteilten Ressourcen – auf spezifische Weise unterscheidet. Wer in der Anthropologie nur ein Täuschungsmanöver weißer Kolonialherren und ihrer Handlanger zu sehen vermag, der gerät spätestens dann in Erklärungsnot, wenn er für den Anderen einen eigenkulturellen Status postuliert, für den er Punkt für Punkt das anthropologische Argument in Anspruch nehmen muss, falls er es nicht vorzieht, in der Theorie zu schwänzen.
*
Die Macht der Differenzen ist ebenso real wie geborgt. Sie verdankt sich jener zweiten Wirklichkeit aus Anschauungen, Überzeugungen, rituell und emotional abgesicherten Denkgewohnheiten und mehr oder weniger fixen Ideen, die sich über die erste legt und diese in gewisser Weise erst im Gedanken an ein Substrat, das allen Unterscheidungen vorausgeht und sie legitimiert, hervorbringt. Das gilt auch dort, wo die quasi-natürliche Differenz, sprich Andersartigkeit ›indigener Kulturen‹, als ›natürliche Ressource‹ für eine kommende, möglicherweise mit mehr Verständnis bewaffnete Weltkultur ins Blickfeld rückt. Gerade an diesem Gedanken zeigt sich, dass kulturelle Übermacht eine spezifische Gedankenlosigkeit mit sich führt, deren Entlastungsfunktion für den Einzelnen außer Frage steht, die aber in der Sache einem Differenzierungsverbot nahekommt. Dort nichts zu sehen, wo andere Kulturen ihren Mittelpunkt finden, ist offenbar weniger eine ethnozentrische Perfidie als ein Stabilitätsfaktor erster Ordnung, der die Wirklichkeit einer Kultur von den in ihr virulenten guten Absichten sondert.
*
Der Gedanke, dass die relative Gleichrangigkeit der Kulturen im Hinblick auf Weltauslegung und Weltgestaltung nur ein – eventuell schöner – Traum ist, schärft die Frage ›Was heißt kulturelle Differenz?‹ nicht unerheblich an. Autochthone Kulturen, die bei der Berührung mit der historisch von Europa und dem nördlichen Amerika ausgegangenen Weltkultur wie Schnee an der Sonne zu schmelzen begannen, scheinen in diesem Spiel mit Differenzen keine eigene Stimme zu besitzen. Darin sind sie eher atypisch für eine Situation, in der zwischen den Wortführern jener zum Menschheitsschicksal stilisierten Weltkultur und den Vertretern regionaler Kulturen die Machtfrage offen gestellt wird. Darauf, dass dieser Auseinandersetzung ein möglicherweise fataler Denkfehler zu Grunde liegt, weist mit Nachdruck der in diesem Band vertretene Wissenschaftshistoriker Varadaraja V. Raman hin. Wer, so Raman, die wissenschaftlich-technische Weltkultur als ›westlich‹ attackiert, verkennt, dass sie mit den älteren kulturellen Traditionen des Westens in einem ähnlichen Widerstreit liegt wie mit denen Asiens oder Afrikas. Die moderne Wissenschaftskultur gehört, so Raman, prinzipiell in dieselbe Klasse von Menschheitserrungenschaften wie die Schrift, das Schießpulver oder die Null, die ebenfalls nur ihrer Herkunft nach mit bestimmten Kulturen in Verbindung gebracht werden können.
Aus: Reinhard Düssel / Geert Edel / Ulrich Schödlbauer: Die Macht der Differenzen. Beiträge zur Hermeneutik der Kultur, Heidelberg (Synchron) 2001, 423 Seiten. Einleitung, Teil 1 (leicht verändert).

