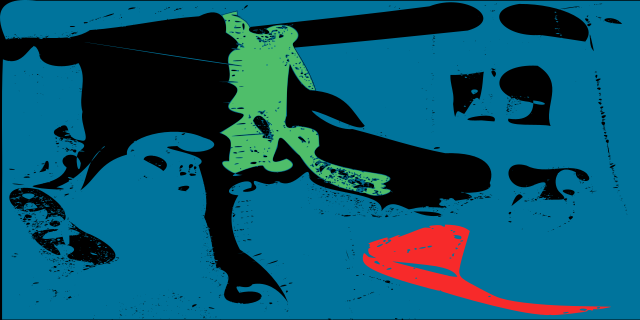von Gerd Held
Die Überdehnungskrise des größten deutschen Autobauers kann nur mit einer eindeutig defensiveren Grundaufstellung überwunden werden.
(Die Zerstörung der unternehmerischen Vernunft, Teil III)
Die Aufgabe, vor der das Unternehmen Volkswagen steht – und vor der im Grund auch die deutsche Wirtschaft steht – ist anders und schwieriger als die Aufgabe, die sich in einer Strukturwandels-Krise stellt. Bei so einer Krise weiß man, dass nach schmerzhaften Eingriffen ein sicheres neues Ufer schon da ist. Doch im Fall der Autoindustrie gibt es kein sicheres Ufer namens »Elektro-Automobilität«. Und auch das Ufer »Globalisierung« bietet heute nicht mehr einen konkurrenzlosen Vorsprung und hohe Erträge für die etablierten Automobilhersteller. Die Grundaufstellung, die bisher diese beiden Positionen setzte, erweist sich nun als nicht mehr haltbar. So steht eine schwierige Entscheidung an: Es muss ein strategischer Rückzug angetreten werden.
Allzu sorglose Grundentscheidungen müssen ausdrücklich als Fehlentscheidungen revidiert werden. Ein Teil der Investitionen – in Technologien und in Auslandsstandorte – muss abgeschrieben werden. Das ist auch moralisch schwierig, da der bisherige Kurs ja als kühne Vorwärtsbewegung verstanden und legitimiert wurde. Da erscheint ein Rückzug erstmal als Niederlage und schmähliche Schwäche. Deshalb ist die Neigung groß, einen solchen Rückzug weit von sich zu weisen. Oder ihn immer wieder hinauszuzögern. Und doch gibt es auch die Erfahrung, dass die Unfähigkeit zu einem rechtzeitigen Rückzug zu unvergleichlich größeren Opfern führt. Zu größeren materiellen Opfern und zu größeren moralischen Opfern wegen der Entscheidungsschwäche. So ist es oft doch von Vorteil, wenn man rechtzeitig eine defensivere Aufstellung gewählt hat. um wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen.
Der Mut zum Rückzug
Wenn eine Überdehnungskrise vorliegt, ist der Vorwurf an die Führung eines Unternehmens, sie habe »den Wandel verschlafen«, fehl am Platze. Er übt Druck in die falsche Richtung aus. Er treibt die Dinge nur weiter in die falsche Richtung und führt dazu, dass weitere Anstrengungen und Investitionen auf einem Kurs versenkt werden, der zu keinem tragfähigen Neuland führt. Man zeichnet das falsche Bild einer Automobilindustrie, die sich in einer »Übergangsituation« befinde, die es nur zu »überbrücken« gelte, damit dann wieder goldene Zeiten anbrechen. Aber die »Brücke«, für die jetzt eine letzte siegbringende »Anstrengung« gefordert wird, führt ins Leere. Und irgendwann werden diejenigen, die jetzt gegen die »Schwarzmalerei« zu Felde ziehen, dem Publikum verkünden müssen, dass der große Transformations-Feldzug doch verloren ist. Ja, manches in Deutschland erinnert, wie der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe richtig schreibt, an die letzten Jahre der DDR. Und manches sollte vielleicht sogar an das jähe Ende von 1918 erinnern, dem bekanntlich auch eine große, angeblich »siegbringende« Offensive vorausging. Die deutsche Geschichte bietet gute Gründe, frühzeitiger als in der Vergangenheit auf Krisenzeichen zu reagieren, die einen eingeschlagenen Kurs fragwürdig machen.
Aber es geht natürlich nicht um einen absoluten »totalen« Rückzug – etwa in dem Sinn, sich von positiven Erträgen und großer Industrie zu verabschieden, wie es jetzt die Vertreter eines »negativen Wachstums« predigen. Es geht darum, das richtige Maß des Rückzugs zu finden. Wenn man aus einer Sackgasse herauskommen will, muss man zurückfahren. Und man muss den Punkt finden, wo man gewissermaßen falsch abgebogen ist. Mit Mut allein ist es nicht getan, sondern es ist auch die unternehmerische Vernunft gefragt. Eine defensivere, konservativere Aufstellung findet man nicht, wenn man hinter die industrielle Moderne zurückfährt. Auch nicht, wenn man sich »Industrie« mit den Bildern des 19. Jahrhunderts vorstellt. Die Automobilindustrie kann anknüpfen an die unternehmerische Vernunft, wie sie in den ersten 30 Jahren der Bundesrepublik erfolgreich war. Und wie sie ihre Erfolge auf vielen Gebieten noch bis in die 2000er Jahre verlängert hat.
Allerdings gab es damals auch schon Tendenzen, in denen sich die heutige Misere andeutete und die als Vorgeschichte der Überdehnung angesehen werden können. Man denke an das »Upgrading« der Modelle. Der »Golf« wurde schon zu Verbrenner-Zeiten immer aufwendiger konzipiert und ausgestattet. Er wurde auch immer teurer. Schon in den 90er Jahren wurde er mehr und mehr Fahrzeug der gehobenen Mittelklasse. Jener Klasse, die in dieser Zeit als »Neue Mitte« durch Politik und Medien geisterte. Es ging um die Bildungsaufsteiger, mit Abitur und Hochschulabschlüssen. Die Facharbeiter als »Ecklohngruppen« in der Industrie waren damit nicht gemeint.
Eine andere Aufstellung müsste die Verteidigung des Massenverkehrsmittels »Automobil« zu ihrem strategischen Hauptziel machen. Die Herstellung dieses Massenverkehrsmittels hat VW groß gemacht. Solange dies Ziel galt, war VW in der Lage, seine Investitionen aus eigenen Mitteln zu investieren, wie der Vorstandvorsitzende Blume richtigerweise als unternehmerischen Grundsatz festhält. Wenn man Fahrzeuge bauen will, die für eine breite Mehrheit erschwinglich sind, muss man also wieder zurückkehren zur erprobten, hochentwickelten und massentauglichen Technologie der Verbrenner-Antriebe. Das müsste eindeutig als das Standbein festgelegt sein, was andere Antriebe und Fahrzeugtypen – als Spielbein – nicht ausschließt.
Und auch die »Chinastrategie«, die davon ausging, dass VW durch die globale Verlagerung von Produktions-Standorten in starke Wachstums-Länder eine neue Existenz als Weltkonzern aufbauen kann, war bei Eintritt in die 2000er Jahre schon in Ansätzen da. Die neueren Verschiebungen auf dem Weltmarkt zeigen nun, dass für einen so großen Außenbeitrag zum Unternehmensertrag die Zeiten vorbei sind. VW hat in starken Wachstumsländern wie China keinen großen Vorsprung mehr. Das muss dazu führen, das Verhältnis von Binnenmarkt und Weltmarkt defensiver zu bestimmen: Die Binnenstandorte in Deutschland und Europa müssen das Standbein sein.
Die Rekonstruktionsaufgabe
Das bedeutet, dass man sich eine Wende der Lage nicht einfach als großen »Ruck« vorstellen sollte, sondern als einen längeren Prozess der Rückverschiebung. Es geht um die Rehabilitierung einfacherer, erschwinglicherer Fahrzeuge. Und um die Rehabilitierung der Fertigung in Deutschland. Notwendig ist dabei nicht ein vollständiger Abschied von E-Mobilität und Auslandsfertigung, sondern ein Wechsel zwischen Standbein und Spielbein. Es geht also um eine Rückverschiebung des Unternehmens zu den Standbeinen, die über viele Jahrzehnte immer wieder fähig waren, sich an Veränderungen maßvoll anzupassen. Nur durch eine Rückverschiebung auf das Standbein des herkömmlichen Fahrzeugbaus mit Verbrennungsmotor und auf das Standbein der Inlands-Fertigung kann man das Maß der Änderungen finden, die für eine »Bodenbildung« in der aktuellen VW-Krise notwendig sind.
Und es geht noch um eine dritte Rückverschiebung: Die Überdehnung von VW war mit einer Verschiebung der sozialen Verhältnisse und Beziehungen im Unternehmen verbunden: eine neue »gehobene Mitte«, die weder den Unternehmerstandpunkt noch den Belegschaftsstandpunkt einnahm, wuchs überproportional und schob sich in eine Schlüsselposition. Hingegen wurde der Aufstieg von VW etliche Jahrzehnte mit hohem Leistungsstandard und gelungener Weiterentwicklung des Fahrzeug-Angebots in der Dualität von Unternehmer-Seite und Belegschafts-Seite vollbracht. Die Grundlage für diese Erfolgsgeschichte war die Tatsache, dass beide Seiten – trotz ihrer Gegensätzlichkeit – eine starke Bindung zum Unternehmen hatten. Das Milieu der »neuen Mitte« hat diese Bindung nicht, und ist so eine ständige Quelle von Überdehnungen der Unternehmensaufstellung. Hier muss eine Rückverschiebung auf den Dualismus zwischen Unternehmerseite und Belegschaftsseite stattfinden.
*
Diese drei Rückverschiebungen sind die Grundlage für die Lösung der Rekonstruktionsaufgabe, die sich angesichts Misere der deutschen Wirtschaft stellt. »Rekonstruktion« ist ein Aufbau, der an älteren Entwicklungswegen und Errungenschaften anknüpft, die im Laufe der vergangenen Jahrzehnte abgebrochen wurden. Dabei geht es wohl um eine moderne Dynamik, aber um eine kontinuierliche Dynamik. »Rekonstruktion« ist keine Nostalgie für mythische »alten Zustände«. Aber sie wendet sich auch gegen einen anderen Mythos: den Mythos, wir wären in ein ganz neues Zeitalter eingetreten. Der Mythos, dass wir alle Brücken hinter uns verbrennen könnten. Das ist die Vorstellung, die mit dem Wortvorsatz »post« (»nach«) transportiert wird: »postindustriell«, »postkolonial«. »postmodern«… Es ist viel zutreffender, wenn wir die Vorstellung einer großen, vor einigen Jahrhunderten gerade erst angebrochenen »Neuzeit« oder »Moderne« beibehalten. Die Misere unserer Gegenwart könnte und sollte dann als eine vorübergehende Verirrung in einigen Ländern und Weltregionen verstanden werden. Es ist dann auch keine Verirrung auf Grund irgendeiner »Rückständigkeit«, sondern eine Verirrung, die in fortgeschrittenen Ländern stattfindet, die aufgrund ihrer Erfolge in einer täuschenden Machbarkeit der Welt und Leichtigkeit des Daseins besteht. Eine Machbarkeit und Leichtigkeit, die weder der Industrie noch der Moderne insgesamt zu eigen ist. Die Krise ist keine Krise der Moderne, sondern eine Krise des Versuchs, die Moderne durch eine »große Transformation« zu überwinden und einfach mal eben eine ganze neue Ära aus der Taufe zu heben. Welch naiver Glaube hier am Werk ist, zeigt sich darin, dass nun schon nach relativ kurzer Zeit die Rechnungen der »ganz neuen Ära« nicht aufgehen.
*
Die Rekonstruktionsaufgabe können wir nur verstehen, wenn wir uns im Denken und Handeln von der Vorstellung immer neuer »Zeitenwenden« verabschieden. Und wenn wir stattdessen die Stetigkeit des (komplexeren und langsameren) Fortschreitens der klassischen Moderne wieder aufnehmen und weiterführen. In diesem Sinn geht es um eine Rehabilitierung der unternehmerischen Vernunft.
Das Bild, das den Unternehmer als eine moderne Heldenfigur zeichnet, führt leicht in die Irre. Seine Bewährung besteht nicht nur in besonders kühnen Projekten und bahnbrechenden Erfindungen. Es gibt auch kein höheres Gesetz, das jedes Unternehmen zur Orientierung auf »Hightech« zwingt. Ebenso wenig bestehen die »modernen Zeiten« in einem monotonen »Vorwärts, Vorwärts!«. Eher geht es um Tempowechsel. Längere Perioden des langsamen Fortschreitens in kleinen Schritten gehören auch dazu, sogar Perioden der Stagnation. Technologische Sprünge, die ganze neue Basis-Technologien hervorbringen, sind eher die Ausnahme als die Regel. Solche Sprünge können auch nicht durch »Forschungspolitik« künstlich erzeugt werden. Die gegenständliche Welt gibt Entdeckungen und Entwicklungen nicht dann frei, wenn die Menschen es wollen. Deshalb besteht die unternehmerische Vernunft darin, dass sie diese objektive Sperrigkeit der Welt akzeptiert. Daraus folgt die Aufgabe, den Stand der technischen Entwicklung ständig sorgfältig und ergebnisoffen zu prüfen.
In dieser Hinsicht ist die Diagnose, die der österreichische Ökonom Joseph A. Schumpeter zur Krise von 1929 gestellt hat, interessant. Schumpeter, dessen Beitrag eigentlich vor allem mit der »produktiven Zerstörung« in Verbindung gebracht wird, sah die Krise von 1929 als Resultat einer »Überschätzung«: Es sprach von »übertriebenen Gewinnerwartungen« während der zweiten industriellen Revolution in den 1920er Jahren. Diese Gewinnerwartungen hätten die allgemeine Risikobereitschaft so gesteigert, dass viele Investments auf großen Schulden basierten. Schumpeter weist also auf die Bedeutung einer realistischen Einschätzung von technologischen Entwicklungen hin.
Doch eine solche realistische Einschätzung liegt für die Antriebstechnologie im Fahrzeugbau nicht vor – nicht von VW oder anderen Automobilunternehmen, nicht von Deutschland, Europa oder anderen Weltregionen. Es gibt nicht einmal eine fundierte Debatte zwischen unterschiedlichen Einschätzungen. Sie wird ersetzt durch Begriffe wie »Zuversicht«, die das Fehlen einer belastbaren Einschätzung überspielen. Es ist daher falsch, auf einer so schwachen Grundlage für die E-Mobilität pauschal das Zertifikat »Zukunftsinvestitionen« auszustellen, und in ihrem Namen die gesamte herkömmliche Technologie zum alten Eisen zu werfen.
Der VW-Sanierungsplan verfehlt die Rekonstruktionsaufgabe
In dem bereits zitierten FAZ-Interview mit dem VW-Chef Oliver Blume fragen die Journalisten nach den Veränderungen, die Blume vom Wirtschaftsstandort Deutschland erwartet:
»Zunächst einmal müssen wir unsere eigenen Hausaufgaben machen. Gleichzeitig muss das Wirtschaftsmodell Deutschland adjustiert werden. Unsere Industrie hat lange davon gelebt, dass wir hier hervorragende Produkte entwickeln und produzieren, um sie in die ganze Welt zu liefern. Jetzt sehen wir geopolitische Verschiebungen und Protektionismus. Und technische Regulierungen, die sich global stark auseinanderentwickeln.«
Das berührt sehr wohl die kritischen Punkte, aber es bleibt merkwürdig vage. Es herrscht eine merkwürdige Zweiteilung: auf der einen Seite »die Hausaufgaben« (die Blume erledigen will) und auf der anderen Seite eine »Adjustierung« des deutschen Wirtschaftsmodells (die nicht präzisiert wird). Hat der Chef des größten deutschen Autobauers nicht ein gewichtiges und vor allem konkretes Wort zu den notwendigen Veränderungen dieses Wirtschaftsmodells zu sagen? Kann er seine Aufgaben bei VW überhaupt erfüllen, solange sie ganz wesentlich von einem Wirtschaftsmodell vorgegeben werden, das gar keinen Raum für die unternehmerische Vernunft lässt? Und kurz darauf gleitet er in eine platte »Aufbruchs«-Rhetorik ab, auf die er als Unternehmer gerade nicht ausweichen darf:
»Deutschland braucht einen Aufbruch – weg vom Standstreifen zurück auf die Überholspur. Wichtig sind zum Beispiel: geringere Abgaben, Abbau bürokratischer Hürden, bezahlbare Energie, Sicherheit bei Förderzusagen. Das wäre im Sinne von Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitsplätzen und künftigem Wohlstand.«
Das ist keine Liste präziser Maßnahmen, die jetzt in diesem Land für das Weiterbestehen der Automobilindustrie unabdingbar sind. Sie werden kaum in der Lage sein, verlorenes Vertrauen wiederherzustellen.
Auch die Neuaufstellungen, die Blume vom Sanierungsprogramm bei VW berichtet, wirken merkwürdig unentschlossen. Man will kein Ziel streichen, und auf dieser Basis das beseitigen, was Kunden bisher vom E-Mobil-Kauf abhielt. VW will preisgünstigere E-Automobile anbieten. Es sollen wieder stärker hybride Fahrzeuge (Mischformen von E-Motoren und Verbrenner-Motoren) angeboten werden, um den Reichweiten-Problemen entgegenzuwirken. Die Probleme bei der Batterie-Produktion sieht Blume als kurzfristig lösbar an. Zu den Problemen in China macht der VW-Chef eine sehr forsche Aussage: »In China liegen noch ein zwei schwierige Jahre vor uns. Es wird zu Kapazitätsanpassungen kommen.« Aber dann: »Wir haben alle Möglichkeiten, um in China auch in Zukunft erfolgreich zu sein – mit lokaler Entwicklungskompetenz, mit auf die lokalen Kundenwünsche angepassten Fahrzeugen und mit wettbewerbsfähigen Kosten.« Aber ist es nicht gerade China, das all die »lokalen« Produktionen, die es selber meistert, auch in die eigenen Hände überführt? Und was die technologische Zukunft des Automobilbaus betrifft, erneuert der VW-Chef seine einseitige Festlegung: »Die grundsätzliche strategische Richtung hin zur E-Mobilität ist klar.« Eine forsche Ansage machte auch der Markenchef der Volkswagen AG, Thomas Schäfer, in der Bild am Sonntag: »Wir wollen auch im Elektrozeitalter die Nummer eins in Europa sein – mit mindestens drei VWs im Top-zehn-Ranking der EU.«
Man kann schon jetzt prognostizieren, dass diese forschen Zukunftserklärungen als bloße Stimmungsmache und grobe Verletzung der unternehmerischen Verantwortung scheitern werden. Auf jeden Fall wird auf dieser Grundlage kein großes Automobilunternehmen mit hohen Absatzzahlen für ein breites Publikum wiederhergestellt werden. Vertrauen von Kunden, Belegschaft und Investoren wird durch diese Unentschiedenheit und Unübersichtlichkeit nicht zu gewinnen sein. VW hat sich nur etwas Zeit gekauft. Aber diese Zeit könnte bald schon abgelaufen sein.
Eine EU-Verordnung, die sich nun als ruinös erweist
Am 11.10.2024 berichtet die FAZ von einem gemeinsamen Positionspapier der Wirtschaftsminister der Bundesländer Niedersachsen, Hessen, Sachsen, Berlin (alle SPD), in dem sie die Bundesregierung und die EU-Kommission auffordern, »die geltende abrupte Absenkung der CO2-Flottengrenzwerte durch eine flexible Absenkung zu ersetzen«. Ein Überschreiten der Grenzwerte, deren Verschärfung für das Jahr 2025 festgelegt ist, werde milliardenschwere Strafen nach sich ziehen, die nötige Investitionen erschwere. Der europäische Automobilverband ACEA hatte schon im September kurzfristige Erleichterungen gefordert, weil ansonsten Strafzahlungen von bis zu 15 Milliarden Euro drohen. Eine Überprüfung der Flottengrenzwerte durch eine Expertenkommission, die die EU-Kommission für 2025 in Aussicht gestellt hatte, komme zu spät. Das Positionspapier der SPD-Wirtschaftsminister (es ist in der FAZ vom 14.10.2024 abgedruckt) weist darauf hin, dass die Berechnung auf Basis der Gesamtflotte eines Herstellers die traditionellen Automobil-Hersteller gravierend benachteilige, die bisher die Kunden mit Verbrenner-Automobilen versorgen und dafür große Belegschaften haben. Neugegründete, reine E-Mobil-Hersteller mit viele weniger Beschäftigten seien nicht betroffen.
Der FAZ-Artikel berichtete von mehreren Treffen zwischen der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und den Chefs verschiedener Automobilkonzerne. Und er berichtete, dass die Kommission an den Flotten-Grenzwerten und Strafen für 2025 festhielt. Begründet wurde dies damit, dass die CO2-Ziele für 2025 schon 2019 vom Europaparlament und vom EU-Ministerrat verabschiedet wurden. Die Branche hätte mithin genügend Zeit gehabt, sich auf die gesetzten Ziele vorzubereiten. Damit wurde behauptet, dass alles erfüllbar sei, wenn man sich nur rechtzeitig anstrengt. Das war eine dreiste Schuld-Zuweisung seitens der EU-Kommission. Denn inzwischen war längst klar, dass die damaligen EU-Grenzwert-Beschlüsse auf völlig illusorischen Einschätzungen beruhten: Man ging von einem boomenden Markt für E-Automobile aus. In Wirklichkeit war dieser Markt im Herbst 2024 schon seit längerer Zeit dramatisch rückläufig. Die Flotten-Grenzwert-Beschlüsse gingen auch davon aus, dass die europäischen Autobauer bei der E-Mobilität große Exporterfolge erzielen würden. In Wirklichkeit waren inzwischen längst chinesische Hersteller weltweit auf dem Vormarsch. Angesichts dieser Lage wäre die Reduktion der CO2-Flottenemission, die notwendig wäre, um die EU-Grenzwerte für das Jahr 2025 einzuhalten und Strafzahlungen zu vermeiden, unerreichbar – es sei denn, die Autounternehmen würden einen Großteil ihrer Verbrenner-Fahrzeuge aus ihrem Angebot entfernen. Damit hat sich die so unscheinbare EU-Verordnung de facto in ein radikales Stilllegungsprogramm verwandelt.
Das Verbrenner-Verbot hat schon begonnen
Aber gibt es eventuell ein Einlenken der EU-Kommission und eine Korrektur der Verordnung? Diesen Eindruck erweckt ein Artikel, der am 31.Januar 2025 in der FAZ unter der Überschrift »Keine CO2-Strafen für VW und Co?« erschienen ist. Dort heißt es, die Kommission sei »offensichtlich umgeschwenkt«. Ein Aktionsplan, den der zuständige EU-Verkehrskommissar am 5.März 2025 vorlegen will, soll zwar die bekannten Transformationsziele »Förderung von Innovationen, Umstellung auf Elektromobilität, Bau von Ladeinfrastruktur, Batteriefertigung und Umschulung von Arbeitskräften« wiederholen, aber der FAZ-Artikel fügt hinzu: »Hoffnung können die Autokonzerne aber aus der Zusicherung schöpfen, einen pragmatischen Regelungsrahmen schaffen zu wollen.« Die Hoffnung soll also auf das Wörtchen »pragmatisch« gebaut werden. Da hätte man doch gerne Näheres erfahren. Im FAZ-Artikel wird folgende Passage aus einem »Wettbewerbsfähigkeits-Kompass« zitiert, der noch schnell dem EU-Aktionsplan hinzugefügt worden war:
»Im Rahmen des Dialogs werden wir sofortige Lösungen finden, um die Investitionsfähigkeit der Industrie zu sichern, indem wir mögliche Flexibilitäten prüfen, um sicherzustellen, dass unsere Industrie wettbewerbsfähig bleibt. Ohne die 2025-Ziele zu entschärfen.«
Die EU will also an den Grenzwerten festhalten, aber gleichzeitig »Flexibilitäten prüfen«. Wie soll man sich das vorstellen, was ja eigentlich ein Widerspruch in sich ist? Und da zitiert die FAZ nun den Europaabgeordneten Peter Liese (CDU):
»Unsere Fraktion will Unternehmen, die die Ziele 2025 nicht erreichen, ermöglichen, Strafzahlungen durch die Übererfüllung der Ziele in den Jahren 2026 und 2027 zu vermeiden.«
Das ist nun freilich eine echte Falle für die Automobilunternehmen. Sie sollen die Ziele hinnehmen, aber gewissermaßen »Erfüllungs-Schulden« aufnehmen. Sie müssten dann in der Jahren 2026 und 2027 die Grenzwerte stärker unterschreiten, um ihre Erfüllung-Schulden von 2025 auszugleichen. Oder, wenn sie das nicht schaffen, müssten sie einen aufsummierten und daher viel größeren Straf-Betrag zahlen. Damit werden die CO2-Flottengrenzwerte ab dem 1.1.2025, von denen ja nicht der mindeste Abstrich gemacht worden ist, im Nachhinein erst recht ruinös. Es wird also nur scheinbar Milde gewährt, um dann umso härter zuzuschlagen. Einen ähnlichen Vorschlag wie die CDU-Europaparlamentarier hat übrigens der deutsche Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) schon im Dezember 2024 gemacht.
Das Ganze erinnert an jenen alten Mechanismus, durch den arme Bauern nach schlechten Ernten durch billige Kredite in Abhängigkeit von einem reichen Geldgeber gerieten. Diese Bauern konnten in der Regel gar nicht die Erträge erwirtschaften, um aus den Schulden wieder herauszukommen. Sie versanken in einer immer drückenderen Schuldknechtschaft. In eine ähnliche Falle führt eine zeitlichen »Verrechnung« von Emissions-Strafzahlungen. Ein finsteres Kapitel der Wirtschafts- und Sozialgeschichte lässt grüßen.
Die Überdehnung wird zur Enteignung
Die Affäre um die Flottengrenzwerte zeigt, dass sich die Überdehnungskrise, in der das Unternehmen VW und ein Großteil der europäischen Autoindustrie steckt, mit dem Jahr 2025 zuspitzen könnte. Denn die beiden großen Überdehnungen kommen hier und jetzt zusammen: Die Märkte für die E-Mobilität brechen zusammen, weil eine Technologie, die unter ökologischen Vorzeichen den Unternehmen auferlegt wurde, sich als zu teuer und unpraktisch erweist. Und zugleich findet auch an der Globalisierungsfront eine Verschlechterung statt. Die großen Automobilkonzerne müssen hohe Kosten für Investitionen vor Ort aufbringen, um in einem viel stärker geteilten Weltmarkt nach dem Prinzip »local to local« weiter präsent zu sein. Die Unternehmen könnten sich genötigt sehen, ihre Produktion von Verbrenner-Fahrzeugen in andere Teile der Welt, deren Märkte kein technologisches Zwangskorsett haben, auszulagern. Und in Europa bliebe dann nichts mehr übrig als eine E-Mobil-Produktion ohne breite Käuferschichten. Und wer glaubt im Ernst, dass man die Leute mit einer vorgezogenen Zwangsreduzierung der Verbrenner-Produktion und mit immer höheren Zwangsabgaben für Benzin und Diesel zur E-Mobilität prügeln kann?
Wir stehen vor der Zuspitzung einer Krise, in der ein ganzer Industriezweig auf verlorenem Posten steht. Eigentlich könnte er hervorragende und bewährte Produkte liefern, für die es auch einen Bedarf gibt. Eigentlich verfügt er über leistungsfähige, zuverlässige Produktionsanlagen und Belegschaften, die das Resultat einer langen Entwicklungsgeschichte sind. All das ist noch da. Es steht noch bereit. Aber jetzt wird es nicht mehr irgendwie in eine große Epoche der E-Mobilität »übergeleitet«. Nein, es wird stillgelegt. Es wird den Kunden, den Belegschaften, den Unternehmern weggenommen. Die erheblichen Kürzungen und Stilllegungen an den verschiedenen VW-Standorten sind Einschnitte, die viel zu tief gehen, um bloße »Anpassungen« zu sein. Es wird jetzt immer deutlicher, dass hier eine Enteignung stattfindet. Eine technologische Enteignung, die sich Produktionsmitteln und Arbeitsplätzen materialisiert.
So wird die Überdehnungskrise – weil es keine Rückverschiebung gibt – zu einer Enteignungskrise. Bisher konnten die Begründungen, die zur »unvermeidlichen Verkehrswende«, zur »unaufhaltsamen Globalisierung« und zur »großen Transformation« vorgetragen wurden, als gedankliche Irrfahrten angesehen werden. Doch jetzt wird die Gleichgültigkeit und Rücksichtslosigkeit, die diese Begründungen schon enthielten, zur materiellen Zwangsgewalt. Die Affäre um die EU-CO2-Flottengrenzwerte zeigt eine eiskalte Bereitschaft, jetzt vollendete Tatsachen zu schaffen. Die Enteignung marschiert.
Auch Sätze wie »Das ist mit den EU-Regeln unvereinbar« oder »Das ist mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts unvereinbar« bekommen nun einen anderen Klang. Sie bedeuten nun, dass diejenigen, die diese Regeln und Urteile beschlossen haben, bereit sind, dafür fundamentale Rechte, Güter und Fähigkeiten zu opfern. Und mehr noch: Dass sie die Auflösung tragender Strukturen von Wirtschaft und Staat eines modernen Landes billigend in Kauf nehmen. In einem der größten deutschen und europäischen Industriezweige ist die Zerstörung der Unternehmens-Landschaft eine unmittelbare Gefahr. Sie wird ihrer Fähigkeit beraubt, aus eigenen Mitteln positive Erträge zu erwirtschaften, und so aus eigener Kraft die eigene Existenz zu behaupten.
Die Unternehmen sind der Schlüssel
Durch diese neue Situation bekommt die Rekonstruktionsaufgabe eine zusätzliche Dringlichkeit. Es ist hier noch nichts wirklich gelöst, aber es ist doch schon etwas Gutes geschehen im Land: Die Unternehmen sind stärker in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Die Einschätzungen der Unternehmer zu ihrer Lage und zu ihren Zukunftsaussichten werden mit größerer Aufmerksamkeit verfolgt. Der Glaube, dass es ein Naturgesetz der Marktwirtschaft gibt, nach dem die Dinge bei irgendwelchen Abstürzen wie von selbst wieder auf die Füße kommen, ist brüchig geworden.
Das bietet die Chance einer Rehabilitierung der unternehmerischen Vernunft. Diese Vernunft ist nicht nur etwas, das »die Unternehmer« haben sollten, sondern das die ganze Wirtschaft eines modernen Landes bestimmen sollte. Es geht um die Erkenntnis und Erfahrung, dass eine moderne Wirtschaft produktive Grundeinheiten braucht, die aus eigenen Mitteln stetig eine Mehrprodukt schaffen können und tatsächlich schaffen. Also Grundeinheiten, die eigenständige Einheiten sind, die nicht von fremder Hand eingesetzt sind, und nicht von ihren Regelungen und Subventionen existenziell abhängig sind. Die nicht bloße Diener und Handlanger zur Umsetzung von höheren Vorgaben, Regeln oder Werten sind. Die Unternehmen sind die Souveräne des Marktes, die Festungen der Freiheit. In ihnen entscheidet sich die Produktivität einer Marktwirtschaft. Sie müssen die verschiedenen Faktoren und Ressourcen zusammenbringen. Sie sind der entscheidende Bilanzort der Wirtschaft. Die Marktwirtschaft eines modernen Landes müsste deshalb eigentlich »unternehmerische Marktwirtschaft« heißen. Denn das ist das wichtigste Spezifikum, dass die moderne Marktwirtschaft von der Marktwirtschaft früherer Geschichtsepochen unterscheidet. Das Spezifikum, das die Wirtschaft als eine eigenständige Sphäre von der politischen Sphäre unterscheidet. Deshalb ist es im Grunde eine Entmündigung der unternehmerischen Marktwirtschaft, wenn man sie in »soziale Marktwirtschaft« umtauft, oder – in unseren Tagen – in »ökologische Marktwirtschaft«. Ist hier nicht ein großer Opfergang vorprogrammiert, wenn man »die Gesellschaft« oder »die Natur« zum Leitmotiv der Marktwirtschaft erklärt? Man stellt die Marktwirtschaft unter tendenziell unendliche Größen und macht sie anfällig für alle möglichen Übergriffe. Die Unternehmen, die mit ihrem Produktivitäts-Gesetz solche unendlichen Größen konterkarieren könnten, waren lange Zeit zur Bedeutungslosigkeit verurteilt. Jetzt führt kein Weg an ihrer Rehabilitierung vorbei.
*
Das könnte auch zur Überwindung eines falschen Gegensatzes führen: zur Überwindung der Vorstellung, dass die Unterschiede, die zwischen der Unternehmerseite und der Belegschaftsseite bestehen, antagonistische Widersprüche sind. Also zur Überwindung der Vorstellung einer unüberwindlichen Feindschaft zwischen beiden Seiten. Es gibt ja eine vielfach unterschätzte und allzu schnell wieder verdrängte Erfahrung der Anfangsjahrzehnte der Bundesrepublik: dass Unternehmerseite und Belegschaftsseite auf Grund ihrer Zugehörigkeit zum Unternehmen miteinander verbunden sind. Und dass sie deshalb Sozialpartner werden können. Das wurde schließlich auch vom Godesberger Programm der SPD reflektiert, aber es war in den Betrieben gewachsen, bevor es politisch aufgegriffen werden konnte. Die Sozialpartnerschaft ist also eine genuin unternehmerisch-marktwirtschaftliche Partnerschaft. Sie ist nicht etwa eine Frucht der »sozialen Marktwirtschaft«. Eher sind unter Berufung auf neue »gesellschaftliche« Ansprüche neue Widersprüche in die Sozialpartnerschaft hineingetragen worden. Dazu gehört zum Beispiel der Anspruch, dass die ganze Gesellschaft einen Anspruch auf Bildungsaufstieg und entsprechende Arbeitsplätze hat. Ein noch größerer Zwiespalt wurde in die Sozialpartnerschaft hineingetragen, als zusätzlich zu den sozialen noch »ökologische« Ansprüche in die Unternehmen hineingetragen wurden. Durch sie wurde die produktive Vernunft der Unternehmen massiv in Frage gestellt. So kann man sich vorstellen, wie die Delegitimierung der unternehmerischen Vernunft und die Entwertung der betrieblichen Bindungen sich Jahr für Jahr tiefer ins Land und seine Unternehmens-Landschaft gefressen hat. Und wie es soweit kommen konnte, dass wir jetzt, im Jahr 2025, tatsächlich eine veritable Unternehmenskrise in Deutschland haben.
*
Allerdings sollte man einer Tatsache, die gegenüber der Situation der Anfangsjahrzehnte der Bundesrepublik neu ist, ins Auge sehen. Man könnte ja annehmen, dass die Unternehmensbindungen der damaligen Zeit dadurch begründet waren, dass es Aufbau-Jahre waren und deshalb Zugewinne sowohl für die Unternehmerseite als auch für die Belegschaftsseite ermöglichte. Dass es also eine sogenannte Win-Win-Situation war. In der heutigen Zeit liegen die Tatsachen anders. Es stehen keine zusätzlichen großen Gewinne in Aussicht. Die Rückverschiebungen, die die Rekonstruktions-Aufgabe prägen, können solche Gewinne redlicherweise nicht versprechen. Sie können nur die Wiederherstellung einer tragfähigen Unternehmens-Grundlage versprechen. Das schließt positive Erträge ein, aber sie werden weder die Gewinne der Zeiten des »Wirtschaftswunders« noch die Zeiten des »Exportweltmeisters« erreichen.
Das bedeutet, dass die Schlüsselrolle der Unternehmen nicht zu vordergründig auf das Versprechen einer neuen Win-win-Situation gebaut werden sollte. Die Begründung dieser Schlüsselrolle muss defensiver und elementarer ausfallen: Es geht in dieser Zeit um eine Selbstbehauptung der deutschen Wirtschaft. Exemplarisch dafür geht es um die Selbstbehauptung von VW als einem Großunternehmen der Automobilindustrie – einem Unternehmen, das für die Verfügbarkeit des Automobils als Massenverkehrsmittel für breite Bevölkerungsschichten unabdingbar ist.
Der längere Hebel
Es gibt hierzulande durchaus einen beträchtlichen sozialen Sektor, der bereit ist, die Automobilindustrie und das Auto als Massenverkehrsmittel zu opfern. VW ist ihm egal. Es ist ein Sektor, der bereit ist, seine Ziele mit allen Mitteln zu verfolgen – mit rücksichtsloser, kalter Abwicklung; mit arglistiger Täuschung; mit dem Bluff des »geht rechtlich nicht«, mit der Berufung auf »die« Wissenschaft. Auch der Hebel der massenmedialen Aufblähung gehört dazu. Dagegen nur die besseren Argumente zu haben, reicht nicht. Der Sektor wird noch manchen »Sieg« auf seinem Spielfeld davontragen: beim täglichen Beschwören und Beschreien finsterer Katastrophen. Manche Stilllegung ist da schnell durchgesetzt. Manches »innovative Projekt« lässt sich toll in Szene setzen. Aber davon wird das Land nicht satt, sicher und sauber.
An dieser Stelle hat die große Transformation ihren wunderbaren Haken: Diejenigen, die da die Unternehmen und ihre produktiven Fähigkeiten enteignen, sind keineswegs in der Lage, diese Fähigkeiten irgendwie zu übernehmen und im Ertrag zu ersetzen. Man sehe sich die Leute, die die großen »Wenden« ausrufen, nur einmal näher an: Sie haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Sie haben weder Kraft noch Ausdauer zu täglicher, handfester Arbeit. Da liegt ihr süßes Geheimnis: Die Anhänger der großen Transformation erwarten insgeheim, dass andere diese Arbeit für sie erledigen. Man höre sich nur an, was sie heute zur Überwindung der Arbeitskräfte-Knappheit vorschlagen. Alles kommt vor, nur nicht eine drastische Reduzierung des heutigen Akademiker-Anteils von über 50 Prozent eines Jahrgangs.
So kann man in den kommenden Jahren mit folgendem Szenario rechnen: Es wird im Lande an immer mehr Stellen eine bedrückende Knappheit ausbrechen. Und diejenigen, die reale Betriebe führen können, und diejenigen, für die reale Arbeit kein Problem ist, werden in dieser Knappheit eher Wege zu ihrem Auskommen finden als die Prediger der »Zuversicht«.
Mit diesem Wechsel des Spielfelds eröffnen sich viele Möglichkeiten, Druck auszuüben. Auf diesem Feld liegt der längere Hebel, mit dem die Überdehnung ausgehebelt werden kann. Und mit dem dann auch, auf sicheren Boden, der konstruktive Wiederaufbau geschafft werden kann.
VW – Die Zerstörung der unternehmerischen Vernunft
VW – Teil 1: Die Zerstörung der unternehmerischen Vernunft
VW – Teil 2: Eine Überdehnungskrise
VW – Teil 3: Die Rekonstruktionsaufgabe