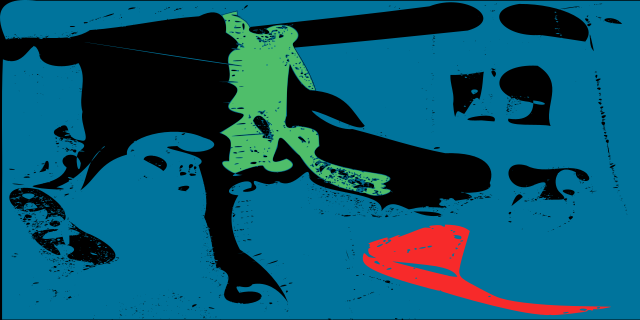von Gunter Weißgerber
Unlängst fiel mir ein kleines Büchlein in die Hände. Schwarz, mit einem mainstreamverweigernden Bild inmitten der vorderen Umschlagseite. »Notizen zur Deutschen Einheit« verspricht der Titel. Ziemlich eigenständig ist darunter eine aktuelle Deutschlandkarte, die, scheinbar verwirrt, statt der üblichen innerdeutschen West-Ost- ›Grenz‹ziehung Deutschland querstreift, von Nord nach Süd herunter. Immer mit quer laufenden Schwarzweiß-Balken. Wobei ab dem ›Weißwurstäquator‹ die schwarz-weißen Balken durch grau-weiße Balken abgelöst werden. Oder interpretiere ich nur zu viel hinein?
Ulrich Schödlbauer kam viel herum. Weltweit und innerdeutsch. Sein Interesse galt und gilt mehr dem ›Dahinter‹, wohlwissend, dass das ›Dahinter‹ meist zuerst am ›Davor‹ bemerkbar ist. Viele ›Davors‹ entpuppen sich dann plötzlich als lange Linie und neue Qualität. Schödlbauer ist in diesem Sinne klassischer Hegelianer, das Umschlagen von Quantitäten in neue Qualitäten ist der Kern seiner nahezu spielerisch daherkommenden Beobachtungen.
Vorab: Ulrich Schödlbauer schrieb seine Notizen als Livestream zwischen 1991 und 1994. Seine damaligen Beobachtungen und Wertungen sind nachträglich im Zeitdokument nicht mehr korrigierbar. Was anderen Zeitgenossen, die sich zwanzig und mehr Jahre später zu den Ereignissen der ersten Jahre des nunmehr vereinigten Deutschlands nach 1990 äußern, leichter fallen kann. ›Das habe ich schon immer gewusst!‹, so ein Satz geht für die meisten Autoren nur im Danach, nicht im Mittendrin.
Wer Utopie sagt, lügt: Der Eindruck, zwingend für jeden, der im Zeichen der ›Wende‹ die Grenzlinie von West nach Ost überquerte, ohne durch frühere Gewöhnung und früheres Verwöhntsein korrumpiert worden zu sein, markiert die Grenzscheide zwischen den zwei Bevölkerungen, die sich nach der Wende auf dem Terrain des verschlissenen Realsozialismus begegneten. Zutage lag die Lüge bei denen, die der Schnittmenge aus beiden zugehörten, den Vertretern der sich aus den Cliquen der alten Gesellschaft rekrutierenden Schiebergesellschaft. Ihr Interesse an politischer Reflexion erschöpfte sich darin, das eigene Schäfchen so rasch wie möglich ins trockene zu bringen. Für sie funktionierte die Rede von der unverzichtbaren Utopie wie eine spanische Wand, mittels derer sie ihre Geschäfte gegen die Öffentlichkeit abzuschirmen gedachten…(S. 13).
Soweit ein erstes Zitat des klugen Beobachters. Schödlbauer malt ein treffendes Bild in barocker Fülle. Voll tiefer Einsicht in die zeitgenössische Erkenntnis, dass das Wort ›Utopie‹ damals ohne die Lüge im Schlepptau nicht allein daherkommen kann. Utopie und Lüge bedingen einander. Nicht zwangsläufig, aber die bisher größten Utopien führten direkt oder auf Umwegen in die Lager. Es steht zu befürchten, dass das so bleiben wird. Auch die Utopie des Multikulturalismus wird letztendlich ins Verderben führen. Ist es da noch wichtig, ob sie einstmals gut gemeint war?!
Schödlbauer weiß das. Genau diese Phänomene sah er bei seinen neu gewonnenen Mitbürgern in der früheren DDR. Und er sah noch mehr! Er sah die Liga der Cleveren, der systemunabhängigen Geschäftemacher. Schödlbauer schwante, dass nichts Gutes aus alledem erwachsen würde. Was er in diesem Zusammenhang nicht sah oder erwähnte, waren die zum Glück auch das Podium betretenden gut ausgebildeten und mit lauteren Motiven kommenden Helfer aus dem Westen. Auch die gab es und es waren nicht wenige. Spontan fallen mir Hinrich Lehmann-Grube, Kurt Biedenkopf und Bernhard Vogel ein. Es gäbe weit mehr Namen zu nennen.
Aus einer zur Realität umgelogenen Utopie, entwickelte sich unverhofft ein Stück Wirklichkeit. … Und als nach dem Ende der DDR der gewohnte Griff nach der leitenden Hand ins Leere ging, begann das zusehends irritierte Volk für eine kleine Weile in die Parolen seiner ehemaligen Vordenker einzustimmen. (S. 16/17)
Schreibt Schödlbauer von den ›Komitees für Gerechtigkeit‹? Nimmt er, ohne es damals ahnen zu können, Pegida-Anfänge 25 Jahre später vorweg?
»Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört.« »Die Mauer in den Köpfen muß weg.« – Mit diesen beiden Sentenzen bemächtigte die westdeutsch geprägte Politik sich des Innenlebens des revolutionären Subjekts. … Unverblümt lautete die Botschaft, die politische Form der Einigung sei nur ein technisches Problem, das die Spezialisten des Status Quo unter sich zu bewältigen hätten. (S.29/30)
Schödlbauer stößt in einen Schwachpunkt ostdeutschen Selbstverständnisses vor. Es den Technokraten zu überlassen, war der Rettungsring vieler Ostdeutscher: Technokraten als nüchterne Dispatcher schier unlösbarer Probleme. Technokraten jedoch sind auch nur Menschen mit eigenen Anschauungen, die zugleich politisch sind. Allerdings sprechen Technokraten nicht über derlei Dinge. Mit der Übergabe von Problemlösungsvollmachten an eine vermeintlich unparteiisch agierende technokratische Schiedsrichterinstanz gaben die Ostdeutschen eigenen Einfluss scheinbar fair ab. Konkret, das ›Sich-zurechtfinden‹ in der neuen Regel- und Anspruchswelt überforderte viele ostdeutsche Abgeordnete nicht anders als die meisten ihrer Zeitgenossen. Das Kämpfen um konkrete Standorte, Einflusssphären usw. wurde nur von wenigen ostdeutschen Abgeordneten laut, vernehmlich, penetrant gar artikuliert. Pegida, Jahrzehnte später, mag auch ein Ergebnis dieses Defizits sein. Das Wahlvolk will konkret wissen: ›Was hast Du für uns getan?‹
Ab 2014 wurden dann die Stimmen im Elbtal laut, die genau diese wenig wahrgenommene Interessenvertretung der eigenen Spezies lautstark als ›Verrat‹ verunglimpften. Sie selbst jedoch hatten seit 1989 versäumt, sich einzubringen und es besser machen zu wollen. Demokratie kann so nur als reine Bedien- und Schaufensterdemokratie daherkommen.
Schödlbauer: Nicht die Gesinnung hielt den Verrat vor, sondern ein allgemeiner sozialpsychologischer Mechanismus. Verrat, an was auch immer: Wesentlich daran blieb das elementare Gefühl des Verraten-, des Sichvergangenhabens. Wodurch? Durch Nichtstun, durch Gewährenlassen,... …Vermöge solcher Mechanismen verkaufte sich der realsozialistische Staat teurer, als er es jemals auf dem Verhandlungswege hätte tun können. (S.32 und 34)
Im Folgenden geht es ans Eingemachte -– die Friedliche Revolution. Wohlgemerkt in den frühen 90ern und nicht 2017 geschrieben: Zu ihnen gehört die Legende von der ›abgetriebenen‹ Revolution. Ihr Haupt- und Prunkstück ist der Parolenwechsel auf den Leipziger Montagsdemonstrationen von »Wir sind das Volk« zu »Wir sind ein Volk«. Mit ihm, so wird unterstellt, sei die Sache der Bürgerrechtler verraten und der Liquidation der DDR, ihrer Auslieferung an das ›System‹ der Bundesrepublik und den Ehrgeiz der Bonner Politikerklasse der Boden bereitet worden. … Daß eine andere, zivilere und sogar liberale Lesart denkbar und plausibel gewesen wäre, eine, in der sich der politisch bewußte Teil der DDR-Bevölkerung nicht um seine Revolution hätte betrogen fühlen müssen, stand sichtlich keinen Augenblick zur Diskussion. (S. 36/37). Hier wäre dem Autor allerding zu widersprechen. Stimmen, die es so sahen, wie es hier beschreiben wird, die gab es. Und ja, sie hatten sich durchgesetzt. Wäre dies nicht der Fall gewesen, würden heute Putins Truppen in jeder Kreis- und Bezirksstadt der MfS-reformierten DDR gut auf die Ostdeutschen aufpassen und die Westdeutschen stünden im Osten ihres Teil-Landes noch immer vor einer gefährlichen Grenze. So ist diese waffenstarrende und mörderische Demarkationslinie jetzt bis hinter Polen gerutscht. Wer würde bestreiten, dass das nicht besser so ist!
»Die Karl-Marx-Universität steht nicht für beliebige Lehrinhalte zur Verfügung«: Das hörte der Gast aus dem Westen im Sommer 1990, den Leipziger Augustusplatz vor Augen, aus dem Mund eines ›Unbescholtenen‹, dem alsbald die Aufgabe übertragen werden sollte, sein Fach zu reformieren. Der so sprach, dachte nicht daran – oder doch? – daß er damit an einen Vorgang rührte, der inzwischen dreißig Jahre zurücklag. Damals hatte ein ›Student‹ unter dem Titel »Eine Lehrmeinung zuviel« die Treibjagd auf den Germanisten Hans Meyer eröffnet. … Die Angst der Verlierers, die auf Kongressen paradierte und sich zu Hause in Aktenberge vergrub, unterschied den ostdeutschen Wissenschaftler von seinen polnischen oder ungarischen Kollegen, die sich ohne Aufhebens zu den Siegern der Geschichte zählten und zählen durften, ein wneig erschöpft zwar ob der knappen Kassen, aber einverstanden mit dem Gang der Dinge. Sie machte ihn kenntlich, sie machte ihn unkenntlich. Sie nahm ihm das Gesicht. (S.54/55). Ein schönes Bild. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Die einen brachten den Zug mit in Bewegung, die anderen gaben sich die Rolle des unlustigen Ttrittbrettfahrers.
Die ›wehrhafte Demokratie‹ mußte sich fallweise einreden, daß sie es war. Diesmal liegen die Dinge anders. Die demokratische, die westliche, die europäische Option, sie sind, abseits der operativen Politik, gleichzeitig wichtig und schal geworden. Die verdrossene Republik faselt, als habe sie die Wahl und gehe nicht hin. … Gäbe es nicht den Sport, man wäre ernsthaft in Sorge. (S. 60/61). Schreibt Schödlbauer von 1994 oder 2017?
Der westdeutsche, nun gesamtdeutsche Staat geht traditionell barsch mit seinen Ziehkindern an den Rändern des ideologischen Spektrums um. Das ist eine der Konsequenzen aus der nationalsozialistischen Katastrophe. Daß ihm linker und rechter Rand in der Praxis unterstellen, auf dem jeweils anderen Auge blind zu sein, stellt ihm ein besseres Zeugnis aus, als die öffentliche Meinung normalerweise zuzugeben bereit ist. (S. 66). Diese Einschätzung dürfte nach 23 Jahren einer Revision wenig Gegenwehr leisten. Was kein Vorwurf an den Verfasser sein kann.
Die durch die Verträge von Maastricht ausgelöste Dynamik erschient dagegen als Preis der Einheit, als Oktroi. Souveränität und Entmündigung zeigen sich als zwei Seiten ein und derselben Sache. Noch stehen die Dinge auf Messers Schneide…. (S.79).
Das lasse ich jetzt mal so stehen: Noch stehen die Dinge auf Messers Schneide.
Ulrich Schödlbauer macht einem das schnelle Lesen nicht leicht. Ihn schneller zu lesen als er seinen Text zu Papier gebracht hat, gelingt nicht. Die Neugier bedarf der Kraft. Für alle die Leser, die diese Kraft, dieses Ringen um das Verstehen-Wollen der Schödelbauerschen Gedanken und Einsichten aufbringen wollen und können, haben sich die »Notizen zur deutschen Einheit« mehr als gelohnt! Außerdem ist das kleine Buch für die Liebhaber von Buchkunst ohne Zweifel ein besonderer Leckerbissen.
Ein letztes Zitat an dieser Stelle: Es ist daher wichtig, zu sehen, wo die Zäune errichtet werden. Gelegentlich sind die Ausperrer früher zur Stelle als die Auszusperrenden. Kein Faktum ist beredter. Was kommt, wissen sie aus sich selbst; sie lassen kommen. (S. 80)