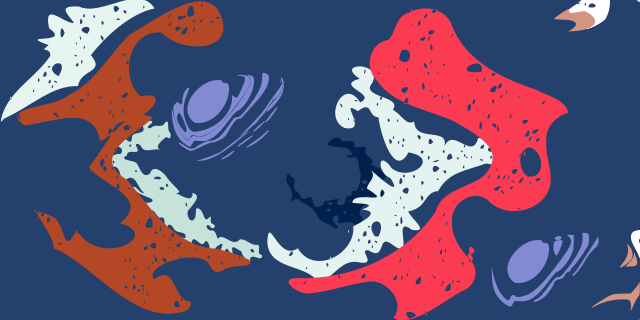von Andreas Kalckhoff
Keine fünfzehn Jahre, nachdem die morsche Monarchie in Deutschland zerbrochen war, sank auch die junge Republik, mehr fallend als gestoßen, ins Grab. Wie konnte es dazu kommen? Das Unheil bereitete sich bereits im Februar des Jahres 1919 vor. Die Revolution in München, die von großen Hoffnungen getragen wurde, endete mit der Ermordung des ersten republikanischen Ministerpräsidenten und dem blutigen Sturz der folgenden Räteregierung durch Truppen der SPD-geführten Reichsregierung. Die demokratische Zivilgesellschaft zeigte sich nicht in der Lage, mit der ihr zugefallenen Macht verantwortungsvoll umzugehen. Während große Teile von ihr – auch in der SPD – mit rechtsextremistischen Kräften paktierten, setzte eine Handvoll Wirrköpfe für radikalsozialistische Träume alles aufs Spiel. Das endete in Bayern und später auch im Reich mit dem Sieg der demokratiefeindlichen Reaktion.
Der Magistrat genehmigt die Revolution
Der 7. November 1918 war ein schöner, warmer Herbsttag, friedlich glänzten Münchens Türme im milden Herbstlicht. Dass dieser Donnerstag dennoch nicht irgendein beliebiger Wochentag war, zeigte sich gegen ein Uhr, als die meisten Läden und Betriebe schlossen. Der Grund war, dass ›Mehrheitssozialisten‹ (SPD) und ›Unabhängige‹ (USPD) die Arbeiterschaft für drei Uhr zu einer Versammlung auf die Theresienwiese gerufen hatten, um – wie an den Litfasssäulen zu lesen war – »im Geiste der Freiheit und Verantwortung Stellung zu nehmen zu den großen Tagesfragen«.
Der Magistrat der Stadt München hatte die Demonstration genehmigt, die bürgerliche Geschäftswelt tat durch die vorsorgliche Unterbrechung von Produktion und Dienstleistung das Ihre, damit die Friedensdemonstration stattfinden konnte; denn um Frieden ging es dieser Tage der Bevölkerung am meisten. Unterdes machte König Ludwig III. im Englischen Garten seinen gewohnten Nachmittagsspaziergang.
Den öffentlichen Aufruf zur friedlichen Versammlung auf der ›Wies'n‹, der Oktoberfestwiese, hatte der Führer der Münchner Unabhängigen Sozialdemokraten (USPD) Kurt Eisner mitunterzeichnet. Dabei bestand kein Zweifel, dass der gebürtige Berliner, der vor kurzem erst die Haftanstalt Stadelheim verlassen hatte, wo er wegen Teilnahme am Januarstreik eingesperrt war, anderes im Sinn hatte.
Zwei Tage zuvor war eine im Hackerbräukeller geplante Wahlversammlung der USPD aus Platzgründen schon einmal auf die Theresienwiese verlegt worden. An die zwanzigtausend hatten sich dort im Stockdunkeln versammelt. Die Nachricht vom Kieler Matrosenaufstand (3./ 4. November) hatte die Gemüter erhitzt, revolutionär gestimmte Aktivisten aus der Arbeiterschaft und dem literarisch interessierten Bürgertum schöpften Hoffnung. Die Sonne war schon untergegangen, als der Ruf nach Waffen erklang und Stimmen zum Marsch in die Stadt aufforderten. Doch Eisner mahnte zur Geduld. Er hatte Angst vor Provokateuren, die das Dunkel ausnutzen konnten. »Nur noch kurze Zeit. Aber ich setze meinen Kopf zum Pfande, ehe achtundvierzig Stunden verstreichen, steht München auf! (...) Nicht jetzt, nicht in der Nacht wollen wir aufbrechen. Die Sache des Volkes hat nicht das Licht des Tages zu scheuen. Im Strahl der hellen Sonne wird sich das Volk von München erheben!«
Das war klar und deutlich gesprochen. Tatsächlich kam es am nächsten Tag zu Beratungen zwischen Polizei und königlicher Regierung, ob man Eisner nicht wieder verhaften solle. Auch Erhard Auer, der Führer der Münchner Mehrheitssozialisten, nahm daran teil. Man hielt dies schließlich nicht für nötig. Kriegsminister von Hellingrath verbürgte sich für die Zuverlässigkeit der Armee, Auer für den Einfluss der sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Kader auf die Arbeiterschaft: »Eisner ist erledigt. Sie dürfen sich darauf verlassen. Wir haben unsere Leute in der Hand. (…) Es geschieht gar nichts.«
Das war ein Irrtum. Am Sonntag schon hatte Eisner im niederbayerischen Pfaffenberg Ludwig Gandorfer getroffen, den blinden Vorsitzenden des (kleinen) Bayerischen Bauernbundes, der seinerseits in einem Flugblatt zum Sturz der bayerischen Regierung seiner Majestät Ludwig III. aufgerufen hatte. Eisner, dem man nachgesagt hat, er sei ein weltfremder Träumer, war realistisch genug, zu wissen, dass Revolution in Bayern ohne Unterstützung der Bauernschaft nicht möglich ist. Am Montag konferierte der USPD-Führer mit Vertrauensleuten der Gewerkschaft in Münchens größeren Industriebetrieben – einem Beobachter zufolge gab er dabei »präzise Anweisungen« – und nahm Kontakt zu den Soldaten in den großen und strategisch wichtigen Kasernen auf. Es waren nicht mehr als ein Dutzend Leute, die Eisner bedingungslos folgten, doch wie sich zeigen sollte, waren sie einflussreich und überzeugend genug, ihm eine Gefolgschaft zuzuführen, die Revolution machen konnte.
Die Friedensdemonstration
Was sich am Nachmittag des 7. November auf der Münchner Theresienwiese ereignete, beschreibt der Historiker Karl Alexander von Müller in seinen Erinnerungen folgendermaßen:
Ein anderer Augenzeuge, der Landtagsabgeordnete Ernst Müller-Meiningen senior, sprach von fünfzigtausend Demonstranten. Andere schätzen, dass es bis zu zweihunderttausend Menschen waren, die sich versammelt hatten. Da es noch keine Lautsprecheranlagen gab, gruppierten sich die Versammelten um verschiedene Redner, die über die große Wiese verteilt waren. Dass die beiden Führer der gespaltenen Sozialdemokraten, Auer und Eisner, weit entfernt voneinander standen — der eine an der Bavaria, der andere unterhalb des Hackerkellers –, mag Zufall gewesen sein, symbolisierte aber die Distanz der beiden zueinander.
Die Schilderung, die Felix Fechenbach, wenig später Soldatenrat und persönlicher Adjutant des Ministerpräsidenten Eisner, vom Verhalten der Armeegehörigen gibt, zeigt anschaulich den Kampf, den die rivalisierenden Arbeiterführer und ihre Anhänger um die Gunst der Versammelten austrugen:
Auer und Eisner hatten verabredet, jeweils etwa zwanzig Minuten lang zu sprechen und dann zur Annahme einer Entschließung aufzufordern (für Beibehaltung des Waffenstillstands und Demokratisierung des Wahlrechts), um anschließend die Demonstration zu einem friedlichen Zug durch die Innenstadt zu formieren. Eisner hielt sich jedoch nicht an die Vereinbarung. Seine Position in der Nordwestecke der Theresienwiese kam nicht von ungefähr. Hinter dem Hackerbräu jenseits der Bahngleise, lagen die Kasernen. Während nun Auer nach der Abstimmung über die Resolution – laut Fechenbach hoben sich weit über hunderttausend Hände für die Forderungen der Münchner Arbeiter — die Mehrheit der Demonstranten zum Zug in Richtung Friedensengel abzog, an der Spitze ein Musikkorps, fuhr man in der Eisner-Ecke mit den Ansprachen fort.
Fechenbach berichtet:
»Majestät, schaugn‘s, daß hoamkumma ...«
Als die Demonstranten vor der Türkenkaserne erschienen, sahen die vom Krawall aufgeschreckten Soldaten hinaus, so ein Augenzeuge, und riefen: »Was ist los?« Die Antwort war auf bayerische Art kurz und schlicht: »Wos werd los sei? Revolution is‘!« In der Tat: während der sozialdemokratische Abgeordnete Schmitt unter dem Friedensengel vor dem Gros der Demonstranten forderte, Ruhe zu bewahren und nach Hause zu gehen, war die Münchner Revolution in vollem Gange. Auch wenn es die Regierenden noch nicht glauben wollten. Im Landtag fand gerade eine Aussprache über die Kartoffelversorgung statt. Als man Ministerpräsident v. Dandl von der bedrohlichen Zuspitzung der Lage unterrichten wollte, verbat er sich diese Unterbrechung. Ein Abgeordneter, der Bauernbündler Eisenberger, bemerkte auf die Information hin, dass Eisner schon tausend Mann Militär auf seiner Seite habe, lakonisch: »So, jetzt ham ma's!«
Innenminister Brettreich kannte die Lage mittlerweile genau. Trotzdem beschied er einen Journalisten, der sich nach »Eisners Gewaltstreich« erkundigte, das seien alles Gerüchte, Eisner sitze bereits »hinter Schloss und Riegel«. Majestät, die auf dem gewohntem Nachmittagsspaziergang war, ließ sich von den Zusammenrottungen und bösen Blicken, die man ihm zuwarf, nicht irritieren. Erst als ihn ein Arbeiter mit altmünchner Gutmütigkeit auf den Ernst der Situation hinwies: »Majestät, schaug'n s, daß hoamkurnma, sunst is' g'feihlt aa!« (Majestät, schauen Sie, dass Sie heimkommen, sonst passiert noch was Schlimmes!), eilte der König zur Residenz zurück. Er musste das rückwärtige Apothekertor nehmen
Erst um acht Uhr abends verfügten sich Ministerpräsident v. Dandl und Innenminister Brettreich zum König, um ihm zu eröffnen, dass sie nicht mehr Herr der Lage seien und Gefahr für das Leben Seiner Majestät bestünde. Die Truppe, jedenfalls was die Mannschaftsgrade betraf – und auf die kam es letztlich an –, sei in ihrer Gesamtheit zur Revolution übergelaufen, und die städtische Polizei würde sich kaum gegen die bayerische Armee mobilisieren lassen. Der König zog die Konsequenz und brachte sich in Sicherheit. Gegen halb Elf verließ er im Privatautomobil die Stadt in Richtung Salzburg, noch in der Hoffnung auf eine glänzende Rückkehr nach Ende der Krise.
Auch die Bevölkerung schien die Revolution anfangs nicht ernst zu nehmen. Die Residenz war zwar von Menschen umlagert, über der Wache wehte die rote Fahne, doch man begnügte sich damit, gelegentlich Drohungen zu den dunklen Fenstern hinaufzurufen. Der Schriftsteller Oskar Maria Graf, aktiver Teilnehmer an den Revolutionsereignissen, beschreibt anschaulich die relative Teilnahmslosigkeit, mit der die Münchner von den umstürzenden Neuigkeiten Kenntnis nahmen. Da auch Revolutionäre von Hunger und Durst nicht verschont bleiben, hatte er mit Gefährten, alle bewaffnet, ein Lokal aufgesucht:
Zwar besteht der Verdacht, dass die Schweinshaxe eine dichterische Ausschmückung ist: Kenner der damaligen Ernährungslage bezweifeln, dass dieses begehrte Fleischstück im November 1918 öffentlich zu haben war. Aber die Schilderung trifft trotzdem gut die Entspanntheit, mit der die Münchner anfangs der Revolution begegneten. Vielleicht glaubte man sie einfach nicht.
Selbst Eisner traute dem Erfolg nicht so recht. Bevor der Revolutionszug die Gaststätte Franziskaner am Hochufer der Isar erreichte ab, wo er gerüchteweise am Abend sprechen wollte, setzte er sich ab. Erst als gegen Neun klar war, dass das alte Regime nichts zur Selbstverteidigung unternahm, begab er sich zum Mathäser, jener großen Bierhalle in der Nähe des Hauptbahnhofs, in der die Reisenden früher gern ihren ersten Durst stillten. Dort tagte im Obergeschoss eine Soldatenversammlung, während sich im Erdgeschoss ein Arbeiterrat konstituierte. Vertreter beider Gruppen bildeten danach einen ›Arbeiter- und Soldatenrat‹, zu dessen Erstem Vorsitzenden Kurt Eisner bestellt wurde.
»Die Bayerische Revolution hat gesiegt«
Dieser Rat beschoss umgehend die Aufstellung bewaffneter Patrouillen zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Bewachung öffentlicher Gebäude und für die Besetzung von Zeitungsredaktionen und Druckereien. Unter dem Schutz Bewaffneter begab er sich sodann zum alten Landtag in der Prannerstraße und belegte den Plenarsaal. Es war halb Elf, als Eisner – etwa zum gleichen Zeitpunkt, als der König die Stadt verließ – dort namens des Arbeiter- und Soldatenrates das Ende des Königreiches und die Gründung der bayerischen Republik proklamierte:
Beifall und Jubel brachten die akklamatorische Bestätigung. Kurt Eisner war damit Staatschef in Bayern, der erste Ministerpräsident eines deutschen ›Freistaats‹, d. h. einer Republik. Er verfasste umgehend eine entsprechende Proklamation, die am nächsten Morgen auf Seite Eins der Münchner Neuesten Nachrichten erschien. Es dauerte freilich noch etwas, bis das ›republikanische Gefühl‹ in allen Bereichen durchschlug. So sprach ein Aufruf an das Postpersonal noch von den »königlichen Post- und Telegraphenämter«. Doch in der Praxis wusste man durchaus, worauf es ankam. Um ein Uhr begab sich Fechenbach, die treibende Kraft hinter den militärischen Maßnahmen, ins Polizeipräsidium und ließ sich vom königlichen Polizeipräsidenten v. Beckh dessen Ergebenheit gegenüber dem Arbeiter- und Soldatenrat bestätigen.
Während der Führer der Mehrheitssozialisten Auer und sein Gewerkschaftssekretär mitternächtlich mit dem alten Innenminister Brettreich über die Lage berieten – wobei die beiden Arbeiterführer beteuerten, »die gewaltsame Umwälzung weder gewollt noch gefördert« zu haben –, legte sich der selbsternannte Ministerpräsident im Landtag erschöpft auf ein Sofa zum Schlafen. Am nächsten Morgen bot die Stadt im Wesentlichen ein Bild der Ruhe und Ordnung: rote Fahnen hie und da, patrouillierende Militärwagen, doch Post und Verkehr funktionierten normal, die Denkmäler der Wittelsbacher standen unberührt. Die neue Regierung hatte die Gaststätten aufgerufen, ihre Betriebe zu öffnen, wohl dass die Gastronomie nicht Not leide und das Volk eine Versammlungsstätte habe. Wer von den Landtagsabgeordneten am Morgen nicht die Zeitung gelesen hatte, erfuhr wohl erst von den Soldaten mit den roten Armbinden vor dem Parlamentsgebäude, dass er ›arbeitslos‹ geworden war.
»Die Bayern waren als Angehörige einer Monarchie ins Bett gegangen und als Republikaner wieder aufgewachtx, fasste ein geistreicher Feuilletonist die Ereignisse vom 7./ 8. November zusammen. Wie aber konnte es in München, noch bevor in Berlin die Republik ausgerufen wurde, zu dieser unblutigen Revolution kommen? Wer war dieser Kurt Eisner, der sich zum Anführer eines revolutionären Umsturzes gemacht hatte?
Eisner rief zum Generalstreik
Kurt Eisner, 1867 als Sohn eines jüdischen Ladenbesitzers in Berlin geboren, hatte Philosophie und Germanistik studiert und arbeitete dann als Journalist für die Frankfurter Zeitung und die Hessische Landeszeitung (Marburg). Wegen Majestätsbeleidigung erhielt er in dieser Zeit neun Monate Gefängnis. Nach seiner Hinwendung zur Sozialdemokratie wurde er Redakteur beim Berliner Vorwärts (1899-1905). Als er dort unter dem Vorwurf des Revisionismus ausscheiden musste, ging er nach München (1907), wo er bald in die politische Redaktion der sozialdemokratischen Münchner Post gerufen wurde. Obwohl er sich in der Münchner SPD durchaus einen Namen machte, gelangte Eisner nie in deren inneren Führungszirkel. Weniger, dass er Jude und Preuße war, stand ihm dabei im Weg, als dass er als ›freischwebender Intellektueller‹ zu wenig Verwurzelung in der Arbeiterschaft hatte.
Nach Ausbruch des Weltkriegs trat er als kompromissloser Kriegsgegner auf. Da dies der Parteilinie widersprach, die auf einen ›Burgfrieden‹ mit den deutschen Kriegsparteien setzte, verlor er wiederum seinen Redakteurssessel. Da die SPD jetzt »nicht weit weniger als eine Regierungspartei« war, schloss sich Eisner Ostern 1917 der neugegründete Unabhängige Sozialdemokratische Partei (USPD) an, für die er die Münchner Organisation aufbaute. Wenn die USPD auf die bayerische Politik eine Wirkung ausübte, dann die, dass sie mit ihrer ›radikalen‹ Agenda die Mehrheitssozialdemokraten zwang, in ihren Reformforderungen ebenfalls einen härteren Kurs zu fahren. Denn, wie sich im November 1918 zeigen sollte, war ein erheblicher Teil der Arbeiterschaft nicht mehr bereit, in Zeiten des Krieges und der Not den abwiegelnden Parolen von SPD und Gewerkschaft zu folgen.
Eisner, dem August Bebel einmal bescheinigte, er habe »leider nicht die nöthigen parteihistorischen und theoretischen Kenntnisse«, war kein orthodoxer Marxist. Das zeigte sich schon darin, dass er nicht so sehr im Kapitalismus denn im preußischen Junkertum (»ostelbische Hunnen«) das Hindernis sozialen und politischen Fortschritts sah. Er war auch sicher kein Revisionist im strengen Sinne der damaligen ideologischen Auseinandersetzungen. Nur geriet er als intellektueller Einzelkämpfer zwischen alle Fronten. In seinen Forderungen an die praktische Politik nahm er jedenfalls, im Gegensatz zur Mehrheit in der Sozialdemokratie, meist eine kompromisslose Haltung ein. So glaubte er zwar, dass »die Dialektik der proletarischen Bewegung« durch parlamentarische Bestätigung vorangetrieben werden könne und solle, und er lehnte »Gassenrevolutionen« als ein Mittel früherer Zeiten ab, doch war er überzeugt, dass die Herausforderung der bestehenden Gewalten zu einem »brutalen Konfliktx führen würde.
Einen vorentscheidenden Erfolg errang Eisner im Januar 1918. Trotz hinhaltendem Widerstand der SPD organisierte er einen Generalstreik gegen die Kriegszielpolitik der Reichsregierung. Er kam dabei erstmals in persönlichen Kontakt mit gewerkschaftlichen Vertrauensleuten und hatte Gelegenheit, vor Betriebsversammlungen zu sprechen. Zwar beteiligten sich am 31. Januar in München nur etwa achttausend Arbeiter an den Demonstrationen – in Berlin waren es drei Tage zuvor fast eine halbe Million gewesen –, doch Eisner hatte sich gegenüber der SPD erstmals politisch durchgesetzt. Ihr Führer Erhard Auer hatte zuletzt nicht mehr gewagt, gegen den Streik zu argumentieren.
Am Abend des Streiktags wurde Eisner in seiner Wohnung verhaftet. Der USPD-Führer musste achteinhalb Monate in Neudeck und Stadelheim einsitzen. In dieser Zeit verschärfte sich die soziale und politische Lage in Deutschland und Bayern bedrohlich. Die Kriegsverhältnisse hatten die von Reformbestrebungen und Ausgleichsbemühungen zugedeckten Gegensätze zwischen Bürger und Staat, Arbeitern und Unternehmern, Stadt und Land, Katholiken und Freisinnigen wieder aufgerissen. Die sich anbahnende Niederlage und die dramatisch verschlechterte Wirtschaftslage im Frühjahr und Sommer 1918 verdichtete im Bewusstsein großer Teile der Bevölkerung den Eindruck, das alte Regime habe versagt. Das Verdikt der Sozialisten über den monarchistischen Staat und die kapitalistische Gesellschaft wurde plötzlich glaubhaft.
Hungerdemonstrationen und Arbeitslosenversammlungen
In der Sozialpolitik hatte sich vor dem Krieg eine Kooperation zwischen Bürokratie und Arbeiterselbsthilfe angebahnt. In der Frage der Wahlrechtsreform zeigte sich der Staat zumindest gesprächsbereit. Die Koalition zwischen Zentrum und Sozialdemokratie bewies nicht nur ihre Stoßkraft gegen die restaurativen Mächte. Sie bahnte darüber hinaus die Versöhnung von Katholizismus, Freisinnigkeit und Sozialdemokratie an. Die (wenn auch zögerliche) Einbeziehung der Sozialisten in die politischen Entscheidungen nährte die Hoffnung auf einen Wandel und machte die Arbeiterschaft kompromissbereiter. Die protektionistische Handelspolitik des Reichs und Fördermaßnahmen der bayerischen Regierung brachten die Bauernschaft, nach der Landwirtschaftskrise der neunziger Jahre, wieder in bescheidenen Wohlstand.
Diese Entwicklung war jedoch bereits vor Kriegsausbruch ins Stocken geraten. Die These, dass die alte Gesellschaft mit ihren inneren Problemen nicht mehr fertig wurde und deshalb einen Ausweg im Krieg suchte, wird von Historikern vielfach vertreten. Ihre Richtigkeit sei dahingestellt. Tatsache ist, dass durch den Krieg mit seiner zerstörerischen Energie die von vielerlei Kompromissen und Goodwill-Bekundungen zusammengehaltene Gesellschaft im Reich und in Bayern gleichsam wie in einem Säurebad auf ihre antagonistischen Bestandteile hin skelettierte wurde.
Dieser Prozess begann jedoch schon früher. 1912 zerbrach die Koalition zwischen Zentrum und Sozialdemokratie, nachdem sich in der Zentrumspartei der rechte Flügel durchgesetzt hatte. Der erzkonservative Ministerpräsident Hertling behandelte die Sozialisten – wie einst Bismarck – als Staatsfeinde und machte die Hoffnungen der Arbeiterschaft auf eine Verbesserung ihrer Rechte zunichte. Dazu zeichnete sich im Herbst dieses Jahres eine wirtschaftliche Rezession ab, die zu großer Arbeitslosigkeit führte. Anfang August 1914 erreichte der Beschäftigungsstand einen bisher unbekannten Tiefpunkt.
Am 12. Januar demonstrierten an die tausendfünfhundert Arbeitslose vor dem Münchner Rathaus. Arbeitslosenversammlungen in den Bierkellern waren an der Tagesordnung. Dass die Staatsregierung nichts zur Linderung der Not der Erwerbslosen unternahm, erbitterte nicht nur die Arbeiterschaft, sondern rief auch im Bürgertum Kritik hervor. Mit Kriegsausbruch verschärfte sich dann die Lage auf dem Arbeitsmarkt noch. Als die Unternehmer versuchten, zusätzlich die Löhne zu drücken, schritt das Münchner Generalkommando immerhin mit Strafandrohung gegen sie ein.
Erst der Rüstungsboom des Krieges brachte einen Teil der Beschäftigungslosen in Arbeit; die anderen mussten ins Feld. Doch insgesamt nahmen nach dem August 1914 die wirtschaftlichen Probleme zu. Auch an der Heimatfront bekam man den Krieg zu spüren. Die Kriegswirtschaft brachte eine Einschränkung der Nahrungsmittel- und Gebrauchsgüterindustrie mit sich. Die Auswirkungen der Blockade und Missernten in den Jahren 1915 und 1916 verschärften das Problem der Lebensmittelversorgung. Da man nur auf einen kurzen Krieg eingestellt war, setzte die Planung zu spät ein. Am Tage des Kriegsausbruchs war der freie Wechsel von Geld in Gold gestoppt worden. Schleichende Inflation war die Folge, überdies angeheizt durch die Zahlungskraft derjenigen, die in der blühenden Rüstungsindustrie und ihren Zulieferbetrieben beschäftigt waren. Leidtragende waren vor allem die Kriegerfrauen, Rentner und Pensionisten.
Der alte Staat hat versagt
Die Staatsbürokratie zeigte sich allenthalben unfähig, diese Probleme zu bewältigen. Vor allem in der Nahrungsmittelbewirtschaftung brachte sie durch kleinkarierte und schikanöse Maßnahmen die Bevölkerung gegen sich auf. Die Verbraucher in den Städten reagierten mit Hungerdemonstrationen, die Bauern litten unter dem kriegsbedingte Mangel an Arbeitskräften und industriellen Hilfsgütern wie Kunstdünger und Treibstoff. Dies führte zur Halbierung der landwirtschaftlichen Produktion. Der Preisstopp trieb die Bauern zwar nicht in den Ruin, bedeutete aber in Verbindung mit dem Produktionsrückgang einen Rückschritt des bäuerlichen Wohlstandes. Das bäuerliche Sparvolumen ging spürbar zurück, und es wurden kaum mehr Kriegsanleihen gezeichnet. Die unterversorgte Stadtbevölkerung versuchte sich mit Hamsterkäufen zu retten. Das wiederum überforderte die Bauern, die sich von den hungernden Städtern wie von einer Heuschreckenplage überzogen fühlten. Angesichts des Mangels und ihrer sinkenden Einkünfte versuchten sie, sich in Selbstverbrauch und spekulative Hortung veredelter Produkte, wie etwa Schmalz, zu retten. Von den Hamsterern fühlten sie sich bedrängt und beraubt.
Die Regierung schien gegen all das machtlos zu sein. So schwand auch das Vertrauen der Bauern in die Autorität der Herrschenden. Viele von ihnen kamen, spätestens seit 1916, zur Einsicht, dass jede Verlängerung des Krieges die Unannehmlichkeiten und Leiden nur verlängern würde. Am Ende hieß es, selbst unter französischer Herrschaft könne es nicht schlimmer kommen als unter der ›preußischen‹. So stelle denn der bayerische Bauernführer Heim (Zentrum) 1916 fest: »Das Schlimmste, was eintreten kann, ist eingetreten. Die bäuerliche Bevölkerung sagt, die Behörden hätten sie angelogen, und das Vertrauen ist untergraben, die Glaubwürdigkeit der Behörden ist erschüttert.«
Es war nicht zuletzt der Beamtenschaft zu verdanken, dass die Revolution relativ reibungslos vonstatten ging. Auch hier hatte im Laufe des Krieges, im Einklang mit der vorherrschenden Stimmung, eine Entfremdung vom Arbeitgeber Staat stattgefunden. Der Beamte fasste sich in zunehmendem Maße nicht mehr ausschließlich als Vertreter der Obrigkeit auf, sondern erkannte sich – eine Folge der ›Vermassung des Beamtentums‹ – als Stand unter Ständen. Diese Einstellung führte 1917 zur Gründung des ›Bayerischen Beamten- und Lehrerbundes‹, der sich trotz seiner maßvollen Zielsetzung mit der Ablehnung des ›Ministeriums‹ (d. h. der Regierung) konfrontiert sah. Verbitterung über die Teuerung, über den Geldwertschwund und Hass auf die Kriegsgewinnler verbanden die Beamten mit der übrigen Bevölkerung. Die anfängliche Kriegsbegeisterung wandelte sich in Friedenssehnsucht.
Die Friedenssehnsucht der Bevölkerung fand jedoch in der Tagespresse zunächst keine angemessene Resonanz. Stattdessen beherrschte die sogenannte ›Kriegszielbewegung‹, die utopische Annexionspläne propagierte, die publizistische Landschaft. Doch erreichte diese ihr Mobilisierungsziel nicht. Im Gegenteil, sie verstärkte mit ihrer Agitation den allgemeinen Katzenjammer angesichts der stockenden Offensive im Westen und der sich abzeichnenden Niederlage. Jetzt erst nahm man Intellektuelle wie Eisner wahr, die immer schon gegen den Krieg waren. Am 4./ 5. Oktober 1918 ersuchte Reichskanzler Max von Baden die Alliierten um Waffenstillstand.
Ein wesentliches Element der Kriegsmüdigkeit war in Bayern die Vorstellung, dass dieser Krieg, in den man 1914 noch mit Hurra gezogen war, eine Angelegenheit Preußens sei, des alten Widersachers. Die Misserfolge der von Berlin zentral gelenkten Kriegsbewirtschaftung wurden als böser Wille ausgelegt. Wohlgenährte ›preußische‹ Urlauber – meist Kriegsgewinnler –, die für die knappen Lebensmittel jeden Preis zahlten, weckten darüber hinaus die Vorstellung, dass die Waffenbrüder nördlich des Mains einseitig vom Kriegsgeschäft profitierten. Dass sich das bayerische Ministerium, repräsentiert vom König, bis zuletzt bedingungslos zur Reichstreue bekannte – und mit ihm das Gros der ›Großkopferten‹ –, senkte in einem weiteren Punkt das Vertrauen der Bevölkerung in das alte Regime.
Das Bürgertum forderte die Reform
Je länger der Krieg dauerte, desto verzweifelter wurde die allgemeine Stimmung. Der Kohlenmangel im harten Winter 17/ 18 wurde noch schlimmer als der Lebensmittelmangel empfunden. Hunger- und Arbeitslosendemonstrationen waren seit 1916 nichts Ungewöhnliches mehr. Fronturlauber, die von der hoffnungslosen Lage an der Westfront berichteten, brachten die Kriegsbegeisterung der schweigenden Mehrheit auf Null. Nach der gescheiterten Frühjahrsoffensive von 1918 nahm die Disziplin bei den in München stationierten Truppen merkbar ab. Am Ende brachte der Zusammenbruch Österreich-Ungarns und das Gerücht einer drohenden Invasion Bayerns von Südosten mehr Unruhe in der Bevölkerung als die Nachricht vorn Kieler Matrosenaufstand.
Auch in der konservativen Presse wurde jetzt der Ruf nach einer Regierungsreform laut, wie sie bereits vor dem Krieg von liberalen Kreisen gefordert geworden war. Verhältniswahlrecht, Beschränkung der Rechte der Reichsratkammer (des Oberhauses des bayerischen Landtags) und Einführung des parlamentarischen Regierungssystems waren die Stichworte. Ohne in der Verfassungsfrage zu einem Ergebnis gekommen zu sein, wurde schließlich am 2. November 1918 die Einsetzung einer neuen Regierung beschlossen, die jedoch nie ins Amt kommen sollte. Im Grunde hatte die alte Regierung bereits im Sommer 1918 kapituliert, als sie auf die Einbringung weiterer Reformvorlagen verzichtete, solange Mehrheiten dafür nicht gewiss seien.
Später ist gesagt worden, ein paar hundert entschlossene Bewaffnete hätten dem ›revolutionären Spuk‹ ein Ende machen können. Das ist möglicherweise richtig. Nur, es gab eben nicht einen einzigen Entschlossenen, der sich für die besiegte Monarchie und die für Krieg und Niederlage mitverantwortlichen Führungsschichten in die Schanze hätte werfen wollen. Der Historiker Willy Albrecht kommt zum Schluss »Das Vertrauen fast aller Volksschichten war in die alten Herrschaftsträger so sehr geschwunden, dass sich am Abend des 7. November und auch im Laufe des 8. November keine Gruppe der Bevölkerung fand, die das alte Regierungssystem zu verteidigen bereit war. So ging die Monarchie in Bayern zugrunde, weil sie es nicht mehr vermochte, die Mehrheit des Volkes zu repräsentieren.«
Die allgegenwärtigen Leiden des Krieges – kaum eine Familie ohne Gefallenen oder Invaliden, Hunger in den Städten – trafen die Gesellschaft wie ein Schock. Vor allem das Bürgertum fühlte sich aus einem behüteten Leben schmerzhaft in die Wirklichkeit einer sozial und politisch zerrissenen Welt versetzt. Dreiundvierzig Jahre äußerer und innerer Friede hatten die Bevölkerung in einem biedermeierlichen Schlaf gewiegt. Jetzt wachte sie schmerzhaft auf. Der monarchische Staat, nach außen hin machtstrotzend, im Inneren durch keinen Gegner ernsthaft gefordert, war auf die Niederlage im Feld und die daraus erwachsenden innenpolitischen Probleme in keiner Weise vorbereitet. Der Stress des Krieges zehrte an seiner Substanz und lähmte am Ende, als auch das Bürgertum die schwarzweißrote Fahne verließ, seine Widerstandskraft.
Würde es nun der Republik, würde es den Revolutionären um Eisner und die zögerlichen Mehrheitssozialisten um Auer in der schwierigen Situation, die auf sie wartete, gelingen, die verunsicherte Bevölkerung in einem neuen Staat zu einer neuen Gesellschaft zu formieren, die den Hoffnungen und Bedürfnissen der leidenden und gedemütigten Menschen entsprach? Wir wissen, dass dem nicht so war; dass nicht nur Eisner ermordet, die folgende Räteregierung blutig gestürzt und ihre Repräsentanten verfolgt und erschlagen wurden, sondern dass – keine fünfzehn Jahre, nachdem die morsche Monarchie zerbrochen war – auch die junge Republik mehr fallend als gestoßen ins Grab sank. Wie konnte es dazu kommen?
Das Kabinett Eisner
Noch unrasiert und in verknautschten Kleidern nahm Ministerpräsident Kurt Eisner am Morgen des 8. November als erstes Kontakt mit Erhard Auer auf, dem Vorsitzenden der Mehrheitssozialisten: Er bat ihn, in eine Koalitionsregierung einzutreten. Eisner war kein Wirrkopf. Er mochte der einen oder anderen Illusion anhängen, aber er war durchaus in der Lage, Machtverhältnisse realistisch einzuschätzen. Wenn die Arbeiterschaft auch im letzten Kriegsjahr der Beschwichtigungspolitik der SPD- und Gewerkschaftsführer nur mehr zögernd gefolgt war, so durfte man doch die organisatorische Verwurzelung der traditionellen Arbeitervertretungen in der werktätigen Bevölkerung nicht einfach außer Acht lassen. Zudem stand Eisner vor dem Problem, sein Kabinett mit einigermaßen profilierten und fähigen Leuten zu besetzen.
Auer willigte ein, damit, wie er bekundete, Eisner nicht »die Anarchie über den Kopf wachse«. Gegen halb vier trat im Landtagsgebäude ein Provisorischer Nationalrat des Bayerischen Volksstaats zusammen. Eisner hielt eine Rede, in der er vorrangig der Hoffnung Ausdruck gab, dass die Übernahme der Macht in Bayern durch »eine revolutionäre Regierung, deren treibende Kräfte von Anfang an in einsamer und gefährlicher Opposition die deutsche Kriegspolitik bekämpft haben«, die Siegermächte, allen voran den amerikanischen Präsidenten Wilson, bei den Friedensverhandlungen milder stimmen würde. Des Weiteren sprach er sich dafür aus, dass »in Zeiten ruhigerer Entwicklungx eine vom Volk gewählte Nationalversammlung einberufen werde, die das endgültige Gesicht der Republik bestimmen solle; zunächst einmal solle jedoch das Volk unmittelbar durch die »elementaren Triebkräfte« der revolutionären Räte herrschen.
Das Kabinett, das Eisner anschließend vorstellte und das von der Versammlung durch Zuruf bestätigt wurde, bestand aus vier Ministern von der SPD, drei USPD-Ministern und einem Parteilosen. Eisner übernahm mit dem Amt des Ministerpräsidenten traditionellerweise auch das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten. Seine Parteifreunde Edgar Jaffe und Hans Unterleitner besetzten die Ministerien für Finanzen und für Soziale Angelegenheiten. Jaffe konnte als Professor der Nationalökonomie in seinem Ressort mit einiger Sachkenntnis aufwarten, Unterleitner war dagegen »ein einfacher Arbeiter ohne Amt und Würden« (Eisner) – schien jedoch gerade deshalb den revolutionären Kräften für sein neugeschaffenes Amt besonders geeignet.
Die machtpolitisch bedeutsamen Ressorts überließ Eisner den Mehrheitssozialisten. Erhard Auer wurde Innenminister, Johannes Timm, der sich bisher vornehmlich mit Sozialpolitik beschäftigt hatte, übernahm das Justizressort und der Zivilist Albert Roßhaupter (1945-1947 bayerischer Arbeitsminister) erhielt das Ministerium für Militärische Angelegenheiten. Johannes Hoffmann, später bayerischer Ministerpräsident, der bereits im Zusammenhang mit der geplanten Umbildung des Kabinetts v. Dandl als Minister ohne Geschäftsbereich vorgesehen war, wurde Kultusminister. Der parteiloser Heinrich Ritter v. Frauendorfer war der einzige mit Regierungserfahrung. Er wurde Verkehrsminister. Als solcher hatte er bereits dem König gedient, bis er unter dem Druck des rechten Zentrumflügels das Kabinett verlassen musste. Der Versuch, den Nationalökonomen Professor Lujo Brentano als Chef eines neuzugründenden Ministeriums für Handel, Industrie und Gewerbe zu gewinnen, scheiterte.
Am 9. November machten die königlichen Minister ihre Amtsräume für die neuen Ressortchefs frei. Tags zuvor hatte Eisner bereits mit den Ministerialbeamten Kontakt aufgenommen und sich ihrer loyalen Mitarbeit versichert, nachdem er seinerseits angeordnet hatte: »Alle bisherigen Beamten bleiben in ihren Stellungen.« Ob ein Beamtenstreik die Revolution wirklich im Keim erstickt hätte, sei dahingestellt. Eisner befürchtete dies jedenfalls, auch wenn er später bekundete, ihn hätte »das Experiment gelockt, die Arbeit zu leisten mit Leuten von der Straße (...), fähigen Köpfen, die bisher nicht ans Licht gekommen waren«. Freilich hatten einige der Beamten, die ja allesamt einen Treueid auf den gestürzten Monarchen geleistet hatten, Skrupel, ließen sich dann aber doch überreden, der Republik ihre Dienste »unter Wahrung unserer Gesinnung« zu leisten.
Ludwig III. befreite fünf Tage nach seiner Flucht die treuen Untertanen schließlich aus ihrer Verlegenheit: »Nachdem ich infolge der Ereignisse der letzten Tage nicht mehr in der Lage bin, die Regierung weiter zu führen, stelle ich allen Beamten, Offizieren und Soldaten die Weiterarbeit unter den gegebenen Verhältnissen frei und entbinde sie des mir geleisteten Treueids.« Eisner, dessen Amtszimmer immer noch ein Porträt des Wittelsbachers schmückte, deutete das als Abdankung des Königs und veröffentlichte es in diesem Sinne. Ludwig hoffte allerdings bis zu seinem Tode 1921 auf eine Wiederherstellung der Monarchie.
Kronprinz Rupprecht verwahrte sich dagegen am 10. November in einem Funkspruch aus Brüssel »gegen die politische Umwälzung, die ohne Mitwirkung des gesamten bayerischen Volkes und der gesetzgebenden Gewalten vor sich gegangen« sei, und zwei Tage später protestierte auch der Präsident des alten Landtags. Eisner wagte nicht, den Inhalt der Depesche vor dem 24. Dezember zu veröffentlichen. Dazu trug bei, dass tags zuvor das Gerücht, der Kronprinz sei mit einer Armee im Anmarsch, erhebliche Unruhe ausgelöst hatte. Rotgardisten hatten bereits Maschinengewehre zur Verteidigung Münchens in den Straßen und am Bahnhof postiert.
Erwies sich diese Meldung als Ente, so war ein anderes Gerücht, demzufolge preußische Truppen zur Niederschlagung der ›Rebellion‹ anrückten, durchaus nicht aus der Luft gegriffen. Das bestätigt Viktor Mann, ein jüngerer Bruder Thomas Manns. Er diente damals als Adjutant in einer preußischen Division, die in der bayerischen Provinz stationiert war. Auch in diesem Falle zeigten sich jedoch Mannschaften und untere Offiziersränge nicht bereit, auf Kameraden zu schießen. So unterblieb der konterrevolutionäre Einsatz. Viktor Mann selbst trug nach eigenem Bekunden dazu bei, das mögliche Blutbad zu verhindern.
Mittlerweile hatte sich die Revolution im ganzen Reich ausgebreitet. Als erstes waren Sachsen, Braunschweig und Hessen dem Beispiel Bayerns gefolgt. Tags darauf, am 9. November, nachdem der geflohene Kaiser im belgischen Spa abgedankt hatte, stürzten auch die monarchischen Regierungen in den anderen deutschen Ländern. Nachfolgend bildeten sich in den größeren bayerischen Städten ebenfalls Arbeiter- und Soldatenräte. Die Ereignisse waren irreversibel geworden, auch wenn das mancher Anhänger der Monarchie noch nicht glauben wollte. So setzte man in konservativen Kreisen große Hoffnungen auf die Rückkehr der Fronttruppen. Als jedoch das königliche Leibregiment Anfang Dezember in militärischer Disziplin und ohne politische Intention unter seinem Kommandanten Ritter v. Epp in München einzog, und dort unter Mitwirkung der neuen Regierung gefeiert wurde, musste auch dem letzten Königstreuen in München klar sein, dass die Sache gelaufen war.
Revolutionärer Taumel
Während das ›bessere‹ Bürgertum stillhielt, erlebte München einen friedlichen Taumel revolutionärer Begeisterung. Die Stadt, von wenigen Aktivisten der Revolution geführt, begann aufzuwachen. Der Historiker Karl Alexander v. Müller schreibt aus der Erinnerung:
Von Müller, der sich später als Gegner der Weimarer Republik und überzeugter Nationalsozialist hervortat, weiß auch von Plünderern zu berichten und von anarchistischen Elementen, die eine eigene Auffassung vom Wesen der Revolution hatten. Er erinnert sich an einen Rotarmisten, der ohne ersichtlichen Grund die oberen Stockwerke des Regina-Palast-Hotels am Stachus als Zielscheibe für seine Schießübungen nahm und auf die Vorhaltungen eines alarmierten Soldatenrats zurückgab: »Bal i nimma schiaßn derf, na könnts mi kreuzweis am ... mit enkera ganzn saudumma Revoluzzion !« – warf sein Gewehr weg und ging zornig davon. (»Wenn ich nicht mehr schießen darf, dann könnt Ihr mich kreuzweise am ... mit Eurer ganzen saudummen Revolution!«)
Poetisch, aber wohl treffend fasste Rainer Maria Rilke die Atmosphäre jener Tage dem Schriftsteller Burschell gegenüber in die Worte – wobei er seine Hand einige Male öffnete und schloss –: „So reif ist die Zeit, man kann sie jetzt kneten.“ Das konnte man in der Tat. Die Bevölkerung erwartete nach den bitteren Kriegsjahren voll Hoffnung die Maßnahmen der neuen Regierung. Nachdem der „alte Plunder hinweggefegt“ war (Eisner), schien wieder alles möglich. Friedrich Burschell erinnert sich:
Am 17. November feierte man im Nationaltheater (ehemals „Hoftheater“) mit Beethoven, Händel, Goethe und einem Gedicht von Eisner in aller Form die Revolution:
Zwei Tage darauf fand eine Wiederholung der Feier für verwundete und kranke Soldaten statt, später gab es eine weitere Vorstellung für Münchner Gymnasialschüler und Studenten. Hier erntete Eisner Pfiffe. Die Gegner der Republik zeigten erstmals Flagge: die Sprösslinge der ›höheren Stände‹. Allzu viele von ihnen sollten später zu Enthusiasten und Vollzugsgehilfen des Nationalsozialismus werden.
Das Regierungsprogramm
Mit Feierlichkeiten und revolutionärem Pathos allein war jedoch kein Staat zu machen. Am 15. November veröffentlichte Eisner sein „Programm der Bayerischen Republik“, das auch von bürgerlichen Zeitungen gelobt wurde. Die Münchner Neuesten Nachrichten kommentierten:
Das vorgelegte Programm enthielt freilich auch kaum sozial- oder ordnungspolitischen Zündstoff. Es drückte eher Hoffnungen aus, als dass es auf die Tagesprobleme eingegangen wäre. Kernpunkte waren die Bitte an die Siegermächte um einen gnädigen Frieden und die Forderung nach einer »tätigen Demokratisierung des ganzen Volkes« mit dem Ziel wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Reformen. An praktischen Maßnahmen wurden unter anderem gerechte Lebensmittelverteilung, Sozialfürsorge, Verwaltungsvereinfachung, Förderung der Produktion, Neuordnung des Finanzwesens, Umgestaltung des Straf- und Zivilrechts nach sozialen Grundsätzen und Demokratisierung der Armee anvisiert.
Auf die Grundforderung sozialistischer Politik, die Sozialisierung, verzichtete man von vorneherein: »Wir können keinen Trümmerhaufen sozialisieren«, verkündete Eisner. »Die sozialistische Gesellschaft kann nicht Bayern allein einführen, nicht Deutschland, das kann nur weltwirtschaftlich geschehen.« Eisner konnte sich hierbei auf Marx berufen, demzufolge der Übergang zum Sozialismus den Höhepunkt der kapitalistischen Entwicklung darstelle, nicht aber durch gewaltsame Einflussnahme im Augenblick eines militärischen Zusammenbruchs erfolgen könne. »Man kann politische Gewalten stürzen, man kann aber keine wirtschaftliche Organisation durch Revolution aufbauen«, erklärte Eisner am 30. Dezember vor Rätedelegierten.
Die Räte
Ein Programmpunkt der Regierungserklärung, der zum Thema ständiger Auseinandersetzungen werden sollte, war in der Forderung nach ›tätiger Demokratisierung‹ verklausuliert: Es ging um die Frage, inwieweit das Rätewesen neben der zu wählenden Nationalversammlung Bestand haben konnte und für wann der Wahltermin anzusetzen sei.
Das Rätewesen, das sich einerseits aus der Idee unmittelbarer Volksherrschaft durch das imperative Mandat, andererseits aus der syndikalistisch-ständischen Konzeption einer nach Berufsgruppen und Betrieben gegliederten Volksvertretung nährt, wurde und wird vielfach mit „Bolschewismus“ gleichgesetzt. Das hängt natürlich mit dem historischen Vorbild der von den Bolschewiki in Russland installierten „Sowjetrepubliken“ zusammen, ist aber insofern nicht gerechtfertigt, als die Bolschewiki das Rätesystem nach kurzer Zeit zugunsten der (zentralistischen) „Diktatur des Proletariats“ (in Wirklichkeit nur einer Partei) liquidierten. Die eigentliche Crux des Rätewesens besteht darin, dass niemand wusste und weiß, ob es funktioniert. Das ist kein Vorwurf, denn auch die parlamentarische Demokratie bedurfte einer Zeit des Experimentierens und Erprobens. Die erstreckte sich allerdings über Jahrhunderte. Die Räterepublik war dagegen eine – durchaus verführerische – junge Idee aus dem späteren 19.Jahrhundert, die nie wirklich auf die Probe gestellt wurde.
Gegen Ende November gab es in fast jeder bayerischen Gemeinde irgendeine Art von Räteorganisation. Diese Räte (Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte) waren von Ort zu Ort sehr unterschiedlich zusammengesetzt und repräsentierten durchweg ein breites Spektrum politischer Ansichten. In der Regel waren jedoch nicht die ›Massen‹ in ihnen vertreten, sondern die Parteien. Arbeiterräte bestanden deshalb auch nicht unbedingt nur aus Arbeitern. Kaufleute- und Bürgerräte waren nämlich nicht vorgesehen, und irgendwie sollten diese Gesellschaftsgruppen die Zukunft doch auch mitgestalten können. Ganz abgesehen von den ›Kultur- und Geistesschaffenden‹: Um wenigstens diese Lücke zu schließen, gründete der Freiwirtschaftler (und Rätegegner) Lujo Brentano einen ›Rat geistiger Arbeiter‹, der jedoch weitgehend wirkungslos blieb. Seine Mitglieder wurden nach Vorschlag des Ökonomieprofessors ausgewählt. Doch die Legitimierung der etablierten Räte war oft ähnlich problematisch und formlos.
Die Soldatenräte setzten sich auf unterer Ebene pro Standort aus zehn Soldaten zusammen (Kasernenräte), die aus ihrer Mitte wiederum einen Garnisonsrat auf Divisionsebene entsandten. Politische Autorität hatte aber eigentlich nur der in der Revolutionsnacht willkürlich gebildete Soldatenrat in Zusammenarbeit mit dem Militärministerium. Arbeiterräte bildeten sich in den Landgemeinden auf Verwaltungsebene aus Parteivertretern und gerieten auf diese Weise hie und da mit der eingesessenen Bürokratie in Konflikt, die sie entweder verdrängten oder personell aufblähten. In München mobilisierte der Revolutionäre Arbeiterrat (RAR), hervorgegangen aus dem am 7. November im Mathäserbräu konstituierten Arbeiterrat, die örtlichen Betriebsräte, die in Kürze einen Münchner Arbeiterrat (MAR) aus der Taufe hoben, in dem der RAR nur mehr ein Zwölftel der Mitglieder stellte.
Die Organisation der Bauernräte betrieb zunächst ausschließlich der Bayerische Bauernbund (BBB), der jedoch nur eine Minderheit der Bauernschaft repräsentierte, weshalb die Bauernräte anfangs den Charakter örtlicher Parteizellen des BBB hatten. Vereinzelt initiierten auch Arbeiter ›Arbeiter- und Bauernräte‹. Um dem entgegenzuwirken, hoben schließlich auch der zentrumsnahe Bauernverein und der ebenfalls konservative Landwirtebund Bauernräte aus, oft in Konkurrenz zu bereits bestehenden Räten. Die örtlichen Räte standen untereinander kaum in Verbindung und verfochten deshalb auch keine gemeinsame Linie. Der in München residierende Zentralbauernrat hatte mit diesen ländlichen Zellen organisatorisch nichts zu tun, er war eine mehr oder weniger willkürliche Gründung des Bauernbundführers Karl Gandorfer. Die Landbevölkerung zeigte sich ihm gegenüber in ihrer Mehrheit politisch gleichgültig.
In der Praxis waren all diese Räte am Ende nichts anderes als Interessenvertretungen. Dass die Praxis so aussah, dafür sorgten die Gegner des Rätewesens, allen voran die Mehrheitssozialisten. Die Räte waren, das zeigt ihre spontane und nahezu gleichzeitige Entstehung in allen größeren Städten Bayerns, die Organe der Revolution. Doch bereits in der Revolutionsnacht hatte Eisner als Vorsitzender des Arbeiter- und Soldatenrats allgemeine Wahlen versprochen, Wahlen zu einer Nationalversammlung, wie er am nächsten Tag präzisierte. Die Räte dachte er sich in einer langfristiger Perspektive als eine Art Zweite Kammer. Zunächst sollten sie als Vertretung der fortschrittlichen Kräfte des Volkes mit revolutionärem Schwung Zeichen für eine bessere und gerechtere Gesellschaft setzen und die Bevölkerung mobilisieren. Kurz, sie sollten verfassungspolitisch vollendete Tatsachen schaffen, die ein Parlament nicht mehr ohne weiteres rückgängig machen konnte. Im Übrigen war ihnen aber auch eine Ordnungsfunktion zugedacht: die Kanalisierung ungezügelter und möglicherweise zerstörerischer Aktivitäten ›anarchistischer Elemente‹.
Die Mehrheitssozialisten, an ihrer Spitze Innenminister Auer, hintertrieben indes jede Bestrebung, den Räten auf Dauer ein politisches Mandat zu verschaffen. Eisner konnte sich nicht dagegen durchsetzen. Indem er sich mit Leidenschaft dem Außenressort widmete, überließ er das innenpolitische Feld mehr oder minder kampflos den Kollegen von der SPD. Und Auer, als Parteifunktionär mit Verwaltungsprinzipien wohlvertraut, nutzte diese Situation. Während sich Eisner mit persönlichen Kontakten zu Rätevertretern und Auftritten vor Räteversammlungen begnügte, setzte Auer in mehr als sechshundert Mitteilungen an Regierungsbehörden und revolutionäre Räte in ganz Bayern durch, was sich schließlich in der Formel niederschlug: »Den Soldaten-, Arbeiter- und Bauernräten steht keinerlei Vollzugsgewalt zu. Sie haben daher jeden Eingriff in die staatliche und gemeindliche Verwaltungstätigkeit zu vermeiden.« Die damit regelmäßig verbundene Versicherung, dass die Räte »die Grundlage des neuen Regierungssystems« darstellten, war das Papier nicht wert, auf dem sie stand.
Kampf für den Parlamentarismus
Entsprechend bestand der häufigste Vorwurf gegen das Rätewesen in ›Übergriffen‹ von Räteorganen. Nun kam es zweifellos vor, dass Arbeiterräte Beamte zum Rücktritt zwangen und versuchten, die Gemeindepolitik zu bestimmen, dass Soldatenräte Offiziere aus Kommandostellen entfernten oder sich die Verfügung über die Nahrungsmittelversorgung und Wohnungsbewirtschaftung aneigneten. Der amerikanische Historiker Allan Mitchell bemerkt dazu in seiner Dissertation (1965):
Immerhin ordneten sich bis etwa Mitte Januar fast alle Räte dem Innen- oder Militärministerium unmittelbar oder mittelbar unter, die im Fall von ›Übergriffen‹ Schiedsrichterrolle übernahmen – in der Regel zugunsten der Behörden.
Der Kampf gegen das Rätewesen wurde als Kampf für den Parlamentarismus geführt. Eisner, der beide Demokratieideen verbinden wollte, sah sich somit in einer unhaltbaren Position. Seine Strategie, die Einberufung einer Nationalversammlung feierlich zu befürworten und den Wahltermin solange als möglich hinauszuschieben, war für ihn freilich ohne Alternative. Jenseits seines Ideals einer Demokratie, in der sich Parlament und Räte harmonisch ergänzen sollten, bestimmten sicher auch machtpolitische Motive sein Handeln. Denn selbst wenn er seine Anhängerschaft in der Bevölkerung überschätzte, war ihm wohl klar, dass die USPD in allgemeinen Wahlen kaum die nötigen Sitze erlangen würden, um den Ministerpräsidenten zu stellen. Er selbst konnte allenfalls mit einer Rolle als Räteführer rechnen.
Eisners Gegner in der Regierung ließen sich freilich auf dieses Spiel nicht ein. Die Mehrheitssozialisten um Auer durften mit einer Stimmenzahl rechnen, die zur Regierungsbildung reichen würde. Sie drängten deshalb auf einen baldigen Wahltermin und wurden darin von den bürgerlichen Kräften aus ähnlichen Gründen nachdrücklich unterstützt. Der Verband des bayerischen Verkehrspersonals drohte dabei mit Streik, und die SPD-Minister Auer, Timm und Frauendorfer mit ihrem Rücktritt.
Auch im Landessoldatenrat zeichnete sich eine Mehrheit für das parlamentarische System ab. Am 4. Dezember demonstrierte ein Pionierbataillon mit schwarzrotgoldenen und weißblauen Fahnen und schmetternder Militärmusik vor Eisners Regierungssitz für die Einberufung einer Nationalversammlung. Die Matrosenwache vor dem Palais Montgelas hatte bereits Maschinengewehre gegen die Kameraden aufgefahren, als Eisner sich den Manifestanten stellte und sie beruhigte. Am darauffolgenden Tag fasste das Kabinett gegen Eisners Widerstand den Beschluss, die Wahl am 12. Januar abzuhalten.
Eisner hatte für einen späteren Termin plädiert und vor einer zweiten Revolution gewarnt, falls der Eindruck entstehen sollte, »das Ministerium regiere gegen die Räte«. Doch er stand allein. Besonders hart attackiert von Timm und Frauendorfer, erhielt er von seinen Parteifreunden Unterleitner und Jaffe kaum Unterstützung. Selbst Eisners Gesandter in der Schweiz, Professor Friedrich Wilhelm Foerster – ansonsten eine Stütze seiner Außenpolitik – warnte in der Münchner Post, dass nur eine durch allgemeine Wahlen legitimierte Regierung auf Gehör bei den Entente-Mächten rechnen könne. Am verbindlichsten von den SPD-Ministern gab sich noch Hoffmann, Eisners späterer Nachfolger, der ihn vor dem Vorwurf in Schutz nahm, »anarchistische und bolschewistische Methoden« anzuwenden.
Drohung mit der Trennung Bayerns vom Reich
Konnte Eisner mit seinen verfassungspolitischen Vorstellungen nicht durchdringen, so erhoffte er sich den Lorbeer auf außenpolitischem Feld. Sein Hauptanliegen war, für Deutschland einen gnädigen Frieden zu erlangen. Er glaubte, dass dabei die Stimme eines überzeugten Kriegsgegners (der er von Anfang an gewesen war) bei den Alliierten eher Gehör finden würde als die von ›kompromittierten‹ Sozialdemokraten und Liberalen wie David, Scheidemann, Solf und Erzberger. Mit einem Schuldeingeständnis hoffte er, die Siegermächte geneigter zu machen. Vor allem Frankreich wollte er sich damit antragen.
Es bedurfte eines weiteren Weltkriegs, bis diese Vision Wirklichkeit wurde. Allerdings hatte es Adenauer auch mit einem anderen Frankreich zu tun, dem Frankreich De Gaulles. Das Frankreich Clemenceaus hatte für ›Seelenverständigung‹ nichts übrig; es wollte, nach dem verlustreichen Sieg über den Erbfeind, Triumph und Rache.
»An die Regierungen und Völker Amerikas, Frankreichs, Englands und Italiens! An das Proletariat aller Länder«, hatte Ministerpräsident Eisner am 10. November, nach Bekanntwerden der unerwartet harten Waffenstillstandsbestimmungen appelliert, »die revolutionäre Schöpfung der deutschen Demokratie« nicht »durch die Schonungslosigkeit der Sieger« zu vernichten; die neue Republik werde, wenn diese entsetzlichen Bedingungen unabänderlich sein sollten, in kurzer Zeit Wüste und Chaos sein.
Knapp vierzehn Tage später, am Morgen des 23. November, reiste Eisner nach Berlin zu einer Konferenz der deutschen Bundesstaaten, unter dem Arm Papiere, welche die deutsche Kriegsschuld belegen sollten. Vier von ihnen wurden noch am selben Tag in gekürzter Form veröffentlicht – gefälscht, wie Eisners Gegner aus dem bürgerlichen Lager reklamierten. In Wirklichkeit sind diese Dokumente aus den königlich-bayerischen Akten echt. Sie besagen, dass Deutschland der österreichischen Konfrontationspolitik nach Sarajewo in einer Weise Spielraum gelassen hat, die man angesichts der deutschen Bündnisverpflichtungen zumindest fahrlässig nennen muss.
Die Kürzungen, die Eisner »aus Platzgründen« vorgenommen hatte, waren unerheblich. Doch darauf kam es gar nicht an: »Eisners wirklicher Verstoß bestand nicht in den Methoden seines Vorgehens, sondern darin, dass er überhaupt vorging«, urteilt Allan Mitchell. Das heißt: Die Veröffentlichung wurde zum politischen Skandal. Als die Konferenz am 25. November begann, stieß Eisner nur auf Ablehnung. Keine seiner Forderungen und Vorschläge gelangten zur Abstimmung. Eisner griff daraufhin die Sozialdemokraten, denen er die Unterstützung der wilhelminischen Kriegspolitik vorhielt, aufs schärfste an und drohte mit der Loslösung Bayerns vom Reich. Wieder in München wies er sein Ministerium an, die Beziehung zum Berliner Außenamt abzubrechen.
Stattdessen suchte er in Süddeutschland nach Verbündeten. Tatsächlich kam es Ende Dezember zu einer süddeutschen Länderkonferenz von Württemberg, Baden, Bayern und Hessen. Eisners Vorschlag, das Reich von Süden her neu zu konstituieren, fand jedoch keinen Anklang. Man zeigte sich in den anderen süddeutschen Regierungen nur zu einer Initiative gegen das unitaristische Verfassungskonzept von Hugo Preuß, dem Vater der Weimarer Verfassung, bereit.
Eisner, der Vereinigte Staaten von Deutschland unter Einbeziehung Österreichs anstrebte, in denen der Einfluss Preußens zurückgedrängt sein sollte, war sicher kein Separatist. Er drohte lediglich mit der Loslösung vom Reich, dessen Außenpolitik er gerne selbst bestimmt hätte. Freilich wusste er auch, dass solche Töne im preußenkritischen Bayern Anklang fanden. Andererseits machte er sich damit das deutschnational gesinnte Bürgertum, das es in Bayern auch gab, zum unversöhnlichen Feind.
Sozialistischer Hader
Über der Rätefrage und der Kriegsschulddiskussion taten sich im Kabinett Eisner tiefe Risse auf. Nicht nur die bürgerlichen Zeitungen, auch die sozialdemokratische Presse, etwa die Münchner Post (Eisner: »Münchner Pest«), kritisierten Eisners Politik und Amtsführung in zunehmendem Maße – nicht zuletzt, weil Eisner die mehrheitssozialistischen Führer in Berlin außenpolitisch so schonungslos attackiert hatte. Doch auch in der innenpolitischen Bündnisfrage gingen die Wege auseinander. Während Eisner auf den Druck der Straße und die Mobilisierung der Bevölkerung setzte, lehnten sich Auer und seine Vertrauten immer enger an das bürgerliche Lager, ja an reaktionäre Kräfte an, wie etwa an Ritter v. Epp, Chef des ehemaligen königlichen Leibregiments und später Reichsstatthalter Hitlers in Bayern. Der Appell an die ›Sozialistische Einheitsfront‹ blieb angesichts dieser unvereinbaren Strategien bloßes Gerede.
Die Rücksichtnahme auf die Bündnispartner SPD und Bauernbund (BBB) einerseits und die liberalen und konservativen Kräfte in der Verwaltung andererseits schränkte die politische Bewegungsfreiheit Eisners erheblich ein. Darüber hinaus versäumte er, aktiv Einfluss auf die Bürokratie zu nehmen, die Regierung energisch zu führen und seinen publizistischen Gegnern Paroli zu bieten. In Verwaltungsdingen unerfahren, betrieb er, der geschickt mit dem Wort umzugehen verstand, Politik im Wesentlichen in Form öffentlicher Auftritte, Appelle und Proklamationen.
Er ließ zu, dass Minister Entscheidungen fällten, die vom Gesamtministerium nicht gedeckt waren, und dass Minister gegen ihn intrigierten und ihn desavouierten. Er trat nicht nur aktiv und engagiert für die Freiheit der Presse ein, die ihn bekämpfte und verleumdete – er verzichtete auch auf presserechtliche Gegenmaßnahmen und versäumte Öffentlichkeitsarbeit im eigenen Interesse. Was ihn trug, war die Hoffnung, »all die widerstreitenden Elemente im politischen Leben Bayerns mit friedlichen Mitteln, durch vernünftiges Zureden tatsächlich miteinander versöhnen zu können« (Allan Mitchell). Das war jedoch nicht möglich.
Von Bürgerlichen und Mehrheitssozialisten offen oder intern bekämpft, verlor er das Vertrauen auch jener Kräfte, die ihn an die Spitze des neuen Staates getragen hatten. Die revolutionären Aktivisten sahen sich in ihren Hoffnungen enttäuscht. Eisners Warnungen vor einer zweiten Revolution war denn auch durchaus ernst zu nehmen. Diese würde seiner Meinung nach eine ›bolschewistische‹ sein, und er lehnte das russische Modell vehement ab. So beobachtete er auch mit Sorge die Radikalisierung des linken USPD-Flügels in Berlin. »Mit Spartakus-Leuten kann es keine Gemeinschaft geben«, erklärte er.
Tatsächlich ließen jetzt radikale Aktionen auch in München nicht mehr auf sich warten. Sie richteten sich gegen die bürgerliche Presse und gegen Innenminister Auer. Am Abend des 6. Dezember drangen anarchistische und kommunistische Gruppen in die Geschäftshäuser führender Tageszeitungen ein, die von den ›Schutztruppen‹ nicht verteidigt wurden, stellten die Redaktionen unter Kuratel und erklärten die Druckereiarbeiter zu Verlagsteilhabern. (›Anarchistisch‹ ist hier und im Folgenden im Sinne einer revolutionären politischen Richtung zu verstehen, die für unmittelbare Volksherrschaft eintritt und damit in Gegensatz zum bolschewistischen Zentralismus steht.)
Gleichzeitig holten etwa dreihundert Bewaffnete SPD-Führer Auer aus dem Bett und erzwangen seine Rücktrittserklärung. Von der Polizei alarmiert erschien Ministerpräsident Eisner in den Redaktionsbüros und überredete die Besetzer zum Abzug. Die im Christlichen Gewerkschaftsbund organisierten Drucker zeigten sich freilich, wie Eisners Sekretär Fechenbach zu berichten weiß, enttäuscht: »Aha, Herr Ministerpräsident, wos is'n nacha mit da Sozialisierung?« fragte einer der Buchdrucker vorwurfsvoll. Anschließend eilte Eisner in Auers Wohnung, um den erzwungenen Rücktritt seines schwer erschütterten Innenministers rückgängig zu machen. Um vier Uhr morgens war der ganze Spuk vorbei. Eisners Autorität hatte auf der radikalen Linken noch einmal seine Wirkung gezeigt.
Die Radikalen
Doch sollte sich das ändern. Zelle radikaler Optionen war der Revolutionäre Arbeiterrat (RAR), in dem Theoretiker des politischen Anarchismus wie der Schriftsteller Erich Mühsam und der Journalist Gustav Landauer mitwirkten. Erich Mühsam, maßgeblich an der Besetzungsaktion in den Pressehäusern beteiligt, hatte Ende November eine Vereinigung revolutionärer Internationalisten (VRI) gegründet. Am 11. Dezember hoben Hans Kain, ein bayerischer Radikaler, und der aus Berlin angereiste Moskauer Student Max Levien die Münchner Ortsgruppe des Spartakus-Bundes aus der Taufe, der sich seit dem 1. Januar 1919 ›Kommunistische Partei Deutschlands‹ nannte. Beide arbeiteten eng zusammen.
Der Erfolg dieser Gruppierungen unter der Arbeiterschaft ist vor dem Hintergrund der sich seit dem Waffenstillstand weiter verschlechternden Wirtschaftslage zu sehen. Zum Nahrungs- und Heizmittelmangel, der weitere Preissteigerungen nach sich zog, kam die bedrohlich zunehmende Arbeitslosigkeit. Trotz der schweren Verluste der bayerischen Truppen im Felde war die Münchner Bevölkerung während des Krieges insgesamt stetig gewachsen. Nun strapazierten die heimkehrenden Frontsoldaten, von denen viele in der Hauptstadt hängen blieben, zusätzlich den Wohnungs- und Arbeitsmarkt.
Am 24. November hatte das Kabinett Eisner ein Erwerbslosenfürsorgeprogramm beschlossen, das erstmals Arbeitslosenunterstützung vorsah. Die Auszahlungen zu Lasten der Gemeindekassen brachten die Gemeinden indes an den Rand des finanziellen Ruins. Die Lage war insgesamt so trostlos, dass der Nationalökonom Lujo Brentano später zugab, selbst eine starke Regierung hätte mit ihr nicht »in absehbarer Zeit« fertig werden können.
Weihnachten verlief friedlich. Mittlerweile wehte wieder die weißblaue statt der roten Fahne über der Residenz. Die Menschen drängten sich am Weihnachtstag in den Münchner Straßen wie vor dem Krieg. Angesichts der gelben Anschläge mit Nachrichten von hunderten Toten bei Straßenkämpfen in Berlin erschien das fröhliche Treiben unwirklich. Die angespannte Volksstimmung entlud sich – wie andernorts auch – in einer Tanzwut, die aktenkundig wurde; die Regierung beriet darüber. Ahnte man, was kommen würde? SPD-Minister Auer zumindest zog vor, den Weihnachtsabend in der Türkenkaserne beim Ritter Epp zu verbringen, aus Angst vor einem neuerlichen Anschlag. Augenzeugen berichten von einer befremdlichen, weinseligen Verbrüderungsszene zwischen dem Arbeiterführer und den adeligen Offizieren.
Am Ende des Jahres kam es dann auch in München zu ernstlichen Unruhen. Anlass war die geplante Bürgerwehr, deren Einrichtung in ungeklärtem Zusammenwirken von sozialdemokratischen Ministern und einem erzkonservativen Reserveleutnant betrieben wurde. Die Idee einer Bürgerwehr zur Verteidigung revolutionärer Errungenschaften hatte an sich seit der Märzrevolution 1848 keinen schlechten Ruf. Der Erfolg des ›Eisner-Putsches‹ ist unter anderem der Unzulänglichkeit und Unzuverlässigkeit der königlichen Sicherheitskräfte zuzuschreiben. Die Eisner-Regierung konnte sich indes auf die Loyalität der Staatsdiener in Uniform auch nicht verlassen. Das galt sowohl in Hinsicht auf eine Konterrevolution wie auf eine zweite, bolschewistische Revolution.
Unter dem Eindruck der Berliner Straßenkämpfe dachten sich die Minister Timm und Auer wohl nichts Böses bei ihrem Plan, eine regierungstreue Miliz auszuheben. Gleichzeitig versammelte indes ein gewisser Dr. Rudolf Buttmann, demissionierter Offizier, Leute um sich, deren Absichten weniger lauter waren. Er gab später zu, dass sie »alle entschlossen waren, die Gegenrevolution durchzuführen«. Wie herauskam, ging er mit seinem Plan für eine Kampftruppe gegen die Soldatenräte sogar hausieren – im Polizeipräsidium, in der Ortskommandantur, im Militärministerium und sogar bei den Gewerkschaften. Er fand dort allerdings keine Unterstützung – wohl nicht zuletzt, weil er aus seinen wahren Absichten keinen Hehl machte. »Euch Gegenrevolutionäre müsste man alle an die Wand stellen«, beschied ihn Stadtkommandant Oskar Dürr, ein ehemaliger Gewerkschaftssekretär.
Blutige Unruhen
Auer und Timm sahen das offensichtlich anders. Ihr Aufruf vom 27. Dezember zur Bildung einer Bürgerwehr, welche »die bestehende Staatsform gegen jeden Angriff verteidigen« sollte, war weder vom Gesamtkabinett legitimiert, noch hatten sie sich mit dem Stadtkommandanten und der Polizei abgesprochen. Auch die Gewerkschaften wussten nichts von diesen angeblichen »Gewerkschaftstruppen« (Timm). Stattdessen war der Aufruf von einer Reihe prominenter Konservativer des öffentlichen Lebens mitunterzeichnet.
Militärminister Roßhaupters Warnung vor einer negativen Reaktion der Soldatenräte kam zu spät. Diese protestierten umgehend, drohten mit Befehlsverweigerung und Bürgerkrieg. Zum Skandal wuchs sich das Unternehmen aus, als tags darauf im Nobelhotel Vier Jahreszeiten zwanzig Mitglieder der Buttmann-Gruppe von der Münchner Militärpolizei verhaftet und unter Anklage gegenrevolutionärer Umtriebe gestellt wurden: Dabei wurden Verbindungen der Verschwörer zur SPD-Spitze bekannt. Auer sah sich flugs von seinen Parteifreunden verlassen. In der Kabinettsitzung tags darauf beteuerte er, Opfer eines Komplotts geworden zu sein. Er und Timm mussten ihre Unterschrift vom Aufruf zurückziehen.
Als der SPD-Führer danach im Provisorischen Nationalrat heftig angegriffen wurde, verteidigte Eisner die lauteren Motive seines Innenministers und rief zur Einheit unter den Sozialisten auf. Die Kabinettskrise schien bereinigt, doch von nun an sollte München nicht mehr zur Ruhe kommen. Der Wahlkampf, seit dem 5. Dezember im Gange, erhitzte die Gemüter. Nach Weihnachten fanden bis zu zwanzig politische Veranstaltungen pro Abend statt. Am 30. Dezember hatten Redner auf einer Massenveranstaltung die Bewaffnung des Proletariats gefordert. In der Silvesternacht randalierten Banden betrunkener Soldaten in den Straßen und schossen wild in der Gegend herum.
Eine Woche später, am 7. Januar 1919, demonstrierten auf der Theresienwiese an die viertausend Arbeitslose für höhere Unterstützungssätze. Obwohl Sozialminister Unterleitner ihre Forderungen umgehend anerkannte, kam es zu einem Straßenaufruhr. Polizei und Militär konnten nicht verhindern, dass das Sozialministerium gestürmt wurde. Es gab drei Tote und acht Verletzte. Stadtkommandant Dürr dazu: »Es handelt sich nicht um reine Demonstration, sondern um reine Putschversuche. Wir können keine Gewähr mehr bieten für die Sicherheit der Stadt. Die Polizei reicht nicht mehr aus (...), die Truppen machen nicht mehr mit, wenn sie noch länger in solcher Spannung bleiben müssen.«
Unter der Rücktrittsdrohung von Stadtkommandant und Polizeichef beschloss das Kabinett daraufhin am Morgen des 10. Januar die Verhaftung mutmaßlicher Rädelsführer wie Erich Mühsam, Max Levien und acht anderer aus KP und RAR. Als daraufhin eine bewaffnete Menschenmenge vor dem Regierungssitz die Freilassung der Inhaftierten forderte und dabei eine drohende Haltung einnahm, weigerte sich Eisner zuerst, die Sprecher der Manifestanten zu empfangen. Ein Matrose namens Egelhofer, später Oberkommandierender der ›Roten Armee‹ in München, erzwang sich jedoch Zutritt, indem er an der Fassade emporkletterte und durchs Fenster in Eisners Arbeitszimmer drang. Eisner, der »keinen Mord vor seinem Ministerium« wollte, verzichtete schließlich auf den Einsatz seiner Schutztruppe und wich dem Druck der Aufrührer. Die Inhaftierten kamen wieder frei. Die Kommunisten hatten erstmals in München einen Straßensieg errungen.
Die Bayernwahl
Der Wahlsonntag verlief ruhig. Stadtkommandant und Polizeichef hatten jegliche Demonstration untersagt und sofortigen Waffengebrauch angekündigt. Fast dreieinhalb Millionen Bayern gingen am 12. Januar zur Wahl, das waren dreimal so viel wie 1912. Ein neues Wahlgesetz hatte das Frauenstimmrecht eingeführt und das aktive Wahlalter von 26 auf 21 Jahre herabgesetzt.
Sieben größere Parteien standen zur Wahl, einige davon das erste Mal. Im Laufe des November und Dezember war es zu einer Umgruppierung innerhalb der politischen Landschaft gekommen. Im linken Spektrum fanden sich neben den Mehrheitssozialisten (SPD) die Unabhängigen Sozialdemokraten (USPD) und die Kommunisten (KPD). Das bürgerliche Lager wurde von den liberalen Deutschen Demokraten (DDP), der Bayerische Volkspartei (BVP), dem Bauernbund (BBB), der Nationalliberalen Landespartei (NLP) und der Bayerischen Mittelpartei (BMP) gebildet. Dabei beteiligten sich die Kommunisten, in Ablehnung der ›formalen Demokratie‹ des parlamentarischen Systems, nicht an der Wahl.
Die Einführung des (lange geforderten) Verhältniswahlrechts brachte das erwartete Ergebnis: BVP und SPD lagen mit 35 Prozent bzw. 33 Prozent der Stimmen an der Spitze, gefolgt von den Liberalen mit 14 Prozent und dem Bauernbund mit 9,1 Prozent. Die USPD rangierte abgeschlagen mit 2,5 Prozent (in München 7,6 Prozent). Eisner errang einen persönlichen Achtungserfolg, seine beiden Parteifreunde im Kabinett, Unterleitner und Jaffe, und die auf das Rätemodell festgelegten Landauer und Toller schnitten dagegen blamabel ab.
Bereits vor der Wahl hatte sich ein sozialliberales Bündnis abgezeichnet, dem sich möglicherweise der BBB anschließen würde. Eisners ›Unabhängige‹ waren nach den vorangegangenen Auseinandersetzungen mit den Mehrheitssozialisten als Koalitionspartner kaum mehr gefragt. Die Volkspartei (BVP) als stärkste Gruppierung würde mit NLP/ BMP (als Listenverbindung 5,8 Prozent) keine Regierung bilden können.
Die Wahlen schufen jedoch noch keine neue Regierung, und der Termin für das Zusammentreten des neuen Landtags war noch ungewiss. Artikel 17 des sogenannten ›Staatsgrundgesetzes der Republik Bayern‹ vom 4. Januar sah vor, dass die revolutionäre Regierung bis zur »endgültigen Erledigung des Verfassungsentwurfs (...) die gesetzgebende und vollziehende Gewalt« ausübt. Damit konnte die Regierung Eisner auf ein weiteres im Amt bleiben, doch war klar, dass von ihr keine grundlegenden Initiativen mehr ausgehen würden. Alle Entscheidungen konnten nur mehr mit Rücksicht auf die Mehrheitsverhältnisse im künftigen Parlament gefällt werden, und denen entsprach die Zusammensetzung des Kabinetts nicht mehr. Die Regierung, durch ständigen Kompromisszwang ohnehin verschlissen, war also zusätzlich gelähmt. »Der Rücktritt Eisners ist deshalb eine politische Notwendigkeit«, konstatierte die Münchner Post.
»Alle Macht den Räten!«
Eisner, der für die Unhaltbarkeit seiner Position nicht blind war, aber gleichwohl, im Glauben an seine Mission als Vaterlandsversöhner, am Ministerpräsidentensessel festhielt, reiste Anfang Februar zum internationalen Sozialistentreffen nach Bern, wo er noch einmal seiner außenpolitischen Leidenschaft nachging. Aus der Schweiz zurückgekehrt, musste er erfahren, dass SPD-Minister Auer das Zusammentreten des Landtags auf den 21. Februar 1919 festgesetzt hatte. Auch ein neuerlicher Aufruf zur Bildung einer republikanischen Volkswehr war beschlossene Sache. Eisner blieb nichts übrig, als sich vor den ausführenden Militärminister Roßhaupter zu stellen.
In der Volkswehrfrage waren sich die SPD-Minister diesmal einig. Kommunisten und Anarchisten betrieben jetzt offen – unter der Parole ›Alle Macht den Räten!‹ – eine zweite Revolution und fanden dabei erhebliche Unterstützung in der Bevölkerung. Bereits im Januar war es KP-Chef Levien und Anarchistenführer Mühsam gelungen, den Münchner Arbeiterrat (MAR) zur Annahme einer Entschließung zu bewegen, die auf die Forderung hinauslief, die Räte in Organe der Regierungskontrolle (›Sowjets‹) umzuwandeln.
Stadtkommandant Dürr und Polizeipräsident Staimer drängten deshalb auf eine neuerliche Verhaftung Leviens und erreichten sie schließlich auch. Beim Haftprüfungstermin stellte sich jedoch heraus, dass kein ausreichendes Belastungsmaterial vorlag, und so wollte am Ende wieder keiner der Minister die Verantwortung für die Inhaftierung des Kommunistenführers übernehmen. Ein Haufe Arbeiter und Soldaten, der am 9. Februar demonstrativ zur Haftanstalt Stadelheim hinausgezogen war, traf Levien bereits vor den Gefängnistoren an.
Am Abend desselben Tages kam es im Münchner Arbeiterrat zum Eklat, als ein Redner, der um Vertrauen für Auer warb, niedergeschrien wurde. Die Delegierten von SPD und Freier Gewerkschaft verließen daraufhin den Saal. In der folgenden ›Rumpfsitzung‹ wurde für Sonntag, den 16. Februar, eine Massendemonstration zugunsten des Rätesystems beschlossen. Sie wurde zur größten nach dem Umsturz.
Gewerkschaft und SPD hatten versuchten, sich zum Herren der Veranstaltung zu machen und zur Teilnahme an einer Demonstration aufgerufen, die gegen ihre eigene Regierung gerichtet war. Plakate mit ›Alle Macht den ABS-Räten‹, ›Hoch Lenin und Trotzki‹ und ›Acht Tage noch so weiter leiern, und Bluthund Noske schießt in Bayern‹ mischten sich mit Tafeln wie ›Für den Landtag‹ und ›Gegen den Bolschewismus‹. Die ›Parlamentaristen‹ waren offensichtlich in der Minderzahl. Eisner wollte ebenfalls der Demonstration ihre regierungsfeindliche Spitze nehmen, aber gleichzeitig seine Popularität gegenüber den Ministerkollegen festigen. Er führte den Zug im offenen Wagen an. Doch die erhofften Ovationen blieben diesmal aus. So ließ er auf halbem Wege das Fahrzeug abdrehen.
Eisner war am Ende. Der amerikanische Historiker Allan Mitchell urteilt:
Die Mehrheitssozialisten in der Regierung waren nicht bereit, dem Landesrätekongress positive Zusagen hinsichtlich seiner zukünftiger Rolle zu machen. So vertagten sich die Räte in ihrer Schlusssitzung am 20. Februar ergebnislos. Man beschloss zwar noch yeine Reihe öffentlicher Kundgebungen«, legte das Schicksal des Rätesystems aber praktisch in die Hände des neuen Parlaments. Eisner hielt eine letzte Rede, in der er dazu aufrief, unabhängig vom Landtag und der bürgerlichen Mehrheit »die neue Demokratie aufzubauen« – was immer das heißen mochte. Unterdes war er bereits zum Rücktritt entschlossen.
»Eisner ermordet!«
Als Eisner am nächsten Tag, dem 21. Februar, von seinem Ministerialbüro zur Eröffnungssitzung des neuen Parlaments ging, hatte er die Rücktrittserklärung in der Tasche. Kurz nachdem er, in Begleitung seiner beiden Sekretäre und zweier bewaffneter Leibwächter, auf dem Weg zum Landtag in der Prannerstraße von seinem Ministerium am Promenadeplatz in die heutige Kardinal-Faulhaber-Straße einbog, stürzte ein junger Mann von hinten auf ihn zu und feuerte zwei Schüsse auf ihn ab. Die Kugeln trafen ihn in den Kopf, er war sofort tot.
Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei diesem Anschlag um die Tat eines fanatisierten Einzelgängers, ihr lag aller Wahrscheinlichkeit nach keine Verschwörung zugrunde. Doch kam sie auch nicht aus heiterem Himmel. Der Attentäter, Graf Arco-Valley, verkehrte in der ›Thule-Gesellschaft‹, einer rechtsradikalen Untergrundorganisation, die das antisemitische und völkisch-rassistische Gedankengut des ›Germanenordens‹ und des ›Reichshammerbundes‹ pflegte. Ihr Führer, Rudolf Glauer alias Freiherr von Sebottendorff, hatte bereits Anfang Dezember versucht, den Ministerpräsidenten bei einem Versammlungsauftritt zu entführen. Auch in der Buttmann-Affäre hatte er seine Finger.
Die Mordtat bewirkte das Gegenteil von dem, was der junge Wirrkopf hatte erreichen wollen. Statt sein »geliebtes Bayernvolk« vom Bolschewismus zu befreien, trieb er es ihm geradezu in die Arme. »Wenn ich stürze«, hatte Eisner ahnungsvoll bekannt, »ist in München der Kommunismus unvermeidlich. Die geistige Verwirrung der Jugend ist zu groß.« Tatsächlich wurde der USPD-Führer, der in den Wochen vor seinem Tod von allen Seiten politische Demütigungen erfahren hatte, nun zum Märtyrer der Revolution. ›Rache für Eisner!‹, war der Schlachtruf bewaffneter Haufen, die drohend durch die Straßen zogen. Mit ihm verband sich der bekannte Ruf: ›Alle Macht den Räten!‹
Während Graf Arco, von Eisners Leibwächtern zusammengeschossen, aber noch lebend, vor einer lynchbereiten Menge in Sicherheit gebracht wurde, drang – eine Stunde nach dem Mordanschlag – der kommunistische Schankkellner Alois Lindner ungehindert in den tagenden Landtag und schoss mehrmals auf Innenminister Auer, der schwer verletzt vom Stuhl sank. In einer anschließenden Schießerei, an der sich weitere Radikale beteiligten, wurden die Abgeordneten Osel und Jahreiß getötet. Die Soldaten, die zum Schutz der Parlamentarier abgestellt waren, weigerten sich, den Mörder festzunehmen.
Dass gerade Auer mit dem Attentat auf Eisner in Verbindung gebracht wurde, kam ebenfalls nicht von ungefähr. Mehrmals war der SPD-Minister in den Verdacht geraten, mit Rechtsradikalen zu komplottieren. Diese wiederum hatten bei verschiedenen konspirativen Unternehmungen mit dem Namen Auer operiert. Offensichtlich betrachtete man in diesen Kreisen den Sozialistenführer als Wasserträger der Gegenrevolution. Was Wunder, dass dieses Bild auch bei der radikalen Linken entstand. War Eisner das Feindsymbol der Reaktion, so Auer das der Revolution.
Die Nachricht von den Attentaten ging wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Die Glocken begannen zu läuten, Trambahnen hörten auf zu fahren, rote Fahnen mit Trauerflor hingen aus den Fenstern. Vor dem Landtag ballten sich Menschenknäuel. In der Promenadenstraße, wo Sägespäne das Blut Eisners bedeckten, war eine Gewehrpyramide errichtet, an der ein schwarzumflortes Bild des Ministerpräsidenten inmitten von Blumen und Kränzen lehnte. Soldaten zwangen Vorübergehende zum Abnehmen des Hutes.
Der Landtag war gesprengt, die Abgeordneten waren nach dem Anschlag auf Auer, Jahreiß und Osel entsetzt auseinandergelaufen. Unterdes traten im Deutschen Theater die Münchner Räte zusammen, riefen zum dreitägigen Generalstreik auf, erklärten den Belagerungszustand mit abendlicher Ausgangssperre und ließen die Redaktionen der bürgerlichen Presse besetzen. Fünfzig Geiseln aus bürgerlich-konservativen Kreisen sollten einem Rechtsputsch vorbeugen, zur Aufstellung einer Arbeiterwehr wurden Gewehre ausgegeben. Vorsitzender des neukonstituierten Zentralrats der bayerischen Landesräteversammlung wurde der Lehrer Ernst Niekisch, ein Mann des linken SPD-Flügels, der sich als Vorsitzender des Vollzugsausschusses des Landesarbeiterrats einen Namen gemacht hatte.
Die Regierung Hoffmann
Der rechtsradikale Anschlag auf Eisner und die Morde der Linksradikalen, vermischt mit der Sorge um die künftige politische Entwicklung, brachte zunächst das zustande, worum lange vergeblich und oft mit Scheinheiligkeit gerungen worden war: die sozialistische Einheitsfront, einschließlich der Kommunisten. Zu sagen hatten in ihr allemal die Mehrheitssozialisten. Unter dem Druck seiner eigenen Partei musste Niekisch die Geiseln wieder freilassen und die Beschlagnahme der bürgerlichen Presse in eine milde Zensur umwandeln. Die SPD-Führer ließen auch weiterhin keine Zweifel daran, dass sie einer Ausschaltung des Parlaments nicht zustimmen würden. So lehnte dann der bayerische Rätekongress, der unter Vorsitz von Niekisch vom 25. Februar bis 1. März tagte, Erich Mühsams Antrag ab, Bayern zur Sozialistischen Räterepublik zu erklären: mit 234 gegen 70 Stimmen.
Der Rätekongress fand unter erheblichem Druck von der Straße statt, auf den die Verteidiger der parlamentarischen Republik mit demonstrativer Gewalt reagierten. Am 28. Februar lösten Dürrs Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett eine Versammlung auf, am nächsten Tag wurden auf der Theresienwiese drei Demonstranten von der (SPD-nahen) Republikanischen Schutztruppe erschossen. Levien wurde zum dritten Male verhaftet und wiederum freigelassen. Abseits der Hektik in der Hauptstadt, in der Stille der fränkischen Provinz, berieten unterdes die Führer von SPD, USPD, DDP und Bauernbund über die Zukunft Bayerns. Am 4. März kam es zur Nürnberger Vereinbarung: »sofortige Einberufung des Landtags zu einer kurzen Tagung, Bildung eines sozialistischen Ministeriums durch die beiden sozialistischen Parteien, Anerkennung dieses Ministeriums durch den gewählten Landtag, Schaffung einer Notverfassung«. Wiederum wurden den Räten jegliche legislativen oder exekutiven Rechte abgesprochen.
Dem Rätekongress, der in seiner personellen Zusammensetzung ohnehin von den Mehrheitssozialisten kontrolliert wurde, blieb nach geringem Widerstand nichts übrig, als auch diese Vereinbarung abzusegnen. Er tat es schließlich gegen die Opposition der Radikalen (einschließlich des linken USPD-Flügels) mit klarer Mehrheit. Daraufhin stellte der ehemalige Kultusminister Hoffmann eine Regierung aus SPD, USPD und Bauernbund zusammen. Der Landtag, der dann am 17. / 18. März in München unbehelligt zusammentrat, bestätigte das Minderheitskabinett und beschloss ein Ermächtigungsgesetz, das der Regierung umfassende Vollmachten erteilte.
In der augenblicklichen Situation konnte die Regierung Hoffmann freilich mit dieser Ermächtigung nicht viel anfangen. Der Zustand der bayerischen Wirtschaft war »jammervoll« (Hoffmann), die Erwerbslosenfrage offensichtlich nicht lösbar, angesichts des drohenden Staatsbankrotts verweigerten die städtischen Beamten die Annahme von Notgeld als Löhnung. Eine Schnee- und Kältewelle ungeahnten Ausmaßes, die Bayern Mitte März wie eine ägyptische Plage heimsuchte, weckte unerfreuliche Erinnerungen an den schlimmen Kriegswinter 1917/ 18. Fünfundvierzigtausend Arbeitslose in München bildeten einen ständigen Unruheherd, die Radikalen standen für den Sturz der parlamentarischen Regierung in den Startlöchern.
Die Wirtschaftsmisere ließ nun doch den Ruf nach Sozialisierungen laut werden, von der sich sogar Volksparteifunktionäre, die dem ländlichen Genossenschaftswesen nahestanden, etwas versprachen. Dr. Otto Neuraths aus dem USPD-verwalteten Handels- und Industrieministerium setzte sich dafür ein, doch der entschiedene Widerstand der SPD dagegen verurteilte seine Bemühungen von Anfang an zum Scheitern.
Während München in den ersten Apriltagen unter einem halben Meter Schnee lag, rumorte es in der Provinz. Die Kommunisten hatten aus Protest gegen die neuerliche Kapitulation des Rätekongresses nicht nur dessen Zentralrat, sondern auch München verlassen und tagten zusammen mit anderen Radikalen in Augsburg, dem Sitz der aktivsten Rätekörperschaft außerhalb der Hauptstadt. Die Ausrufung der Räterepublik in Ungarn erweckte neue Hoffnungen auf einen Sieg der ›Weltrevolution‹. Da half auch eine Intervention des linken SPD-Manns Niekisch nichts: Am 3. April stimmten die Augsburger Räte mit großer Mehrheit für die Ausrufung der Bayerischen Räterepublik. Ein Generalstreik am folgenden Tag sollte dieser Entschließung Nachdruck verleihen.
Der »Schneppenhorst-Plan«
Nach dem Willen der Revolutionäre hätte die Regierung Hoffmann jetzt die Räterepublik realisieren sollen, sie wurden entsprechend vorstellig. Doch der Regierungschef war am selben Tag nach Berlin verreist, das zurückgebliebene Kabinett erklärte sich für beschlussunfähig. Dieses Machtvakuum nutzte wiederum der Zentralrat. Er hob kurzerhand den Regierungsbeschluss zur Einberufung des Landtags für den 8. April auf und bereitete, vor der Kulisse lautstarker Massenversammlungen und schriller Parolen, einen Runden Tisch vor. Der fand in der Nacht zum 5. April im Kriegsministerium statt: Etwa hundert Notable aus den Parteien bis hin zur Deutschen Demokratischen Partei (DDP) sowie Gewerkschaftsfunktionäre, ABS-Räte sowie Armee- und Polizeirepräsentanten trafen sich hier. Einigermaßen überraschend fand sich eine Mehrheit für die Unterstützung der Räterepublik.
Dass es dazu kam, war Ernst Schneppenhorst zu verdanken, seit März im Kabinett Hoffmann für Militärisches zuständig. Der SPD-Minister wollte die Kommunisten in sein höchst eigenes Projekt einer Räterepublik einbinden, wahrscheinlich weil er in ihnen mittlerweile eine berechenbare Ordnungsmacht sah. Während der Unruhen nach Eisners Tod hatte er noch durch einen spektakulären Flugzettelabwurf gegen »die Gewaltherrschaft Dr. Leviens und seines bewaffneten Anhanges« von sich reden gemacht. Doch seit dem 5. März führte Dr. Eugen Leviné, ein deutsch-russischer Nationalökonom und Revolutionär, die bayerische KP. Innerhalb weniger Wochen hatte er seine Partei von ›undisziplinierten Elementen‹ gesäubert und einen Trennungsstrich zu den Anarchisten um Erich Mühsam gezogen. Das machte ihn in Schneppenhorsts Augen regierungsfähig.
Dessen Plan ging jedoch schief. Nicht nur, dass Leviné sich weigerte, an einem »vom grünen Tisch proklamierten Putsch«, zumal unter Führung der Sozialchauvinisten von der SPD, mitzuwirken. Für ihn machte nämlich, nach sowjetischem Vorbild, eine Räteregierung nur unter kommunistischer Führung Sinn. Auch das Kabinett spielte nicht mit. Auf der eilig einberufenen Konferenz führender Mehrheitssozialisten in Nürnberg wurde Schneppenhorsts Plan mit 47 zu 6 Stimmen verworfen, der Minister zum Widerruf gezwungen.
Doch die Dinge hatten bereits ihren Lauf genommen. Aus der Provinz gingen Nachrichten von der Konstituierung lokaler Räterepubliken ein. In München traf sich am Sonntagabend, den 6. April im Wittelsbacher Palais – pikanterweise im ehemaligen Schlafzimmer der bayerischen Königin – der Zentralrat zu einer weiteren Sitzung, allerdings ohne die SPD-Prominenz, die noch in Nürnberg konferierte. Kurzentschlossen erklärten sich die Anwesenden auf Landauers Antrag zur konstituierenden Versammlung und verkündeten, wie am nächsten Tag an allen Straßenecken zu lesen war: »Baiern ist Räterepublik«.
Die USPD-Leute hatten mit ihrer Zustimmung gezögert. Doch am Ende verzichteten sogar die anwesenden SPD-Vertreter und Gewerkschaftsfunktionäre auf ihre Einwände und versprachen, sich »dem Willen der Massen zu fügen«. Ein Kabinett von ›Volksbeauftragten‹ und ›Kommissären‹ wurde gebildet, das sich durch eine interessante Zusammensetzung auszeichnete. Neben dem Atheisten Gustav Landauer für Erziehung und Unterricht, dem Planwirtschaftler Ernst Neurath für Wirtschaft und dem Freiwirtschaftler Silvio Gsell für Finanzen gab es da einen Außenminister Dr. Theodor Lipp, der wenig später in eine Heilanstalt eingewiesen werden musste, und einen Verkehrsminister Georg Paulukin, der Niekisch zufolge das Verkehrswesen allenfalls als Streckenarbeiter kennengelernt hatte. SPD-Mitglied Niekisch selbst, der sich bei den Abstimmungen der Stimme enthalten hatte, trat von seinem Amt als Zentralratsvorsitzender zurück, dass daraufhin Toller einnahm. Ernst Toller, Dichter und Dramatiker, hatte nach Eisners Tod den Vorsitz der bayerischen USPD übernommen.
Sowohl Toller als auch Niekisch haben sich später Vorwürfe gemacht: Toller, weil er sich auf ein Abenteuer einließ, das nur in einer Katastrophe enden konnte; Niekisch, weil er sich lediglich durch Stimmenthaltung von dieser »politischen Groteske« distanzierte. Beide befanden sich »im Banne der überhitzten revolutionären Stimmung, die sich im München jener Tage zusammengeballt hatte« (Niekisch). Bei einigermaßen kühlem Kopf hätten sie erkannt, dass angesichts der Entwicklung im Reich der Versuch zur Errichtung einer Räterepublik anachronistisch geworden war.
In der zweiten Januarwoche hatte die sozialdemokratische Regierung Ebert mit Hilfe rechtsradikaler Freikorps den sogenannten Spartakusaufstand in Berlin niedergeschlagen, es gab mehr als hundertfünfzig Tote. Danach war die seit Januar bestehende Räterepublik Bremen militärisch liquidiert worden. Die Märzkämpfe in Berlin um die Sozialisierungsfrage endeten noch blutiger als der Januaraufstand; an die tausendzweihundert Opfer waren diesmal zu beklagen. »Solange die Berliner Regierung am Leben blieb und die Freikorps zur Verfügung hatte, war die Sowjetisierung Bayerns eine Fata Morgana«, urteilt der Amerikaner Allan Mitchell. Man konnte sich ausrechnen, was auf München zukommen würde.
Die »Scheinräterepublik«
Die Tragikomödie mit blutigem Ende währte dreieinhalb Wochen, in denen die duldende bis ablehnende Haltung der Konservativen dem neuen Staat gegenüber in offenen Hass auf die Initiatoren und Mittäter der Revolution und damit auf die Republik selbst umschlug. Ein Teil des Bürgertums hatte gegen Kriegsende energisch auf Reform gedrängt und diente sich dementsprechend nach dem Novemberumsturz der Revolutionsregierung an. Wenn sich viele auch nur »auf den Boden der Tatsachen stellten, um zu retten, was zu retten ist«, so taten es einige auch aus Angst vor einer Konterrevolution. Doch bedeutete die gelegentliche Zustimmung aus dem bürgerlichen Lager nicht, dass das reaktionäre Element sich in ihm gleichsam in Nichts aufgelöst hätte. Als sich das Bürgertum von der Revolution abwandte, weil es seine Interessen gefährdet sah und weil es ein Abgleiten in ›russische Zustände‹ befürchtete, witterte die extreme Rechte Morgenluft.
Nicht anders sah es auf dem Land aus. Eisners Bemühen um die Bauern hatte einen klaren machtpolitischen Aspekt gehabt, denn Bayern war ein Agrarland, dessen städtische Zentren auf das Umland angewiesen waren. Mit Russland, wo ja auch die Landwirtschaft dominierte, war Bayern nicht zu vergleichen, da die Bauern hier wohlhabend und selbstbewusst waren. Ihre Interessen fanden sie von ihren Standesverbänden, unter denen der Bauernverein dominierte, gut vertreten. Der Bauernverein des Dr. Heim war aber eine Agentur der konservativen (und teilweise antisemitischen) Volkspartei (BVP), die sich zwar zum »gegenwärtigen staatspolitischen Zustand Bayerns« als einer »gegebenen geschichtlichen Tatsache« bekannte, aber nichtsdestoweniger die Restauration der Monarchie betrieb. So standen die Bauern in ihrer Mehrheit der Revolution recht distanziert gegenüber. »Sie halten alles nur für einen unsinnigen Spektakel. ›Den machen bloß die Leut, die nicht arbeiten wollen‹, sagen sie« (Oskar Maria Graf).
Was sich in den sechs Tagen der ersten Räteregierung ereignete, erschien manchem, so Niekisch, „als wäre durch einen kecken Streich anarchistischer Bohemiens für eine kurze Zeit Schwabing Münchens Herr geworden“. Mitchell schreibt dazu:
Diese sarkastische Schilderung soll nicht verdecken, dass die Räterepublik noch viel weniger politischen und wirtschaftlichen Bewegungsspielraum hatte als die Regierungen Eisner und Hoffmann. Dazu kam, dass die Widerstände, die sich ihr allenthalben entgegenstellten, ungleich stärker waren. Auch ein fähigeres Kabinett hätte sich angesichts einer widerstrebenden Beamtenschaft, einer verunsicherten Polizei und der allmählichen Abschnürung von allen Ressourcen in einer aussichtslosen Lage befunden.
Es gelang nichts. Die Regierung konnte weder die Bevölkerung durch ihr administratives Handeln überzeugen, noch war sie in der Lage, wirksame Maßnahmen zu ihrem eigenen Schutz und ihrer politischen und militärischen Selbstbehauptung zu ergreifen. Durch zügellosen Verbalradikalismus erweckten viele ihrer Repräsentanten Ängste, die bald in stillen Hass umschlugen. Der Begriff ›Räterepublik‹ wurde auf diese Weise zum Synonym für Anarchie und Terror.
Die kommunistische Räterepublik
Im Grunde genommen ging es aber gar nicht mehr um gute oder schlechte Politik. Mittlerweile hatte sich nämlich die Regierung Hoffmann in Bamberg neu formiert und reklamierte ihren Herrschaftsanspruch in Bayern. Die Parlamentarier des neuen Landtags folgten dem Kabinett ins ›Exil‹. Der Freistaat hatte zwei Regierungen und zwei Repräsentativorgane. Der Bürgerkrieg schien unvermeidlich. Nordbayern befand sich, nach der Verhaftung radikaler Räteaktivisten durch Schneppenhorsts Leute fest in der Hand der ›Republikaner‹. Lediglich im Dreieck Augsburg-Rosenheim-Garmisch mit dem Zentrum München hatten die Räterepublikaner das Sagen.
Die Berliner Regierung drängte, unter Hinweis auf die Reichseinheit, die es zu bewahren galt, und französische Truppen, deren Eingreifen drohte, auf eine militärische Entscheidung, wie sie schon im Falle Bremens exekutiert worden war. Die bayerischen Mehrheitssozialisten, die – mit Unterstützung der Bayerischen Volkspartei – den Einmarsch preußischen Militärs verhindern wollten, versuchten es in München zunächst mit einem Gegenputsch. Sie bedienten sich dabei der Republikanischen Schutztruppe unter Seyffertitz, die von rechtsradikalen Wirtschaftskreisen finanziert wurde. Dieser gelang in der Nacht zum Palmsonntag tatsächlich die Entführung einer Anzahl Räteaktivisten und die Besetzung strategischer Orte in der Stadt, darunter der Hauptbahnhof.
Seyffertitz plante eine interimistische Militärdiktatur, die für Schneppenhorst Quartier machen sollte, der in Ingolstadt mit 600 Mann bereit stand. Doch das Unternehmen brach, wie so viele reaktionäre Putsche in München, schon nach kurzer Zeit zusammen. Während Ritter von Epp, bis vor kurzem Kommandant des königlichen Leibregiments, in Norddeutschland ein Freikorps aufstellte, erklärte sich dieses am Morgen des 12. April für neutral. Ungehindert mobilisierten Räteanhänger die Straße. Es kam zu Schießereien vor dem Rathaus und im Hauptbahnhof, wo sich Seyfferitz' Leute bisher verschanzt hatten. Um neun Uhr abends wurde der Bahnhof von den ›Roten‹ gestürmt, die Verteidiger retteten sich mit einem Zug nach Ulm. Siebzehn Tote und hunderte Verletzte blieben zurück.
Am Ende bewirkte dieser dilettantische Putschversuch nur die endgültige Machtübernahme der Kommunisten. Während am Bahnhof noch Maschinengewehrfeuer bellte, wählte im Hofbräuhaus ein frischgebildeter Betriebs- und Soldatenrat einen Aktionsausschuss aus neun Sozialisten und sechs Kommunisten, der seinerseits eine neue Regierung bildete: einen vierköpfigen Vollzugsrat unter der Führung von KP-Chef Leviné. Die Kommunisten konnten sich am Ziel ihrer Träume wähnen. Überzeugt, den Willen der Massen zu vollziehen, blieb ihnen jedoch nur mehr die Rolle des Abdeckers der Revolution.
Leviné, der kurz zuvor noch der ›Scheinräterepublik‹ die Unterstützung verweigert hatte, weil Bayern nicht hoffen könne, »sich wirtschaftlich längere Zeit selbständig zu halten«, steuerte offensichtlich auf eine Märtyrerrolle zu. Nach außen hin propagierten die Kommunisten Durchhalteparolen. Während in Ungarn schon ›weiße‹ Truppen aus Rumänien einrückten und in Russland immer noch der Bürgerkrieg tobte, nährte sich Münchens ›dritte Revolution‹ von unsinnigen Hoffnungen auf Entsatz aus dem Osten, wurde der Schlachtruf der Französischen Revolution ça ira! (Es wird gehen!) zum Verzweiflungsschrei. Es ging nicht.
Immerhin zeigten sich die Kommunisten entschlossener als die von freiheitlichen und pazifistischen Idealen bestimmten Anarchisten. Die am 10. April begonnene Aufstellung einer Roten Armee machte sichtlich Fortschritte, die Entwaffnung des ›Bürgertums‹ kam weitgehend zur Durchsetzung und die freie Presse musste ihre Arbeit einstellen. Gehamsterte oder in Vorrat gehaltene Lebensmittel wurden zur Verproviantierung der Roten Armee beschlagnahmt, Wohnraum wurde requiriert, und man nahm wiederum Geiseln. Ein zehntägiger Generalstreik zugunsten der Räteregierung sollte die Geschlossenheit des Proletariats demonstrieren.
Belagerungszustand
Unterdessen versammelte die Regierung Hoffmann eine Freicorps-Armee um sich. Aber das erwies sich als gar nicht so einfach. Selbst in der revolutionsfeindlichen Bauernschaft fanden sich zunächst nur wenige bereit, erneut in den Krieg – diesmal den Bürgerkrieg – zu ziehen. Und kamen die Geworbenen dann in Kontakt mit den Roten, konnte man sich ihrer Loyalität nicht mehr sicher sein. Dass sich am Ende doch eine erkleckliche Anzahl Freiwilliger meldete, war nicht zuletzt Verdienst einer Propaganda, die plumpe Lügen nicht scheute: In München rase der russische Terror, die Bürger seien Freiwild, auf das man Schießübungen abhalte, Landauer habe die kommunistische Vielweiberei eingeführt, Klöster würden geplündert und Priester ermordet, den Bauern das Vieh weggetrieben und der Sparpfennig geraubt. Derartige Schreckensbilder beeindruckten die bayerischen Bauern mehr als die abstrakte Drohung mit dem Bolschewismus, von dem die meisten gar nicht wussten, was er wirklich bedeutete.
Am Ende brachte Hoffmann 22.000 Freiwillige auf die Beine, keineswegs alle Landeskinder. Zum Beispiel waren Württemberger Freicorps darunter, etwa 3.700 Mann. Reichswehrminister Noske versprach später noch 20.000 aus Berlin, 7.500 trafen davon tatsächlich ein. Sie legten nach und nach einen immer engeren Belagerungsring um München. Den Oberbefehl über diese ›Reichsexekution‹ hatte der preußische General Ernst v. Oven.
Dem standen Verteidiger gegenüber, immerhin an die neuntausend Bewaffnete, die damit jedoch deutlich in der Minderzahl waren. Trotzdem konnte die Rote Armee unter dem ehemaligen Matrosen und Marineinfanteristen Rudolf Egelhofer Anfangserfolge erzielen. Am 16. April stürmten etwa zweitausend Rotarmisten einen Vorposten der Bamberger Paramilitärs bei Dachau nördlich von München und eroberten das Städtchen. Wer den Befehl zum Angriff gegeben hatte, war später nicht mehr zu klären. Fünf Offiziere und sechsunddreißig Soldaten gerieten in Gefangenschaft. Was nicht floh, lief zu den ›Roten‹ über. Egelhofer gab Befehl, die gefangenen Offiziere standrechtlich zu erschießen. Doch Toller, dem mittlerweile das Amt des Stadtkommandanten zugefallen war, zerriss die Order. Fünf Tage später gab er sein Kommando wieder ab.
Dieser kleine Sieg, mehr Ergebnis von Undiszipliniertheit als von militärischem Genie, weckte bei den Räterepublikanern neue Hoffnung. Sie erwies sich freilich als trügerisch. In München war es zu dieser Zeit noch relativ ruhig. Das Revolutionstribunal schreckte mehr durch martialische Ankündigungen und Drohungen denn durch Taten. Kein Bürger wurde zum Tode verurteilt, keiner erschossen. In einer später von der Münchner Polizeidirektion erstellten Denkschrift heißt es dazu: »Richtig ist: abgesehen von der Erschießung der Geiseln (vom 30. April), ist es in der Zeit der Räteregierung zu Mordtaten, zur Brandstiftung, zur Vergewaltigung von Frauen, zu großen Lebensmittelgeschäftsplünderungen, zur allgemeinen Enteignung von Privatbesitz, n i c h t gekommen.«
Wenn sich diese Tage dennoch vielen Einwohnern als Schreckenszeit einprägten, so nicht zuletzt wegen der Blockade Münchens. Sie verschlechterte die Versorgungslage in der Hauptstadt dramatisch. Nach dem Fiasko bei Dachau war man in Berlin entschlossen, erst zum Sturm anzutreten, wenn der Sieg garantiert war. »Bis Truppen in ausreichender Stärke zusammengebracht sind, kann München wohl oder übel etwas in Angst schmoren«, befand Reichswehrminister Noske, wie er in seinen Memoiren zynisch bemerkt. Dass die Not auf diese Weise zunahm, lasteten die Münchner freilich der Räteherrschaft, nicht den ›Weißen‹ an. Und selbst wenn sie es taten: Sie hatten in jedem Falle genug davon und sehnten sich, nachdem sie die Revolution um des Friedens und einer besseren Zukunft willen begrüßt hatten, nach Ruhe und einem vollen Magen.
Die Rote Armee herrscht
Die schwierige Wirtschaftslage, aber auch die drohende militärische Entscheidung trugen in München Uneinigkeit ins Lager der Radikalen. Die Kritik, so wie sie von der USPD vorgetragen wurde, richtete sich jetzt vor allem gegen die ›Russen‹ in der Regierung, teilweise Männer yvon zweifelhaften Kenntnissen und zweifelhaftem Charakter«, die Entscheidungen nicht an Notwendigkeiten, sondern an ihren touristischen Erfahrungen in Russland messen und das Volk über die wahre Situation täuschen würden. »Die jetzige Regierung betrachte ich als ein Unheil für das werktätige Volk Bayerns«, erklärte der »Befreier von Dachau«, Ernst Toller, am 26. April bei einer Rätesitzung im Hofbräuhaus. »Unfähig, auch nur das Geringste aufzubauen, zerstören die führenden Männer in sinnloser Weise.«
Nach einem Misstrauensantrag gegen den Vollzugsrat am nächsten Tag mussten Eugen Leviné und Max Levien zurücktreten. Eine neue Regierung wurde gebildet, doch die Kommunisten waren nicht bereit, sich ihr unterzuordnen. Die folgenden Nächte verbrachten viele Räteführer an geheimen Orten, nicht nur aus Angst vor Rechtsputschisten, sondern auch vor den eigenen Genossen. Denn in Wirklichkeit herrschte jetzt die Rote Armee in München. Egelhofer war entschlossen, die Stadt, »koste es, was es wolle«, zu halten. Der Versuch der neuen Männer im Wittelsbacher Palais, entgegen der erklärten Absicht ihres obersten Militärs mit der Bamberger Regierung zu verhandeln, war freilich sinnlos. Die Macht lag jetzt bei den ›weißen‹ Generälen, die den Ring ihrer Truppen um München täglich enger schnürten. Sie forderten die bedingungslose Übergabe.
Nachrichten aus der Provinz über das schonungslose Vorgehen der Regierungstruppen auch im Falle der Kapitulation arbeiteten Egelhofers Durchhaltepolitik entgegen. Doch wussten die Radikalen das nicht zu nutzen, im Gegenteil, sie schwächten durch Chaos den Widerstandswillen. Während ein letzter Appell, sich der in Auflösung begriffenen Roten Armee anzuschließen, kaum Widerhall fand, verwüstete eine Bande Kommunisten das Polizeipräsidium. Während Sturmglocken läuteten und in den verödeten Straßen nur Kinder zu sehen waren, die ›Rote‹ und ›Weiße‹ spielten, wurden von irgendwelchen Leuten mit roten Armbinden wahllos Menschen verhaftet. Besonnene Rätemitglieder hatten alle Mühe, sie wieder freizubekommen.
Am Abend des 30. April versammelten sich die Räte noch einmal im Hofbräuhaus, um das ›Proletariat Münchens‹ aufzufordern, die Waffen niederzulegen und den Einmarsch der Reichstruppen schweigend hinzunehmen. »Da stürzt ein Mann aufs Podium, ruft, dass im Luitpoldgymnasium neun Gefangene erschossen sind, Bürger der Stadt München. Entsetzen packt die Versammlung. Diese Arbeiter, die wissen, dass sie vielleicht morgen schon an die Wand gestellt werden, erheben sich schweigend von ihren Sitzen«, berichtet Toller.
Wie sich herausstellte, hatte der Kommandant des als Gefängnis dienenden Luitpoldgymnasiums, auf die Nachricht von der Erschießung roter Soldaten durch Regierungstruppen hin, Befehl erhalten, seinerseits Gefangene zu exekutieren. Die Order war von Egelhofer abgezeichnet. Daraufhin wurden zuerst zwei Husaren, dann sieben Mitglieder der Thule-Gesellschaft (darunter eine Frau) und ein weiterer Zivilist erschossen.
Die Einzelheiten und Hintergründe dieser verhängnisvollen Untat im ›Blutgymnasium‹, die unter dem Namen ›Geiselmord‹ Anlass zu vielfacher Vergeltung gab, wurde später in einem Gerichtsverfahren weitgehend aufgeklärt. Doch drang das Ergebnis nie ins allgemeine Bewusstsein. Schauergeschichten, wie etwa die angebliche Verstümmelung nackter Leichen, die danach die Stimmung der vorrückenden Reichstruppen anheizten, bestätigten sich nicht. Die Opfer, in der Mehrzahl Mitglieder der rechtsradikalen Thule-Gesellschaft, der auch der Eisner-Mörder Arco angehörte, waren zudem keine Geiseln, wie sie in früheren Fällen aus den Reihen unbelasteter Bürger genommen worden waren, sondern Gefangene, die der Konterrevolution beschuldigt wurden. Da sie nicht überführt waren – Egelhofer hatte sie nicht einmal dem Revolutionstribunal überstellen lassen –, war ihre Erschießung nichtsdestoweniger Mord, ein mörderischer Racheakt.
Der Kampf um München
Am 1. Mai drangen die ersten Truppen in die Stadt. Die USPD hatte zu Maifeierlichkeiten aufgerufen, doch kam es am Vormittag nur zu einer kläglichen Kundgebung. Die Regierungstruppen hatten mit ihrem Vormarsch bis zum 2. Mai warten wollen, um keine Märtyrer für künftige Maifeiern zu schaffen. Doch auf die Nachricht vom Geiselmord hin rückten gegen Mittag einzelne Verbände, unter anderem die Brigade Ehrhardt, die später im Kapp-Putsch eine verhängnisvolle Rolle spielte, befehlswidrig vor und erreichten nach kurzer Zeit die Innenstadt.
Während sich die Repräsentanten des Räteregimes ›unauffällig‹ zu machen trachteten, erwachte im konservativen Bürgertum der Mut. Weißblaue Fahnen tauchten allenthalben auf, die Residenz, das Wittelsbacher Palais und andere Regierungsgebäude wurden von ›bürgerlichen‹ Zivilisten kampflos besetzt, bewaffnete Bürgertrupps begannen, wie zuvor die ›Roten‹, auf eigene Faust mutmaßliche oder bekannte Gegner zu verhaften. Doch wurde zu früh gefeiert.
Das Vorprellen relativ schwacher Heereseinheiten täuschte die schon kapitulationsbereiten Rotarmisten hinsichtlich der wahren Stärke der Angreifer. Einzelerfolge ließen die Verteidiger Hoffnung schöpfen und führten zu erbitterten Kämpfen um einzelne Verteidigungsstellungen wie etwa den Hauptbahnhof. Erst der geordnete Vormarsch der überlegenen Hauptstreitmacht am nächsten Mittag machte den Kampfhandlungen innerhalb von vierundzwanzig Stunden ein Ende. Danach zogen die feder- und buschengeschmückten Freikorpskämpfer aus dem bayerischen Oberland und Soldaten aus dem ganzen Reichsgebiet durch die bayerische Hauptstadt, umjubelt von weiten Teilen der Bevölkerung.
Was folgte, war weniger fröhlich, als uns Fotografien aus jenen Tagen vorgaukeln. Schon auf ihrem Vormarsch hatten die ›Weißen‹ rücksichtslose Brutalität gezeigt – animiert durch den Einsatzbefehl von Reichswehrminister Noske, der zu raschem und hartem Vorgehen aufforderte. Auch die Haltung der Regierung Hoffmann war nicht dazu angetan, mäßigenden Einfluss auf Soldaten und Freischärler auszuüben. Zwar interpellierte der Ministerpräsident in diesem Sinne beim Oberkommando, doch sein Justizminister fiel ihm mit Anweisungen in den Rücken, deren Auslegung Missbrauch zuließen:
Die Meldungen von Erschießungen, die den Reichstruppen vorauseilten, waren also nicht erfunden. Parlamentäre und räterepublikanischer Funktionäre wurde, auch wenn sie keine Waffen trugen, umstandslos liquidiert, Kriegsgefangene sowieso. Es traf auch Unbeteiligte. Am Ende kamen 650 Rotarmisten und Zivilisten beim Kampf um München ums Leben, auf Seiten der Regierungstruppen traf es hundert Mann. Doch das war nichts im Vergleich zu den Auswüchsen des folgenden Besatzungsregimes.
Was die Propaganda dem ›russischen Terror‹ an Plünderungen, Gefangenenmisshandlungen und Mord unterstellt hatte, praktizierte jetzt die ›weiße‹ Soldateska in der Realität. Das Prozessmaterial dazu füllt Aktenschränke. In einer Denkschrift des Bayerischen Justizministeriums vom 12. Oktober 1922 werden von 215 Hinrichtungen und Erschießungen nur zweiundzwanzig als rechtmäßige Exekutionen anerkannt. Auch schwere Eigentumsdelikte waren zu verzeichnen. So erinnerte sich der ehemalige Verwalter der Königlichen Residenz: »Was wir bei den Roten noch schonen und schützen konnten, das wurde von den Weißen nicht besonders geachtet, sondern sie stahlen, was ihnen nur gerade in die Hände kam, und wir konnten da weiter nichts machen.«
Aus der Zahl der gerichtlich belegten Fälle von Totschlag und unrechtmäßigen Exekutionen verdienen einige besondere Erwähnung. Am 2. Mai wurde der Kultusminister der ersten Räteregierung Gustav Landauer, ein Pazifist und Freund Martin Bubers, auf einem Gefangenentransport erst misshandelt, dann durch drei Schüsse in Kopf und Unterleib aus unmittelbarer Nähe getötet, seine Leiche gefleddert und geschändet. Ähnlich erging es dem Gymnasialprofessor und Mitglied der USPD, Dr. Karl Horn, am folgenden Tag. Der Oberkommandierende der Roten Armee, Rudolf Egelhofer, wurde am 3. Mai um vier Uhr morgens in der Münchner Residenz nach schweren Misshandlungen durch Kopfschuss erledigt.
Großes Aufsehen erregte die Erschießung von 52 russischen Kriegsgefangenen in Gräfelfing, die sich nach ihrer Freilassung Egelhofers Roten Armee angeschlossen, aber nur Wachdienst versehen und sich sonst nichts zu Schulden hatten kommen lassen. In der Nacht zum 6. Mai wurden in Perlach zwölf Arbeiter ohne Verfahren exekutiert. Schwerster Zwischenfall, der Unruhe auch im Bürgertum hervorrief, war das Massaker vom 7. Mai an einundzwanzig Mitgliedern des politisch unverdächtigen katholischen Gesellenvereins St. Joseph im Hof des Prinz-Georg-Palais am Karolinenplatz. Als Tatmotiv kommt hier nur Mordlust in Frage.
Die militärische Führung distanzierte sich zwar von diesen Untaten. Der Tagesbefehl einer Abteilung Probstmayr vom 3. Mai enthält die ›eindringlichste‹ Anweisung, »dass unter keinen Umständen Gefangene misshandelt oder erschossen werden dürfen«. Andere Einheiten aber machten offensichtlich weiter. Zwei Tage später hielt das Generalkommando v. Oven folgenden Richtlinienerlass für notwendig: »Wer festgenommen ist, kann nur noch gerichtlich abgeurteilt werden, zuständig ist das standrechtliche Gericht. (...) Jedes andere Verfahren gegen Festgenommene ist unzulässig, insbesondere die Aburteilung durch militärische Feldgerichte.« Weitere Korpsbefehle ähnlichen Inhalts folgten, offensichtlich weil die vorrangegangenen nichts bewirkten. Entweder hatten die Generäle ihre Truppen nicht im Griff oder die Erlasse waren nur formal.
In der Münchner Bevölkerung, die anfangs die Reichstruppen als Ordnungsmacht begrüßt hatte, wandte sich die Stimmung nun zum Teil gegen sie. Aber auch innerhalb der Freicorps gab es vereinzelt Unruhe wegen der willkürlichen Erschießungen, so unter den Württembergern. Manchmal führten Zeugenaussagen von Soldaten dazu, dass es überhaupt zu Anklagen gegen Übeltäter kam. In den meisten Fällen folgten danach jedoch politisch motivierte Freisprüche.
Sündenfall der Sozialdemokratie
»Die konservative Reaktion auf die Revolution, die mit der militärischen Überwindung der Räterepublik durch die Freicorps im Mai 1919 ihren Anfang nahm, war in keinem der deutschen Länder so drastisch wie in Bayern«, urteilt der Historiker Allan Mitchell.
Das brutale Vorgehen gegen die Münchner Revolutionäre war die Blaupause für den späteren Triumph der Demokratiefeinde. Kapp-Putsch und Hitler-Putsch waren dabei nur die Schaumkronen auf einem tiefen Gewässer. Auf der Gegenseite blieb eine unversöhnliche Feindschaft weiter Kreise der Arbeiterschaft dem parlamentarischen System gegenüber, von dessen Führern und Fürsprechern sie sich verraten fühlten. Die von den Regierenden in Bayern geförderte oder gedeckte Gerichtspraxis, die Repräsentanten der Räterepublik mit drakonischen Strafen zu belegen, die Mörder unter den ›Weißen‹ aber laufen zu lassen, bestätigten dieses Ressentiment.
Bayern galt danach als konservative ›Ordnungszelle‹ im Reich und zog rechtsradikale Elemente aus dem ganzen Reich an. So wurde München schließlich zur ›Stadt der Bewegung‹. In den breiteren, vor allem ländlichen Volksschichten hatte der politische Rechtsextremismus in Bayern zwar zunächst ebenso wenig eine Basis, wie vordem die Revolution. Die NSDAP brachte es noch bei den Wahlen zum Bayerischen Landtag 1928 auf nur neun Abgeordnete. Es war das Ferment fortdauernder politischer und gesellschaftlicher Polarisierung, das die parlamentarische Demokratie zersetzte und das Gebäude der Weimarer Republik schließlich zum Einsturz brachte.
Dazu trug nicht nur die wirtschaftliche und soziale Not bei, die Arbeiter, heimgekehrte Soldaten und Kleinbürger gleichermaßen traf. Es war darüber hinaus die politisch-kulturelle Spaltung in liberale Demokraten und autoritäre Reaktionäre, in Humanisten und Antisemiten, die zu Unversöhnlichkeit und Hass führte. Gegensätzliche Weltanschauungen verhinderten den lösungsorientierten Dialog. Die pauschale Diffamierung der Revolutionäre als arbeitsscheue Kaffeehausliteraten setzte sich in der Intellektuellenbeschimpfung eines Goebbels fort. Dabei war, scheinbar paradox, gerade die Bildungselite anfällig für die Nazipropaganda.
Aus großem zeitlichen Abstand ist es immer leicht, es besser zu wissen. Diese selbstkritische Einschätzung berechtigt den Historiker jedoch nicht, sich auf eine neutrale Beobachterposition zurückzuziehen. Gerade weil der Historiker größere Zeiträume überblickt, ist es ihm möglich, Ursachen und Folgen politischen Handelns zu erkennen und zu bewerten. Was 1918/19 geschah, ist eine Tragödie des Sozialismus und der Sozialdemokratie. Sie begann mit der Zustimmung der SPD zu den Kriegsanleihen 1914 und endete mit der Verfolgung der Sozialdemokraten ab 1933.
Man kann die Zwickmühle verstehen, in die SPD- und USPD-Politiker immer wieder gerieten. Sie waren selbst Kinder der Revolution, und die Furcht, Opfer eines weitergehenden Umsturzes zu werden, war nicht aus der Luft gegriffen. Die Nachrichten aus Russland trugen dazu bei, diese Angst zusätzlich zu schüren. Man kann auch verstehen, dass Gewerkschafter und Sozialisten in ihrer Revolution auf bürgerliche Ordnung und Rechtsgarantien setzten. Man kann nachvollziehen, dass sie dem repräsentativen Parlamentarismus, für den sie so lange gekämpft hatten, den Vorzug vor dem ungewissen Experiment einer Räterepublik gaben. Man kann andererseits die Enttäuschung der Radikalen verstehen, die befürchteten, am Ende werde alles so weitergehen wie bisher, nichts werde sich an den Macht- und Eigentumsverhältnissen ändern und nichts am Elend der Arbeiter und des kleinen Mannes. Am Ende hatten sie ja recht.
Was jedoch fassungslos macht, ist die Blindheit, mit der gestandene Sozialdemokraten im Kampf um die Macht in München und Berlin – ob offen oder im Geheimen – Bündnisse mit politischen Verbrechern eingingen. Nicht mit christlichen Wertkonservativen und Nationalliberalen, nein, mit Rassisten, Antisemiten und Reaktionären, die sich in ihrer Wirrköpfigkeit und Demokratiefeindschaft von linksradikalen ›Spinnern‹ und Bolschewisten nicht unterschieden. Man hat mit Recht die fehlende Solidarität der Demokraten für das Desaster der Weimarer Republik verantwortlich gemacht. Das begann 1919, als Demokraten der Versuchung erlagen, die Hilfe von Demokratiefeinden und Menschenverächtern in Anspruch zu nehmen.
Dies ist der wahre Geburtsfehler der Weimarer Republik. Wer sich von Verbrechern helfen lässt, hat sie später am Hals. »Euch Gegenrevolutionäre müsste man alle an die Wand stellen«, hatte der Münchner Stadtkommandant und Gewerkschafter Oskar Dürr zu einem der Rechtsputschisten gesagt. Dürr ging durchaus entschlossen gegen Linksputschisten vor, aber er wusste auch, wo der wahre Feind steht. Das sollten wir, Sozialdemokraten und Liberale, auch heute wissen. Wie 1918 verlaufen heute die Fronten – in Deutschland und in Europa – zwischen einer sozialen, liberalen und humanitären Zivilgesellschaft auf der einen Seite und einer reaktionären Schimäre von Nationalstaatlichkeit, Volksgemeinschaft und autoritärem Staatsverständnis auf der anderen.
Man hat die fatalen Fehler der Sozialdemokraten von 1918/19 damit entschuldigt, dass sie sich in einer revolutionären Situation befanden, in der man sich die Bündnispartner nicht immer aussuchen kann. Tatsächlich haben sich die sozialdemokratischen Akteure von 1919, die Eberts und Noskes, die Auers und Hoffmanns, für besonders schlau gehalten, als sie sich rechtsradikaler Kräfte bedienten, um den Machtkampf mit Spartakisten und Kommunisten für sich zu entscheiden. In Wirklichkeit betrieben sie aber deren Geschäft. Nationalkonservative, Reaktionäre und Rechtsputschisten konnten sich im Sessel zurücklehnen und abwarten, bis Sozialisten, Liberale und Demokraten sich selbst zerlegten.
Heute buhlen nicht nur Rechtsausleger in der Union, sondern auch desorientierte Sozialdemokraten um die Stimmen derer, die populistischen Parolen folgen. Die aber, die man beschönigend ›Populisten‹ nennt, sind nicht einfach besorgte Bürger, die in der Flüchtlingskrise den Untergang des Abendlandes heraufdämmern sehen, sondern – in Deutschland und Österreich, in Italien und Frankreich, in Polen und Ungarn – politische Kräfte, die Hand an die Wurzeln der liberalen Demokratie und des aufgeklärten Rechtsstaats legen. Sie sind die wahre Bedrohung für Europa. Die Flüchtlingsfrage ist ein Thema, das uns lange beschäftigen und viel Kraft abverlangen wird. Mit billigen Parolen und panischen Aktionen ist sie nicht zu lösen, nur mit Ernsthaftigkeit, Aufklärung und politischer Orientierungshilfe. Historische Vergleiche sind oft schief. Trotzdem können uns Berlin und München 1919 eine Warnung sein.
Literaturhinweise
WILLY ALBRECHT: Landtag und Regierung in Bayern am Vorabend der Revolution von 1918. Berlin 1968.
MICHAEL APPEL: Die letzte Nacht der Monarchie: Wie Revolution und Räterepublik in München Adolf Hitler hervorbrachten. München 2018.
KARL-LUDWIG AY: Die Entstehung einer Revolution. Die Volksstimmung in Bayern während des Ersten Weltkrieges. Berlin 1968.
KARL BOSL (Hg.): Bayern im Umbruch. Die Revolution von 1918. Ihre Voraussetzungen, ihr Verlauf und ihre Folgen. München 1969.
TANKRED DORST (Hg.): Die Münchner Räterepublik, Zeugnisse und Kommentar. Frankfurt a. M. 1966.
HEINRICH HILLMAYR: Roter und weißer Terror in Bayern nach 1918. München 1974.
RALF HÖLLER: Das Wintermärchen: Schriftsteller erzählen die bayerische Revolution und die Münchner Räterepublik 1918/ 1919. Berlin 2017.
VICTOR KLEMPERER: Man möchte immer weinen und lachen in Einem: Revolutionstagebuch 1919. Mit einem Vorwort von Christopher Clark, Berlin 2015.
ALLAN MITCHELL: Revolution in Bayern 1918/ 1919. Die Eisner-Regierung und die Räterepublik. München 1967.
LUDWIG MORENT: Revolution und Räteherrschaft in München. München/ Wien 1968.
GERHARD SCHMALZE (Hg.): Revolution und Räterepublik in München 1918/ 19 in Augenzeugenberichten. Düsseldorf 1969.
HANSJÖRG VIESEN (Hg.): Literaten an der Wand. Die Münchner Räterepublik und die Schriftsteller. Frankfurt am Main 1980
VOLKER WEIDERMANN: Träumer - Als die Dichter die Macht übernahmen. Köln 2017.
W. G. ZIMMERMANN: Bayern und das Reich 1918-1923. München 1953.