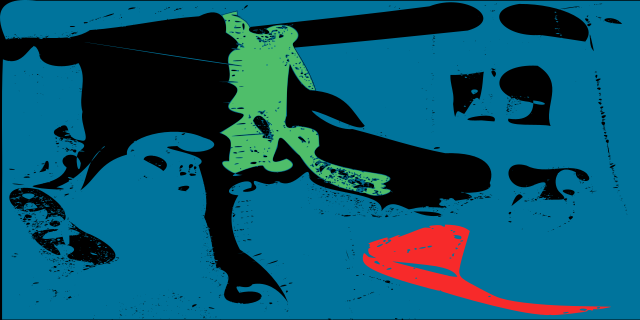von Peter Brandt
Wenn von den Protagonisten der sozialdemokratischen Deutschlandpolitik seit den 60er Jahren die Rede ist, wird Horst Ehmke meist nicht in der ersten Linie verortet. Hier soll auch nicht von seinem Beitrag zur operativen Ost- und Deutschlandpolitik gehandelt werden (der seinerseits durchaus der Würdigung wert wäre), sondern ich will Ehmkes Anteil an der konzeptionellen Begründung desjenigen entspannungspolitischen Ansatzes, der untrennbar insbesondere mit der ersten sozialliberalen Regierung verknüpft ist, und seine spezifischen grundsätzlichen Reflexionen zur »deutschen Frage« vor 1990 in den Blick nehmen.
Die 60er Jahre, in deren zweiter Hälfte Horst Ehmke in die Reihen der mitregierenden sozialdemokratischen Politiker aufrückte, waren das Jahrzehnt des schrittweisen Übergangs von der weltpolitischen Konfrontation – mit der Doppelkrise Berlin und Kuba als Höhe- und Wendepunkt – zum Arrangement der Supermächte und zur graduellen Entspannung zwischen den von ihnen geführten Paktsystemen. Für die deutsche Sozialdemokratie ergab sich ein zweifacher Anpassungsdruck. Zwar war auch die SPD der 50er Jahre nicht im eigentlichen Sinn »neutralistisch« gewesen, aber ihr Primat der Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands (von der man auch eine Verschiebung der gesellschaftspolitischen Achse nach links erwartete) hatte sie, fast verzweifelt, nach Lösungsmöglichkeiten suchen lassen, die die Wahrnehmung des Selbstbestimmungsrechts mit den Sicherheitsbedürfnissen der östlichen Siegermacht hätte vereinbar machen können. Ein Besuch Erich Ollenhauers und Carlo Schmids in Moskau im Frühjahr 1959, wo sie den SPD-»Deutschlandplan« diskutieren wollten, und dann die fehlgeschlagene Pariser Gipfelkonferenz vom Mai 1960 zusammen mit der offenkundigen Unwilligkeit der westdeutschen Wahlbevölkerung, das gesamtdeutsche Engagement der SPD zu belohnen, bewirkten dann das – wenn auch nicht vorbehaltlose – Einschwenken der Partei auf NATO-Loyalität und Westbindung.
Die »neue« Ost- und Deutschlandpolitik, die sich, zunächst noch begleitet von beinahe martialisch formulierten Ansprüchen auf die Grenzen von 1937, nach und nach herausbildete, im eingemauerten West-Berlin tastend erprobt und mit dem Dortmunder Parteitag 1966 für die Gesamt-SPD bestimmend wurde, beinhaltete den Abschied von der Vorstellung, für die »Wiedervereinigung« Deutschlands eine nationalstaatliche Sonderlösung finden zu können. Die Vereinigung sei nur noch als Ergebnis eines längeren, gesamteuropäischen, die Weltmächte einschließenden Prozesses denkbar, dessen Stufen nicht im einzelnen vorherzubestimmen seien. Innergesellschaftliche Veränderungen im Osten müssten von oben, seitens der regierenden Kommunisten, und mit Duldung der sowjetischen Führungsmacht erfolgen. In der europäischen Friedensordnung der Zukunft sollte dann auch das deutsche Volk selbstbestimmt über die Form seines Zusammenlebens entscheiden können.
Diese Zielorientierung lag dem Versuch der im Herbst 1969 gebildeten Regierung Brandt/Scheel zugrunde, die Beziehungen zu den »östlichen Nachbarn« einschließlich der DDR auf eine neue, vertraglich gesicherte Grundlage zu stellen und so einen längerfristigen Modus Vivendi zu schaffen. In diesem Sinne verteidigte Horst Ehmke, damals Leiter des Kanzleramts, in der Ratifizierungsdebatte am 23. Februar 1972 die Verträge mit der Sowjetunion und Polen in einer viel beachteten, argumentativ herausragenden Rede mit dem Motiv, die Ratifizierung sei »eine Frage des Friedens in Europa und der Chance, die weitere Vertiefung der Spaltung Deutschlands zu verhindern und die Spaltung dann langsam abzubauen.«
Die demagogischen Attacken und die teilweise paranoiden Unterstellungen aus Kreisen der CDU/CSU begleiteten die ost- und deutschlandpolitische Praxis der Bundesrepublik bis zum Regierungswechsel vom Herbst 1982, als die neue liberal-konservative Koalition trotz einiger anderer Akzentsetzungen im wesentlichen an der Linie der Vorgängerregierungen festhielt. Horst Ehmke hat sich in dieser Periode wiederholt, auch polemisch, mit der Diffamierung der Entspannungspolitik auseinandergesetzt, deren Wurzeln er im »deutsch-nationalen Konservativismus« des Kaiserreichs und der Weimarer Republik sowie in der ebenso weit zurückreichenden Tradition des »die Nation spaltenden Anti-Sozialismus der deutschen Rechten« sah (Sozialdemokratischer Pressedienst v. 26.05.1972).
In der von Jürgen Habermas 1979 herausgegebenen Bestandsaufnahme der gemäßigt-linken Intelligenz Westdeutschlands unter dem an Karl Jaspers’ Zeitdiagnose von 1931 angelehnten Titel »Stichworte zur ›Geistigen Situation der Zeit‹« setzte sich Ehmke unter der Arndtschen Gedichtzeile: »Was ist des Deutschen Vaterland?« mit den verschiedenen Dimensionen der »deutschen Frage« als Frage nach der Nation der Deutschen auseinander. In einer geistes- und politikgeschichtlichen Herleitung, die stark an die Konzeption des deutschen Sonderwegs in Europa angelehnt war – das soll hier nicht diskutiert werden –, führt der Autor den Untergang der Weimarer Republik und damit – indirekt – den Verlust der deutschen Einheit auf die »fragwürdige politische Tradition des deutschen Bürgertums« (S. 57) zurück.
Der Teilung Deutschlands im Ost-West-Konflikt ging die Zerstörung des republikanischen Nationalstaats und der von Hitler-Deutschland entfesselte Zweite Weltkrieg sowie der diesen begleitende Völkermord voraus. Deshalb werde die Zweistaatlichkeit von den Nachbarvölkern als in ihrem Interesse liegend gesehen. Die »europäische Dialektik« der deutschen Teilung bestünde indessen darin, dass sie von den europäischen Völkern, insbesondere den osteuropäischen, »mit dem hohen Preis der Teilung Europas bezahlt« (S. 60) werde. Es liege daher im Interesse der Deutschen, den gesamteuropäischen Prozess zu fördern, namentlich durch die immer engere Kooperation der westeuropäischen Gemeinschaft mit Osteuropa, um »Fortschritte in der deutschen Frage« zu erzielen. Ferner sei die mentale Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze in der ohne Friedensvertrag möglichen Form (wie im deutsch-polnischen Vertrag von 1970 geschehen) ebenso notwendig wie gute Beziehungen zur Sowjetunion und die Fortsetzung der Entspannung bzw. ihre Ausweitung auf das Feld der Rüstungskontrolle und Abrüstung.
Charakteristisch für Ehmkes Denkansatz ist die Hereinnahme der »inneren Dimension« der deutschen Frage in die Analyse – sie sei nicht weniger wichtig als die äußere. In der DDR werde der gesamtnationale Bezug – ungeachtet der seit 1970/71 propagierten Zwei-Nationen-Theorie – durch die aus der Strukturproblematik des Systems des »real existierenden Sozialismus« wie aus der direkten Nachbarschaft des größeren deutschen Staates gleichermaßen resultierenden inneren Schwäche des Regimes bewahrt, während in der Bundesrepublik die alles Nationale vermeintlich diskreditierende NS-Vergangenheit, der Wirtschaftsaufschwung und die Westintegration zum Bedeutungsverlust nationaler Werte und Gefühle geführt hätten, namentlich in der Jugend. Trotzdem bestünden über das Selbstverständnis der Bundesrepublik und – verbunden damit– über die »weiteren Perspektiven in der deutschen Frage« viele Unklarheiten. Eindeutig wendet sich der Autor nicht allein gegen Anklänge eines neuen, sich auf das Bismarckreich beziehenden deutschnationalen Geistes, sondern ebenso entschieden gegen einen speziell »bundesrepublikanischen Nationalismus« (»die letzte Perversion des nationalen Gedankens in unserer Geschichte«). Die »deutsche Frage« sei offen (S. 65).
Im folgenden unterscheidet Ehmke die staatliche Ebene – zwei in gegensätzliche Bündnisse eingebundene, in ihrem politischen und sozialen System grundlegend verschiedene Staaten einschließlich Berlins, eingeschränkt durch die Rechte der Siegermächte für »Deutschland als Ganzes«, von denen sich einer der beiden Staaten als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches verstehe, für sich (wie der andere schon früher) die polnische Westgrenze anerkannt habe und die innerdeutschen Beziehungen als »staatsrechtliches Verhältnis sui generis« definiere – von der ethnisch-kulturellen Ebene (»Volk«), ferner von dem »Selbstverständnis der Deutschen in Ost und West« als gemeinsame »Nation« in der staatlichen Trennung sowie vom »Vaterland« als »Siedlungs- und Wohngebiet einer Nation und ihrer Heimat im geistig politischen Sinn«, also einschließlich verlorener Gebiete sogar außerhalb der Grenzen von 1937. Die Substanz des Nationalen ist, neben der Gefühls- und Bewusstseinsgemeinschaft, für Horst Ehmke der durch die gemeinsame Geschichte fundierte »Wille, eine Nation zu bleiben und das einer jeden Nation zustehende Selbstbestimmungsrecht auch für sich in Anspruch zu nehmen«, sowie die Wahrnehmung der Verantwortung vor der gemeinsamen Vergangenheit.
Weitaus entschiedener als andere Verfechter der sozialdemokratischen Ost- und Deutschlandpolitik, die die Gesellschaftspolitik in ihren diesbezüglichen Stellungnahmen meist außer Acht ließen und allein auf der außen- und sicherheitspolitischen Ebene argumentierten, verknüpft Ehmke in seinem Beitrag von 1979 die Frage nach der Nation mit der Tradition und den Zielen der Sozialdemokratie, die er – in Westdeutschland wie darüber hinaus – an einer vermeintlich faktisch bereits eingeleiteten »Entwicklung in Richtung auf einen demokratischen Sozialismus« (S. 72) festmacht, einer Entwicklung, die weitgehend auch den Wünschen der Ostdeutschen entspreche. Diese wollten sich nicht einfach der Ordnung der Bundesrepublik anschließen.
Auch wenn eine Politik gezielter Destabilisierung des Ostens kontraproduktiv und gefährlich sei, dürfe nicht eine Stabilisierung der kommunistischen Regime, namentlich der DDR, angestrebt werden – »entgegen den Überzeugungen und Interessen der osteuropäischen Völker und unserer Landsleute« –, vielmehr gehe es dort um die Förderung gesellschaftlicher Reformen, auch durch eine fortgesetzte Politik des demokratischen und sozialen Fortschritts im Westen. Was Ehmke andeutet, ist ein Konzept dialektisch-emanzipatorischer Konvergenz, in dem die mit der Teilung Deutschlands eng verbundene Spaltung (durch »Abspaltung der deutschen Kommunisten von der demokratischen Arbeiterbewegung« und ihre anschließende Unterordnung unter die Bolschewiki) implizit perspektivisch in Frage gestellt wird. »So wie die Vergangenheit des Sozialismus nicht von der Entwicklung Deutschlands zu trennen ist, so wird die Zukunft der deutschen Nation nicht von der Entwicklung des Sozialismus zu trennen sein.« (S. 76)
Das am meisten beeindruckende Merkmal des Aufsatzes von 1979 ist die Verbindung von weitem Horizont mit gedanklicher Klarheit. Letzteres lässt sich meines Erachtens nicht in demselben Maß über den Essay »Deutsche ›Identität‹ und unpolitische Tradition« sagen, der in Nr. 4/1988 der Zeitschrift »Die Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte« erschien. Auch hier zeigt sich der in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen und in der Dichtung belesene, kritisch reflektierende Bildungsmensch. Abgesehen von einigen politisch-analytischen Passagen, die eng an den Text von 1979 anknüpfen, artikuliert der Artikel von 1988 – auf einem hohen intellektuellen Niveau – Ehmkes Unbehagen an einer vermeintlich verbreiteten nationalen Identitätssuche in der Bundesrepublik, die er unter Irrationalismusverdacht stellt, wobei er insbesondere nationalistische und antiamerikanische Tendenzen ausmacht.
Die »Frage der deutschen Nation« sei trotz der fortgeschrittenen Teilung und des unterschiedlichen Selbstverständnisses der Bundesrepublik und der DDR »nicht vom Tisch«, doch zieht der Autor es inzwischen vor, statt von »der« (höchst komplexen und mehrdimensionalen) »deutschen Frage« von »vielen deutschen Fragen« zu sprechen (S. 350). Auffällig ist, dass die in dem 1979er Aufsatz klar erkennbare langfristige Orientierung auf die – wie auch immer zu konstruierende und zustande kommende – staatliche Einheit Deutschlands, zumindest aber auf die selbstbestimmte Entscheidung der Deutschen darüber, nicht mehr zu erkennen ist. Unter Bezugnahme auf Richard von Weizsäckers Diktum, es gelte nicht, die Grenzen in Europa zu verändern, sondern, ihnen ihren trennenden Charakter zu nehmen, wird vor dem Hintergrund der Interessenlage der europäischen Staaten und der Supermächte festgestellt, dass die Deutschen »auf nicht absehbare Zeit nicht in einem Staat leben« würden (S. 362) – die damals auch rechts der Mitte überwiegende Einschätzung.
An diesen Irrtum will ich nicht aus Gründen nachträglicher Rechthaberei erinnern – die reale Entwicklung der Jahre 1989/90 ging über fast alle vorher angestellten Überlegungen hinweg –, sondern um festzuhalten, dass die – vermeintliche – innere Logik der sozialdemokratischen Ost- und Deutschlandpolitik (mit einer Tendenz zur Verabsolutierung eigentlich situationsbedingter Handlungsweisen) selbst einen für eindimensionales Denken so wenig Anfälligen wie Horst Ehmke dazu brachte, alternative Entwicklungsmöglichkeiten auszublenden. Anlässlich der Veröffentlichung seiner Memoiren, erschienen 1994 unter dem Titel »Mittendrin«, stellte Ehmke im Anschluss an die unzweideutige Verteidigung der Entspannungspolitik selbstkritisch fest, die SPD habe sich gegenüber den Bürgerrechtsbewegungen im Osten »selbst dann noch ›gouvernemental‹ verhalten, als sie nicht mehr an der Regierung war« (Sozialdemokratischer Pressedienst v. 10. 03. 1994).
Entsprechendes gilt, bezogen auf die Zeit der Ost-West-Teilung, für die manchmal regelrecht apodiktische Zurückweisung von »Spekulationen, zu welchen Formen deutschen und europäischen Zusammenlebens die Fortführung der Entspannungspolitik eines Tages führen kann« (S. 363 des Aufsatzes von 1988). Am 20. November 1989, elf Tage nach der Öffnung der Mauer in Berlin, schlug Horst Ehmke unter Rückkehr zur Berufung auf das Selbstbestimmungsrecht jedoch die schrittweise Bildung einer deutschen Konföderation vor, »die als Mittelstück gut in eine europäische Föderation passen würde« (Sozialdemokratischer Pressedienst v. 20.11.1989). Dieser Vorschlag erfolgte noch vor der Präsentation des Zehn-Punkte-Programms, mit dem Helmut Kohl am 28. November 1989 die deutschlandpolitische Initiative an sich riss, wurde aber nicht zu einem eigenen, sozialdemokratischen Deutschlandplan ausgebaut. Es zeigte sich jetzt, dass die SPD – analog zur vorherrschenden Tendenz in der Entwicklung der Gesamtgesellschaft Westdeutschlands – im Lauf der Jahrzehnte zu einer saturierten, »bundesrepublikanischen« Partei geworden war, deren Funktionärskörper und Mitgliedschaft mehrheitlich nicht imstande waren, sich mit der erforderlichen Schnelligkeit auf die neuen Umstände einzustellen.
Die SPD musste ihre Ost- und Deutschlandpolitik seit den späten 70er Jahren in Auseinandersetzung mit den USA und gegen den weltpolitischen Trend entfalten. Während in der Konfrontation mit der Reagan-Regierung (ab 1982 aus der Opposition heraus) wieder stärker das Ziel der Blocküberwindung und auf dem Weg dahin eine Reform des westlichen Bündnisses ins Auge gefasst wurden, hob man nach Osten hauptsächlich die stabilisierenden Elemente der Entspannungspolitik hervor. Am deutlichsten wurde das bei den Stellungnahmen zur Solidarność und zum Kriegsrechtsregime in Polen zu Beginn der 80er Jahre, aber auch bei den zurückhaltenden Reaktionen auf innere Repressionsmaßnahmen in der UdSSR und in der DDR. Je mehr die bipolare Blockarchitektur in Europa im Verlauf der 80er Jahre ins Wanken geriet, desto mehr war die SPD-Führung um eine friedliche, sozusagen geordnete Transformation der osteuropäischen Systeme besorgt. Schon seit Mitte der 60er Jahre war die Sowjetunion von sozialdemokratischen Sicherheitspolitikern realistischerweise eher als Status-quo-Macht, als imperialer, aber nicht expansiver Staat eingeschätzt worden. Die Möglichkeit, mit ihr als einer zum kontrollierten Wandel fähigen Großmacht zu kooperieren, lag der Vision einer gesamteuropäischen Friedensordnung zugrunde.
1977 beginnend, intensiver ab 1983 baute die SPD geregelte Parteibeziehungen zu den regierenden kommunistischen Parteien Osteuropas auf, namentlich zur KPdSU und zur SED. Diese ständig intensivierten Parteikontakte sollten nicht der Überwindung des sozialdemokratisch-kommunistischen Schismas dienen (obwohl sie zur Versachlichung der Diskussion erheblich beitrugen), sondern hauptsächlich der Förderung außen- und sicherheitspolitischer Gemeinsamkeiten, wie sie in der Formel Helmut Schmidts von der »Sicherheitspartnerschaft« Gestalt annahmen. Das gilt letztlich auch für das gemeinsame SPD-SED-Grundsatzpapier vom 27. August 1987. Außerdem – und damit eng verbunden – ging es um die teils direkte, teils indirekte Unterstützung innenpolitisch reformerischer Impulse aus den Parteiapparaten, die als Träger des angestrebten Auflockerungs- und dann auch Demokratisierungsprozesses in Ost- und Mitteleuropa nach den Erfahrungen der 50er Jahre (17. Juni, Ungarnaufstand) allein in Frage kämen.
Im Unterschied zu den 50er und 60er Jahren galt in den 80er Jahren die Teilung Deutschlands der SPD nicht mehr als eine der dringend zu beseitigenden, großen Spannungsursachen in Europa, sondern – was die Zweistaatlichkeit als solche betraf – sogar mehr und mehr als konstitutiv für den Fortgang des Entspannungsprozesses bis hin zur neuen europäischen Friedensordnung. Die sicherheitspolitische Zusammenarbeit von SPD und SED, wie sie sich etwa 1985 in dem Entwurf eines Abkommens über eine chemiewaffenfreie Zone in Mitteleuropa niederschlug, knüpfte an die veränderte Rolle beider deutsche Staaten in ihren Bündnissen an und wollte diese friedenspolitisch nutzen: Die ostdeutsche wie die westdeutsche Regierung hatten mit einer Art koordinierter Dämpfungspolitik dazu beigetragen, dass aus der Aufstellung neuer eurostrategischer Atomraketen in Europa kein zweiter Kalter Krieg geworden war.
Den Übergang zu Gorbatschows Neuem Denken erlebte die SPD-Führung durchaus zu Recht als Bestätigung ihrer eigenen außen- und sicherheitspolitischen Konzepte. Auf den Umschlag der (indessen verspätet einsetzenden) Reform von oben in die revolutionär-demokratische Massenbewegung in Ostdeutschland und anderswo 1989/90 war die SPD-Parteiführung offenbar nicht vorbereitet, auch wenn ihr die Zuspitzung der strukturellen ökonomischen Krise in der DDR und die dramatisch abnehmende Massenloyalität in der zweiten Hälfte der 80er Jahre nicht entgangen war.
Es war nicht der entspannungspolitische Ansatz der 60er und 70er Jahre als solcher, sondern seine – in Ehmkes Worten – »gouvernementale« Verengung, die die SPD angesichts der Massenerhebung gegen die Diktatur in der DDR und der nicht zuletzt von der Arbeiterschaft erzwungenen Vereinigung Deutschlands (in Formen und mit Folgen, die für die demokratische Linke höchst problematisch waren) zeitweise in die Desorientierung führte.)
(Der Text erschien zuerst unter dem Titel »Verbindung von weitem Horizont und gedanklicher Klarheit« in: Karlheinz Bentele, Renate Faerber-Husemann, Fritz W. Scharpf, Peer Steinbrück (Hgg): Metamorphosen. Annäherungen an einen vielseitigen Freund. Für Horst Ehmke zum Achtzigsten, Bonn 2007, S. 171-179)