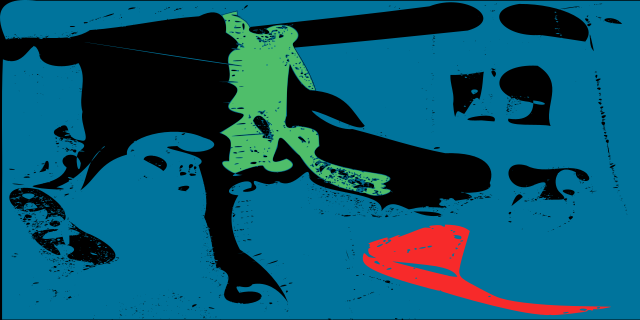von Nicolas Haesler
Angesichts der angespannten Migrationslage in Europa kennt das Thema Grenze zurzeit Hochkonjunktur in den Medien, Sozial- und Politikwissenschaften. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht über die tragische Situation der Menschen berichtet wird, die an den Außengrenzen des EU-Raumes blockiert und menschenunwürdigen Behandlungen ausgesetzt sind.
Tag um Tag erfahren wir mehr über die Verschärfung an Europas Grenzen und dabei scheint sich immer deutlicher das Bild einer »Festung Europa« (Der Tagesspiegel, 30. 08. 2015) zu offenbaren, die sich hinter Mauern (Courrier International, 07. 11. 2015) verbarrikadiert und dabei in nationale – zum Teil sogar nationalistische – und kurzsichtige Lösungsansätze verfällt, die im Widerspruch zu Robert Schumanns Projekt stehen. Dieser Mainstream-Diskurs stilisiert die Mauer zum Paradigma der Grenze, was aber von den Medien kaum kritisch reflektiert wird. Tatsächlich wird an Europas Grenzen vermehrt Stacheldraht eingesetzt, was keineswegs von einer materiellen Kontingenz zeugt, sondern zentrale Bedeutung für das Wesen von Europas Grenzregime hat.
Ausgehend von einer kurzen Geschichte des Stacheldrahtes möchte ich im folgenden Artikel zeigen, dass das materielle Fundament von Europas Abschrankungen Informationen über dessen Grenzverwaltung gibt. Gleichsam gilt es, dem Ansatz des französischen Philosophen Olivier Razac, der einen Paradigmenwechsel beim ›Denken der Grenze‹ suggeriert, Folge zu leisten (vgl. Razacs Artikel La gestion de la perméabilité; online auf l’espace politique), wobei nicht mehr die Mauer, sondern der Stacheldraht und der Checkpoint im Vordergrund stehen. Die Grenze sondert nicht ab, sondern wählt aus und der Stacheldraht ist das Instrument zur Verwaltung von deren Durchlässigkeit.
Die Geschichte des Stacheldrahtes ist eine Geschichte der Gewalt. Seine Nutzung ist seit jeher mit ganz spezifischen Gewaltpraktiken verbunden. Somit liegt die Annahme nahe, dass dieses Instrument seine intrinsische Brutalität dem Raum, den es teilt und aufgliedert, aufträgt. Stacheldraht wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Frankreich erfunden, aber in Amerika technisch verfeinert und auf industrielle Art und Weise hergestellt, nachdem das United States Patent Office am 24. November 1874 den Antrag des Farmers Joseph Farwell Glidden und dessen Stacheldrahtmodell gutgeheißen und somit einen langen und zähen Streit zwischen den verschiedenen Konkurrenten beendet hatte. Ab diesem Zeitpunkt wurde Stacheldraht in standardisierten Verfahren massenhaft hergestellt, denn die Nachfrage war gross und die Effizienz des Stacheldrahtes probat. Er wurde vor allem zur Einzäunung von Grundbesitz benutzt, einerseits von den zahlreich aus Europa immigrierenden Bauern, den grossen Viehbesitzern, welche die sogenannten cattle trails und sehr begehrten Weideplätze schützen wollten, und andererseits von den Bahnunternehmen, welche die bereits bestehenden Linien schützen und Land für den Ausbau des Bahnnetzes in Anspruch nehmen wollten. So kam es in Amerikas Great Plains unweigerlich zu einem Konflikt mit dessen Ureinwohnern und den herkömmlichen Landwirtschafts- und Viehzuchtformen dieser Region. Sowohl die Indianer als auch die open range Züchter – das bedeutet Viehzucht auf freiem Feld unter der Obacht eines Cowboys – wurden von der sesshaften Landwirtschaft, der modernen Longhorn Zucht und den Bodenerwerbungen durch Bahnfirmen immer weiter in unfruchtbare Regionen zurückgedrängt, ausgegliedert und schlussendlich wirtschaftlich und sozial ausgelöscht. Dabei fungierte Stacheldraht nicht nur als Instrument der gewaltsamen Teilung, sondern ebenfalls als Markierer von Privatbesitz, der zuletzt auch mittels militärischer Gewalt geschützt wurde, wie zum Beispiel im sogenannten Stacheldrahtkrieg von 1882 bis 1883, bei dem sich private Grundbesitzer und frei umherziehende Viehzüchter Scharmützel lieferten.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts vollzog sich der Transfer des Stacheldrahtes von der landwirtschaftlichen zur militärischen Nutzung. Er wurde zuerst im Rahmen kolonialer Konzentrationslager angewandt wie zum Beispiel auf Kuba, in Südafrika und Deutsch Südwestafrika (diesbezüglich empfiehlt sich die kürzlich erschienene Studie von Jonas Kreienbaum, Ein trauriges Fiasko. Koloniale Konzentrationslager im südlichen Afrika 1900 – 1908, Hamburg, Hamburger Edition, 2015). Die operative Anwendung im Rahmen kriegerischer Auseinandersetzungen begann jedoch erst mit dem russisch-japanischen Krieg von 1904/05 – vor allem während der Schlacht um Port Arthur – und dann vor allem in Europas Schützengräben zwischen 1914 und 1918. Dort prägte der Stacheldraht wie kaum ein anderer Gegenstand das Kriegsgeschehen. Er wird sogar so eng mit dem Ersten Weltkrieg in Verbindung gebracht, dass er kaum differenziert wahrgenommen und thematisiert wurde. Er prägte auf grausame Art und Weise das Massensterben auf dem No Man’s Land. Die Mehrheit der Durchbruchversuche und sogenannten Entscheidungsschlachten der Jahre 1915 bis 1917 scheiterten an den soliden Drahthindernissen und den dahinter verborgenen Maschinengewehren. Diese taktische Blockierung konnte grundsätzlich erst ab Ende 1916 und mit dem ersten Einsatz von Panzern überwunden werden. Ferner hinterließ der Stacheldraht ein diskretes und dennoch prägendes Zeichen in den soldatischen Erlebnisberichten. So schätzten die Soldaten den Erfolg oder Misserfolg eines Angriffs an der Solidität eines Stacheldrahtverhaues ein, schilderten das – relative – Sicherheitsgefühl hinter einem soliden Drahtverhau, mussten sich aber beim Anblick der darin hängen gebliebenen Kadavern ihren eigenen möglichen Tod permanent vergegenwärtigen. In jedem Fall gehörte er einfach, man müsste fast sagen intrinsisch, zur Kulisse des Krieges.
Noch radikaler wird die Gewaltgeschichte des Stacheldrahtes mit seiner Anwendung in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern. Dort fungierte er als archetypischer Baustein der Lagerarchitektur, die er durch seine Leichtigkeit, Polyvalenz und Effizienz in ihrer Grundform prägte. Vor allem in den Vernichtungslagern der Aktion Reinhardt – Belzec, Sobibor und Treblinka – ist er der zentrale Bestandteil, der die räumliche Anordnung der ›genozidären‹ Maschinerie prägte und auf diese Weise ermöglichte. Denn der Stacheldraht ermöglichte sowohl den Bau eines Areals, in dem die Häftlinge schnell und diskret in die Gaskammern geschleust werden konnten, als auch dessen schnellen und spurlosen Abbau. Sind die Mauern von Auschwitz heute noch sichtbar, so blieb von den Vernichtungslagern keine Spur übrig. Aber selbst in den restlichen Konzentrationslagern bildete der Stacheldraht das zentrale Element der räumlichen Anordnung, ja er ermöglichte sogar die Anpassung, Gliederung und Erweiterung der Anlagen. Natürlich bilden die Gewaltpraktiken und Methoden das Wesen der Konzentrationslager. Man kann aber behaupten, dass erst mit Stacheldraht ein Raum zu einem Konzentrationslager wurde. Das Beispiel des KZ Bremen-Ochtumsand illustriert dies ganz deutlich. Im Laufe des Monats September 1933 wurden im Zuge der nationalsozialistischen Machtergreifung auf einem gratis zur Verfügung gestellten Schleppkahn auf der Ochtum, ein Nebenfluss der Weser, politische Häftlinge eingesperrt. Der Kahn wurde von einer dreißig Mann starken SA-Truppe bewacht und von einem mannshohen Stacheldrahtzaun umgeben. Ein kleiner Wachturm auf dem Vorderdeck ermöglichte die Überwachung des gesamten Kahns. Auf diesem so entstandenen KZ wurden die Häftlinge benutzt, um den abgelagerten Sand in der Ochtum zu beseitigen. Neben dieser harten Arbeit und den rauen Wetterbedingungen waren sie der Willkür und Brutalität der SA-Wachmannschaft schutzlos ausgeliefert. Im Zuge der Modernisierung und Zentralisierung des Systems der Konzentrationslager wurde das KZ Bremen-Ochtumsand wie viele andere sogenannte ›wilde Lager‹ geschlossen und der Kahn höchst wahrscheinlich verschrottet (vgl. dazu Benz, Wolfgang, Distel, Barbara (Hgg.), Der Ort des Terrors, München, Beck, 2005-2008, Bd. 2, S. 79-80). Selbstverständlich erklärt der Stacheldraht allein nicht die spezifische Gewaltpraktik der NS-Inhaftierungspolitik. Doch rein baulich machte erst der Stacheldraht den Kahn zu einem Lager, in dem politische Häftlinge zusammengepfercht und einer permanenten Kontrolle unterworfen wurden.
Eine zusätzliche Verschärfung erfahren die Stacheldrahtzäune in den modernen Konzentrationslagern durch deren Elektrifizierung. Somit gestaltete sich Stacheldraht nicht nur noch bloss als passendes Instrument zur topographischen Anordnung, sondern auch als Instrument des Terrors und des Todes. Quellenberichte weisen nach, wie Häftlinge schikaniert wurden indem SS-Schutzmänner deren Kopfbedeckung in den elektrisch geladenen Draht warfen. Dabei hatten sie die Wahl zwischen wiederholter Prügel wegen ›nicht ordnungsgemäßer Kleidung‹ – auch ›Kleidersabotage‹ genannt – oder dem Tod beim Versuch, ihre Mütze wieder zu holen. Entweder wurden sie durch einen Stromschlag getötet oder beim Betreten der sogenannten verbotenen ›Todes- oder neutralen Zone‹ von einem Wachtmann wegen Fluchtversuches erschossen. Dabei kam es oft zu Absprachen zwischen den SS-Männern, die durch solche Erschießungen Ferien oder besseren Sold bezogen (vgl. dazu Richardi, Hans-Günter, Schule der Gewalt. Dachau 1933 – 1934, München, Beck, 1983). Im Gegensatz dazu kam es auch teilweise vor, dass Häftlinge sich selbst in den elektrischen Draht stürzten und somit den erlösenden Freitod wählten.
Während des Kalten Krieges wurde Stacheldraht weiterhin oft benutzt. Er wurde angewandt um Demarkationslinien – wie zum Beispiel in Korea und Vietnam - und Grenzschutzanlagen – wie zum Beispiel die Grenze zwischen Osten und Westen – zu befestigen. Dabei wurde seine Anwendung stets von bereits bekannten Gewaltpraktiken begleitet, wie zum Beispiel dem Erschießen von Flüchtlingen an der Berliner Mauer – wo die Mauer so quasi den Kern des Trennungsdispositivs darstellte, aber vor ihr eine Reihe von Stachel- und anderswertigen Drahtverhauen installiert waren – oder der Erhalt von Prämien pro Todesschuss an der bulgarischen Demarkationslinie zwischen Osten und Westen. So sind gemäß eines Artikels von Stefan Appelius im Spiegel bis 1989 etwa 600 bis 800 sogenannte ›Republikflüchtlinge‹ im Niemandsland zwischen Osten und Westen ums Leben gekommen und in der Grenzzone anonym verscharrt worden (Spiegel, 07. 11. 2007). Ferner wurde Stacheldraht auch im Rahmen asymmetrischer Kolonialkriege benützt, so zum Beispiel während des Algerienkrieges. Dabei sollte er vor allem die Mobilität der Guerillaeinheiten – eine Strategie, die bereits von der britischen Armee während des Burenkrieges von 1899 bis 1902 in Südafrika angewandt wurde – erschweren, der Kontrolle der Zivilbevölkerung dienen und dadurch den Guerillakämpfern den Rückhalt bei den Bewohnern nehmen. So erstellte die französische Armee während der Schlacht um Algier von September 1956 bis September 1957 beispielsweise Stacheldrahtverhaue und Check-Points rund um die Kasbah, die Altstadt Algiers. Diese im Militärjargon realisierte ›Quadrierung‹ des Landes ermöglichte es der Kolonialmacht ganze Regionen in den Ausnahmezustand zu versetzen, und die sich darin befindenden Menschen als mögliche Widerstandskämpfer zu kontrollieren, zu verhaften oder sogar zu töten. Dabei sollte aber möglichst auf rigide und aufwendige Kontrolldispositive verzichtet werden, die zum Beispiel die Wirtschaft beeinträchtigt hätten. Die Menschen konnten weiterhin zirkulieren und ihren Handel tätigen, waren aber ständigen Kontrollen und zum Teil willkürlicher Brutalität ausgesetzt. Gleichsam konnte der Stacheldraht, im Rahmen einer Grenzschutzfunktion auch ein tödliches Instrument der Guerillabekämpfung werden. Das war zum Beispiel an der Ligne Morice an der algerisch-tunesischen Grenze während des Algerienkrieges mit der Fall. Minen, Selbstschussanlagen und elektrifizierter Stacheldraht gestalten den Übergang der Grenze als schwieriges und potenziell tödliches Unterfangen.
Im Hinblick auf diese kurze Geschichte des Stacheldrahtes verdeutlicht sich das Gewaltpotenzial, das in diesem Gegenstand liegt. Das Objekt wirkt sowohl durch reale wie auch angedrohte Gewalt mittels seiner Dornen oder rasierscharfen Schneiden. Seine Installation deutet aber auch auf eine Politik brutaler räumlicher Kontrolle hin, die noch weitere Eigenschaften offenbart. Stacheldraht weist als Instrument der räumlichen Aufteilung ganz bestimmte Vorteile gegenüber der Mauer auf. Zum einen ist er viel billiger, passt sich jeglicher Form von Topographie an, ist schneller installiert und abmontiert. Gemäss der Zeitung Le Temps vom 25. September 2015 wurde diese Mobilität vom ungarischen Premierminister Viktor Orban als Argument benutzt, um die europäische Kritik an der Erweiterung des Zauns an der slowenischen Grenze zu entschärfen. Zum anderen ist Stacheldraht ein aktives bzw. dynamisches Grenzdispositiv. Da er im Grunde genommen nicht unüberwindbar ist, bedarf der Stacheldraht immer einer menschlichen Kontrolle. Diese fehlende Unüberwindbarkeit belegen zum Beispiel Quellen aus dem KZ Dachau, die von geglückten Ausbrüchen durch den elektrifizierten Stacheldraht berichten. Auch jüngere Ereignisse wie der Durchbruch mehrerer hundert Flüchtlinge in der spanischen Exklave Melilla (vgl. den Beitrag in der Tageszeitung vom 18. 03. 2014) im Jahre 2014 illustrieren die Überwindbarkeit noch so großer und ausgefeilter Drahthindernisse. Stacheldraht fungiert also als Grenz- und Schutzdispositiv, das seinerseits von Wachtmännern beschützt werden muss. Dies mag auf den ersten Blick paradox erscheinen. Bei genauerer Betrachtung aber dient dieser Sachverhalt einer subtilen Kontrolle, die Gewaltanwendung und Gewaltlegitimation ohne Blockierung menschlicher Mobilität ermöglicht. Denn Stacheldraht signalisiert und grenzt einen verbotenen oder zumindest restriktiven Raum ab, dessen Zugang an ganz bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Durch seine Anwesenheit und seine potenzielle Überwindbarkeit wird die mögliche Verletzbarkeit dieser Grenze, und somit das mögliche unerlaubte Betreten eines bestimmten Raumes bereits vorweggenommen. Anders formuliert: Stacheldraht schafft a priori Raumverletzung und setzt somit a priori die Grundlage zur Anwendung von Gewalt, um diese Grenze zu schützen. Stacheldraht rechtfertigt nicht Gewalt a posteriori sondern legitimiert sie a priori. Dieses Gewaltpotenzial ist nicht zu unterschätzen. Es ist sogar so wichtig, dass der Forscher Ernesto Kiza im Rahmen seiner Dissertation geprüft hat, ob tödliche Gewaltanwendung nicht intrinsisch zum europäischen Grenzregime gehört (vgl. Kiza, Ernesto, Tödliche Grenzen – Die fatalen Auswirkungen europäischer Zuwanderungspolitik, Wien, Lit Verlag, 2007).
Es gibt also keine unüberwindbare Grenze. Wer aber einen Stacheldrahtzaun überwindet, stellt sich de facto in die Illegalität. Seine Anwesenheit in einem bestimmten Raum ist illegal, illegitim und demnach rechtlos. Die illegalen Einwanderer werden also nicht nur aus dem Rechtssystem ausgeschlossen, sondern auch noch zu Kriminellen stigmatisiert, die eine rechtswidrige Tat begangen haben. Sie sind von diesem Moment an in einem rechtlosen Raum, können ausgeschlossen, eingesperrt, zurückgewiesen, brutalisiert oder ›schwarz‹ beschäftigt werden. Dieser Gedanke kann weiter gesponnen und um eine anthropologische Dimension erweitert werden, betrachtet man die Flüchtlinge als Projektionsfläche unserer eigenen Ängste. Die Angst vor dem Fremden, dessen massiver Andrang die Furcht noch verstärkt, kombiniert mit der Verletzung scheinbar legitimer aber fragiler Grenzen führt zu einer ablehnenden Haltung ihnen gegenüber und kann auch durchaus zu deren Ausschluss aus unserem moralischen Referenzrahmen führen. Somit werden diese Flüchtlinge nicht nur als reale Bedrohung sondern auch in ihrer radikalen Andersheit als amoralische Menschen wahrgenommen.
Die Frage, die man sich jetzt stellen muss lautet, was mit diesem Grenzdispositiv, bei dem Gewaltanwendung und Durchlassbarkeit eigentlich zusammenhängen, bezweckt wird. Es geht um Souveränität, besser gesagt um die Kontrolle über Menschen durch den Raum, den sie durchqueren. In einem vor kurzem erschienen Artikel schrieb der Philosoph Armen Avanessian: »Souverän ist […] wer Kontrolle über den Transit hat, wer also über Produktion sowie Einfuhr und Ausfuhr von Gütern und Menschen entscheidet« (Die Zeit online, 19. September 2015). Und dabei kommt gerade die Vorzüglichkeit des Stacheldrahtes voll zum Zuge. Anstatt Grenzen dicht zu schließen und menschliche Migrationsbewegungen abzublocken, ermöglicht er ein dynamisches Öffnen und Schließen. So erklärte zum Beispiel der ungarische Botschafter in der Schweiz, Istvan Nagy, am 22. September 2015 dem Westschweizer Radio, dass Ungarn seine Grenzen nicht überall hermetisch schließe, sondern nur da, wo es keine Kontrolle über die Flüchtlingszuwanderung garantieren könne. Gemäß Nagy gibt es in Ungarn sieben Durchgänge, an denen Flüchtlinge nach Überprüfung und Aufnahme ihrer Personalien zugelassen oder abgelehnt werden. Das ist ein Beispiel dessen was in Frankreich die ›immigration choisie‹, also die ›gewählte Einwanderung‹ genannt wird.
Ob aus diesen Tatsachen eine soziale und wirtschaftliche Tendenz herausgelesen werden kann, der zufolge billige Arbeitskräfte nach Europa hereingelassen werden, um ein neues Konzept wirtschaftlicher Anstellungspolitik zu realisieren, sei dahingestellt. Die Vorstellung aber, dass sich in Europa der Kapitalismus zu einem System von ›working poors‹ entwickelt hat, das nun auf eine Masse armer Flüchtlinge zurückgreift, um den Druck auf die lokalen Arbeitnehmer zu erhöhen, die sogenannten Minijobs zu akzeptieren, lässt sich nicht einfach so von der Hand weisen. Frisst der Ultraliberalismus seine eigenen Kinder? Auf jeden Fall ist es zu einfach zu behaupten, dass Europa sich verbarrikadiere. Dieser Anschein wird vermittelt, um ein zwingendes Sicherheitsgefühl und das Bild von politischem Aktivismus zu schaffen. In Wirklichkeit aber werden die Grenzen durchlässig und flexibel gestaltet und verwaltet. Mittels Stacheldraht und Check-Points werden, was Olivier Razac ›biopolitische Räume‹ nennt, geschaffen. Das bedeutet kontrollierte Räume, in denen eine Masse kontrollierter Menschen stecken, die abgewiesen oder hereingelassen werden können. Je nach Bedarf eben und wenn ihre Anwesenheit nicht gerade selber zu einem lukrativen Markt wird, wie es das Beispiel der florierenden Bus- und Transportunternehmen in der serbischen Stadt Presevo zeigt (vgl. Le Temps, 2. Oktober 2015).
(Der Autor ist Doktorand an der Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Universität Zürich)