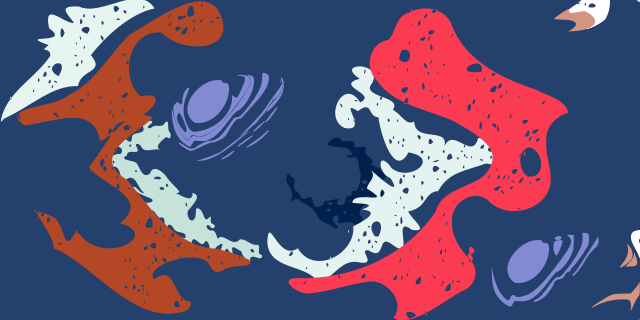Über verdrängte Zusammenhänge, ungestellte Fragen und unausgewertete Archivbestände
von Gregor Kritidis
In der alten Bundesrepublik wurde die zeitgeschichtliche Forschung von dem historisch-moralischen Imperativ mitbestimmt, dass nie wieder Krieg von deutschem Boden ausgehen sollte, dass es nie wieder ungebremsten Terror gegen die innere Opposition und Andersdenkende geben und sich der industriell organisierte Massenmord nie wiederholen solle.
Imperative, die auch in die Gründungsdokumente der zweiten Demokratie eingingen. Nach 1945 bemühte sich eine neue Generation von Wissenschaftlern, aus dem Bann der überlieferten Legitimationswissenschaften herauszutreten und die Ursachen für das Scheitern der Weimarer Republik aufzuklären und zu einer Konsolidierung demokratischen Denkens beizutragen (Bracher 1960; Berg 2003). Die Protestbewegung der späten 1960er Jahre verstärkte diese Dynamik, und es gelang Wissenschaftlern mit gesellschaftskritischen Ansätzen, sich an den Universitäten zu etablieren. Mit dem Fall der Mauer wichen diese für die alte Bundesrepublik prägenden Positionen einer Neubewertung. Angesichts der nun in allen Einzelheiten möglichen Analyse der SED-Herrschaftspraktiken verlor die zeithistorische Forschung ihren bisherigen Kompass und rückte die bundesdeutsche Vergangenheit in ein neues Licht: Hatte man in der Bundesrepublik doch aus der deutschen Geschichte gelernt und eine gefestigte Demokratie etabliert, galt es nun, die Erfahrungen mit dem ostdeutschen »Totalitarismus« aufzunehmen.
Während in Bezug auf Deutschland-West Modernisierung, Liberalisierung und Westernisierung zu Leitbegriffen avanciert sind und der Topos der »geglückten Demokratie« (Wolfrum) vorherrschend geworden ist – das hat sich anlässlich des 60. Jubiläums der Gründung der Bundesrepublik anhand der Thematisierung in den Medien deutlich gezeigt – ist die Forschung über die DDR für eine Neuorientierung der Geschichtswissenschaft bisher wenig ergiebig gewesen. Viele Arbeiten sind einem Verständnis von Totalitarismus verhaftet geblieben, das eher an antikommunistische Stereotypen der 1950er Jahre angeschlossen und nur das Gegenbild einer »verunglückten« (Volks-)demokratie gezeichnet hat (Hofmann 2007). Die in der Bundesrepublik vorherrschende Historiographie hat dadurch in Teilen einen ausgesprochen legitimatorischen Charakter bekommen, deren Widersprüche jedoch um so deutlicher zu Tage treten, je mehr der gesellschaftliche Kontext, auf den sie sich bezieht, verloren gegangen ist. Wesentliche Grundprinzipien wie das Asylrecht, das Verbot von Angriffskriegen und das Sozialstaatsgebot sind in den letzten 15 Jahren aufgeweicht und in ihrem Wesensgehalt ausgehöhlt worden (Hawel 2009a: 64-73). Der westdeutsche Sozialstaat der 1980er Jahre konnte noch mit einigem Recht behaupten, das bessere Gesellschaftsmodell darzustellen; die zunehmende Einschränkung sozialer und politischer Partizipationsmöglichkeiten hat nun diese Gewissheit ins Wanken gebracht. Die These von der Kontinuität einer erfolgreichen Nachkriegsdemokratie hat lange die Erosion des demokratischen Verfassungsstaates verdeckt und eine Reflexion auf die Voraussetzungen und Bedingungen demokratischen Handelns verhindert. Mittlerweile ist jedoch eine ganze Reihe von Arbeiten vorgelegt worden, welche die bisherigen Dogmen implizit oder explizit in Frage stellen (Hawel 2009b).
Die vorherrschende Zeitgeschichtsschreibung hat in der Tendenz ihre Orientierung und somit auch ihre orientierende Funktion verloren; aus der Position, man habe aus der Geschichte gelernt und die richtige Einsicht in die gesellschaftliche Praxis überführt, lässt sich keine kritische Urteilskraft schöpfen, geschweige denn irgendeine programmatische Überlegung für die Zukunft entwickeln (Geppert/Hacke 2008). Im Gegenteil ist damit eine Zerstörung von Wirklichkeit impliziert, also dem Gegenstand der Zeitgeschichte: Je mehr die zeithistorische Forschung kritische Fragen unterlässt, desto stärker kommt sie in Bereiche, in denen gängige Deutungsmöglichkeiten nur um den Preis der Negierung ihrer empirischen Grundlage aufrechterhalten werden können. So dürfte nicht überraschen, dass gegenwärtig weder in der herrschenden Lehre noch in ihrer medialen Rezeption wesentliche Aspekte der deutsch-deutschen Geschichte auch nur eine angemessene Erwähnung finden. So wird beispielsweise der sozialistische Charakter der Gründungsphase der Bundesrepublik weitgehend ausgeblendet, und die Rolle der westdeutschen Opposition der 1950er Jahre, deren Einfluss nur durch einen rigiden, rechtsstaatlichen Maßstäbe negierenden Antikommunismus begrenzt werden konnte, gerät zur historischen Randerscheinung. Weitgehend bagatellisiert wird in diesem Zusammenhang die justizförmige Verfolgung der KPD, die in ihrer Wirkung auf das innenpolitische Klima kaum überschätzt werden kann.
Die »geglückte Demokratie« ist keinesfalls das Resultat eines Erfolges, sondern einer Niederlage der demokratischen Kräfte in Deutschland, deren Konzeption eines sozialistischen Gesamtdeutschlands sich nicht realisieren ließ. Dieser demokratisch-sozialistische Charakter der nur als Provisorium geplanten westdeutschen Staatsgründung hat vor allem in den Sozialisierungsartikeln der Länderverfassungen, aber auch in Artikel 15 sowie dem Sozialstaatsgebot im Grundgesetz seinen weithin verdrängten Niederschlag gefunden. Nicht nur SPD, KPD und Gewerkschaften, auch große Teile der CDU traten für eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Neuordnung ein. Die Frankfurter Leitsätze der CDU tragen die demokratisch-sozialistische Handschrift eines durch die Erfahrung des faschistischen Terrors radikalisierten Sozialkatholizismus. Bei der Gründung der Bundesrepublik war noch bis in die Reihen bürgerlich-liberaler Kräfte gegenwärtig, dass die kapitalistische Großbourgeoisie samt ihres kleinbürgerlichen Anhangs wesentlicher Träger des NS-Regimes gewesen war und folglich ihre soziale Herrschaftsposition gebrochen werden müsse. Das Ahlener Programm der CDU von 1947 beginnt mit der Feststellung: »Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden, um im Folgenden die Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien und der Großbanken zu fordern.« (Flechtheim 1963:53). Diese Forderungen der CDU von 1947 enthielten die Vorstellungen des christlichen Sozialismus nur noch in abgeschwächter Form, würden sich aber aus Sicht heutiger CDU-Politiker bereits im Bereich der Verfassungsfeindlichkeit bewegen (Schünemann 2008).
Erst durch die Intervention der westlichen Alliierten, die aus naheliegenden Gründen kein Interesse an einem unabhängigen demokratisch-sozialistischen Gesamtdeutschland hatten, wurde diese Entwicklung gestoppt (Schmidt 1970). Es ist bezeichnend für das Bewusstsein der Arbeiterschaft, dass die Bodenreform und die Enteignung der Großindustrie bei Volksabstimmungen in Sachsen und Thüringen breite Mehrheiten fanden. Die Sowjetunion hatte aber ebenso wenig Interesse an einer eigenständig agierenden Arbeiterbewegung wie die Westalliierten. In stiller Eintracht wurden die nach 1945 gebildeten Antifaschistischen Komitees von allen Besatzungsmächten aufgelöst. Der beginnende Kalte Krieg schuf die Grundlagen, die gesamtdeutsch orientierten sozialistischen Kräfte zurückzudrängen. Während sich in der SBZ die Gruppe Ulbricht gestützt auf die sowjetische Besatzungsmacht konsolidieren konnte, schuf im Westen der auch von der Sozialdemokratie geteilte Antikommunismus die Voraussetzungen für eine Rückkehr der alten Eliten in die gesellschaftlichen Machtpositionen. Bereits 1950 sprach der Linkskatholik Walter Dirks von einer Restauration der alten gesellschaftlichen Machtverhältnisse und schuf damit einen Begriff, der bis heute wie ein Stachel im Fleisch der herrschenden Geschichtsschreibung sitzt (Fröhlich 2008). Denn im Begriff der Restauration ist die Alternative einer anderen Republik aufgehoben, die Alternative zur deutschen und europäischen Teilung in sich feindlich gegenüberstehende Blöcke (Kritidis 2008:17ff.).
Gegen die restaurativen Tendenzen blieben die demokratisch-sozialistischen Kräfte eine starke Macht sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR. Bereits 1958 hat Benno Sarel, zeitweise Mitarbeiter der von Willy Huhn redigierten rätesozialistischen Zeitschrift Pro und Contra und später Mitglied der französischen Gruppe Socialime ou Barbarie um Cornelius Castoriadis (Gabler 2009), eine glänzende Analyse der Arbeiterbewegung vor und nach dem 17. Juni 1953 vorgelegt, welche die Dynamik der ostdeutschen Klassenkämpfe nachzeichnet (Sarel 1975; bezeichnenderweise ist dieses Buch in den Forschungen zum 17. Juni vollkommen ignoriert worden). Und in der Bundesrepublik konnte die Macht der Arbeiterorganisationen nur mit Mühe in der Auseinandersetzung um die Wirtschaftsverfassung und die Westintegration respektive Wiederbewaffnung gebrochen werden. Es ist jedoch charakteristisch, dass einer der wichtigsten Vordenker einer sozialistischen Neuordnung, Viktor Agartz, nur noch am Rande Erwähnung findet. Agartz, ein enger Wegbegleiter Hans Böcklers, war Wirtschaftsminister der Bizone und Gründer des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts des DGB (WWI), Anfang der 1950er Jahre der zentrale gewerkschaftliche Think-Tank. In einer bis heute unaufgeklärten Briefaffäre wurde er 1955 kaltgestellt, 1958 wurde ihm gar mit dem Vorwurf des Landesverrates der Prozess gemacht. Trotz eines Freispruchs in diesem vielleicht wichtigsten politischen Prozess der frühen Bundesrepublik – als Zeugen sagten prominente Linkssozialisten wie Wolfgang Abendroth, Theo Pirker und Leo Kofler aus – war Agartz in der Öffentlichkeit nachhaltig als kommunistischer fellow-traveller diskreditiert.
Wie auch immer man das Gewicht der von Agartz, Abendroth und anderen repräsentierten Strömung innerhalb der Arbeiterbewegung bewerten mag – übergehen kann man sie eigentlich nicht. Dass dies jedoch weitgehend geschieht, lässt sich an zwei Beispielen illustrieren: In der kaum noch erwähnten, geschweige denn zitierten Heinemann-Biographie von Diether Koch aus dem Jahre 1972 wird Agartz nur an einer Stelle erwähnt, Abendroth überhaupt nicht (Koch 1972). Dabei hatte Gustav Heinemann nicht nur mit Agartz studiert, sondern ihn auch als Anwalt im besagten Landesverrats-Prozess verteidigt. Nun mag es 1972 nicht opportun gewesen sein, die Kontakte des Bundespräsidenten zur linkssozialistischen Opposition zu thematisieren. Heute braucht man keine derartigen Rücksichten zu nehmen, zumal über den Agartz-Prozess eine zweibändige, allerdings ebenfalls auch kaum noch erwähnte Studie vorliegt, die ein grelles Licht auf die »demokratischen« Praktiken der 1950er Jahre gegen Oppositionelle wirft (Treulieb 1982). Diether Posser, der Agartz zusammen mit Heinemann vertrat, hat in diesem Zusammenhang von einer Art Bürgerkriegsjustiz gesprochen. In Wolfrums Geglückter Demokratie (2006), und das ist durchaus exemplarisch für die vorherrschende Geschichtsschreibung, wird der Agartz-Prozess trotz seiner zentralen innenpolitischen Bedeutung nicht erwähnt.
Überhaupt bleibt der Antikommunismus in seinen Dimensionen und weitreichenden Folgen in den meisten Darstellungen ein blasses Phänomen. Offenkundig spielt dabei eine Rolle, dass es im offiziellen Selbstbild der Bundesrepublik keine Justizverbrechen in den 1950er Jahren gegeben hat – bis heute sind die kommunistischen Opfer der ehemaligen NS-Richter in der Bundesrepublik noch nicht rehabilitiert worden (Korte 2009). In Bezug auf die Frage der demokratischen Entwicklung Westdeutschlands ist die Frage des Antikommunismus jedoch von zentraler Bedeutung. Jürgen Seifert hat darauf verwiesen, dass in der Ära Adenauer jegliche Gesellschaftskritik von vornherein dem Verdacht ausgesetzt war, letztlich dem Ostblock in die Hände zu spielen. Er schreibt: »Wer die persönliche Berührung mit Kommunisten nicht scheute, wurde verdächtigt, bloß weil er Kontakt hatte (Kontaktschuld). Wer Argumente vertrat, die Kommunisten auch vertraten, dem wurde (ohne sich mit dem Argument auseinanderzusetzen) Konsensschuld vorgeworfen. Jede kritische Position wurde ausschließlich daran gemessen, wem nützt sie, cui bono: dem Westen oder dem Osten?« (Seifert 1989:25). Der Antikommunismus, so Seifert, stellte die Verfassungsrealität Westdeutschlands dar. In seinen Auswirkungen auf alle Dimensionen des politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens ist die antikommunistische Ideologie bisher noch nicht untersucht worden; dabei ist ihre Entlastungsfunktion für ehemalige NS-Täter und –Mitläufer ebenso offensichtlich wie ihr Beitrag zur Restauration eines autoritären Obrigkeitsstaates sowie eines kulturellen Klimas der Bigotterie und Spießigkeit (Kraushaar 1997:60-69). Dieser blinde Fleck der zeitgeschichtlichen Forschung korrespondiert mit einer oberflächlichen Verwendung des Begriffs der Liberalisierung, der zwar für einzelne soziale Teilbereiche, keinesfalls jedoch für die westdeutsche Gesellschaft in toto in Anschlag gebracht werden kann. Erhellend ist hier die Debatte um die Entschädigung der in den 1950er und 1960er Jahren misshandelten Heimkinder, deren Schicksal bis in die letzten Jahre von offizieller wie von wissenschaftlicher Seite weitgehend ignoriert worden ist, obwohl seit den späten 1960er Jahren – erinnert sei hier an die einschlägige Reportage von Ulrike Meinhof sowie an die Heimkampagne der APO – das Problem bekannt gewesen und in den 1970er Jahren Gegenstand umfangreicher pädagogischer Reformbemühungen gewesen ist (Wensierski 2006).
In der Forschung wird der kalte Bürgerkrieg im inneren mit seinen fatalen langfristigen Folgen für die demokratische Struktur sowie die politische Kultur in Westdeutschland mehrheitlich nur randständig behandelt – dabei handelt es sich um das zentrale innenpolitische Konfliktfeld, da der Antikommunismus keineswegs vorrangig auf die KPD, sondern auf die westdeutsche Opposition insgesamt zielte. In den letzten 20 Jahren sind zwar zahlreiche Studien über die DDR-Staatssicherheit erschienen, kaum jedoch Publikationen über die Verfassungsschutzämter in den 1950er und 60er Jahren – und wenn, weisen sie quellenbedingt große Lücken auf wie die einschlägige Darstellung von Wolfgang Buschfort über die Gründung des Amtes für Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen: So wurden die Akten über die FDP sowie die Gesamtdeutsche Volkspartei (GVP), an deren Spitze Heinemann und Posser standen und in der Johannes Rau seine Karriere begann, nicht einbezogen. War die FDP wegen der in ihr arbeitenden NS-Seilschaften zum Objekt der Überwachung geworden, geriet die GVP wegen ihrer deutschlandpolitischen Konzeption ins Fadenkreuz ihrer politischen Gegner. Vermutlich hat Posser, als dieser als Innenminister oberster Dienstherr des Landesamtes für Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfahlen war, die entsprechenden Aktenbestände aus der Behörde entfernt. Gleiches gelte für die Akten der FDP, wie Buschfort vermutet. Offenbar verspürten die Minister wenig Neigung, dem politischen Gegner die Gelegenheit zu geben, mit Halbwahrheiten aus trüben Quellen zu operieren (Buschfort 2004). Über die Überwachung des linkssozialistischen Spektrums in und außerhalb der SPD oder des linksprotestantischen und linkskatholischen Spektrums gibt es für die 1950er und frühen 60er Jahre bisher keine Untersuchungen. Viktor Agartz, Theo Pirker, Peter von Oertzen, Wolfgang Abendroth und Manfred Heckenauer u.a. haben darauf hingewiesen, dass sie zeitweise von Verfassungsschutzämtern überwacht worden sind. In Stephan Glienkes Studie über die Ausstellung Ungesühnte Nazi-Justiz (Glienke 2008) wird erwähnt, dass nicht nur deren maßgeblicher Urheber Reinhard Strecker und seine Kommilitonen aus dem SDS, sondern auch Studenten aus dem Liberalen Studentenbund sich im Visier der Geheimdienste befanden. Über die Bespitzelung des SDS durch die Stasi und den Verfassungsschutz hat Bernd Rabehl eine Studie vorgelegt, aus der hervorgeht, dass aus den Akten des Verfassungsschutzes große Teile entfernt worden sind (Rabehl 2000: 111). Rabehl hält sich bei der Kommentierung der verschiedenen Geheimdienst-Berichte deutlich zurück, so dass zunächst kein Anlass besteht, diese Angaben in Zweifel zu ziehen.
Gänzlich unterbelichtet sind diejenigen Aktivitäten, die sich vollkommen jenseits der Legalität in dem Bereich abgespielt haben, der in Italien als »tiefer Staat« bezeichnet wird, aber während des Kalten Krieges alle Nato-Staaten einbezog. Die Rede ist von jenen parastaatlichen Gruppen, die unter der Leitung der CIA und der MI6 gebildet wurden, um im Falle einer sowjetischen Invasion hinter den Linien mit Sabotageakten tätig zu werden. Diese Gruppen hatten auch die Funktion, die innenpolitischen Gegner aus den Reihen der Arbeiterbewegung gewaltsam zu bekämpfen. Die anlässlich der teilweisen Enttarnung des Bundes Deutscher Jugend vom hessischen Ministerpräsidenten Zinn angestoßene Bundestagsdebatte Anfang der 1950er Jahre ist jedoch bisher nicht zum Anlass genommen worden, diesem Aspekt nachzugehen – die einschlägige Literatur liegt bisher nur teilweise auf deutsch vor (Ganser 2008). Der kalte Geheimdienstkrieg auf deutschem Boden, über dessen rechtsstaatlichen Charakter man sich vermutlich wenig Illusionen machen darf, ist bisher ebenfalls nicht aufgearbeitet worden. Die Diskussion über die Arbeit der Stasi-Unterlagen-Behörde wirft ein Schlaglicht auf den Unwillen, die Westaktivitäten der Staatssicherheit einer breiten Untersuchung zu unterziehen. Trotz der umfangreichen Vernichtung von Aktenbeständen der Westabteilung der Stasi (Interview Weiss 2001) lagern in der Birthler-Behörde offenbar Materialien, die durchaus geeignet sind, die zeithistorische Forschung mit neuen Herausforderungen zu konfrontieren – von den Archiven der ehemaligen Staaten des Ostblocks einmal abgesehen, deren Geheimdienste über eine ganze Reihe historisch interessanter Informationen über den Westen verfügt haben dürften.
Aber auch das leichter zugängliche Aktenmaterial über den innenpolitischen Kampf gegen die KPD im engeren Sinne ist bisher wenig untersucht worden. Über den Initiativausschuss der Verteidiger in politischen Strafsachen, die vielleicht wichtigste juristische Organisation bei der Verteidigung der demokratischen Bürgerrechte, liegt bisher keine Studie vor (ein Aktenbestand, der u.a. Korrespondenz von Walter Amman, dem Gründer und Motor des Initiativ-Ausschusses beinhaltet, liegt im Institut für Zeitgeschichte in München: http://www.ifz-muenchen.de/archiv/ed_0712.pdf). Dabei ist allein die Zahl juristischer Verfahren gegen KPD-Mitglieder beeindruckend: Nach Schätzungen von Alexander Brünneck aus dem Jahre 1978 hat es zwischen 1949 und 1968, als mit der DKP wieder eine Kommunistische Partei zugelassen wurde, 125.000 Ermittlungsverfahren gegen Kommunisten sowie angebliche oder tatsächliche Sympathisanten gegeben, wobei es zu über 6.000 Verurteilungen gekommen ist (Foschepoth 2008: 889-909). Für eine Partei, die zwar zeitweise über 300.000 Mitglieder hatte, die bei ihrer Illegalisierung 1956 jedoch nur noch über einen Kern von 12.000 Funktionären verfügte, bedeutet das einen erheblichen Verfolgungsdruck. Dabei hatte die staatliche Repression gegen Kommunisten Anfang der 1950er Jahre ihren Höhepunkt gefunden: Die meisten Verurteilungen von Kommunisten gab es 1953, im Jahr der Bundestagswahl. Die FDJ, die sich 1950 an die Spitze der Proteste gegen die Wiederbewaffnung gesetzt und deswegen erheblichen Zulauf aus der Jugend hatte, wurde bereits 1951 verboten. 1952 wurde bei einer – bisher nicht näher erforschten – Demonstration in Essen der 21jährige Philipp Müller von der Polizei erschossen – das verweist auf das Ausmaß polizeilicher Repression nicht nur gegen Kommunisten, sondern gegen die Friedensbewegung insgesamt (Die Wahrheit über den Essener 11. Mai 1952. Essen o.J. [1952]).
Zieht man in Betracht, dass die Justiz- und Polizeiapparate sich mehrheitlich aus ehemaligen NS-Parteigängern zusammensetzten, wird deutlich, mit welchen Legitimationsdefiziten die Bundesrepublik belastet war: Während die DDR sich mehr oder weniger glaubhaft als antifaschistischer Staat präsentieren konnte, in dem die ehemaligen Eliten des Dritten Reiches ausgeschaltet worden waren, konnte sich die Bundesrepublik zwar als demokratisch legitimierter Rechtsstaat ausweisen, war aber mehr als deutlich braun befleckt.
Wie fragwürdig vor diesem Hintergrund das in Deutschland vorherrschende historische Selbstbild ist, verdeutlicht eine naheliegende Überlegung: Hätte sich die Bundesrepublik ebenso entwickelt, wenn es die DDR nicht gegeben hätte? Wäre ein gesamtdeutscher Staat nicht von anderen innen- wie außenpolitischen Machtverhältnissen geprägt gewesen? Hätte dieses Gemeinwesen nicht eine vollkommen andere Legitimationsgrundlage entwickeln müssen? Die Konzeption eines demokratisch-sozialistischen, außenpolitisch neutralen Deutschland ist 1946/47 unter dem polarisierenden Druck des Kalten Krieges auseinander gefallen. Während die Bundesrepublik zwar das in Deutschland schwache bürgerlich-demokratische Erbe antrat und um den Preis einer weitgehenden Integration der NS-Eliten die sozialistische Tendenzen niederhielt, verhielt es sich bei der DDR genau umgekehrt: Die alten Eliten wurden entmachtet und damit zunächst die Grundlagen für eine sozialistische Transformation geschaffen. Die Absicherung der SED-Herrschaft, respektive der Sowjetunion, bedeutete jedoch die Zerstörung jeglicher demokratischer Mitwirkungsmöglichkeiten. Die seit dem Zerfall des Ostblocks vorherrschende Tendenz, per se der DDR ihre historische Funktion abzusprechen, die Bundesrepublik dagegen als demokratisches Erfolgsmodell zu präsentieren, wird der Sache daher kaum gerecht. Die breite Forschung über das NS-Regime und seine Folgen, deren quantitativer Umfang im umgekehrten Verhältnis zu ihrer theoretischen Folgenlosigkeit hinsichtlich der These vom demokratischen Erfolgsmodell Bundesrepublik steht (Herbert 2002: 7-49), zeigt die Unmöglichkeit, der Bundesrepublik im Nachhinein einen antifaschistischen Charakter zuzusprechen. Umgekehrt hat es sich als wenig überzeugend erwiesen, die antifaschistische Stoßrichtung der Bodenreform und der Enteignung des Großkapitals in der SBZ in Frage zu stellen, etwa mit der wenig schlagkräftigen These, auch in der DDR hätten NS-Funktionäre Karriere gemacht. Das trifft zwar zu, der Vergleich zur Bundesrepublik macht aber deutlich, dass es in der DDR in zentralen Bereichen zu einem Elitentausch gekommen ist.
Gerade in ihrer wechselseitigen Bedingtheit stellten mithin beide deutsche Staaten eine unzureichende Antwort auf den Faschismus dar. Das Interesse der maßgeblichen bürgerlichen Kreise der USA und Großbritanniens, eine sozialistische Transformation in Westeuropa zu verhindern, hatte zwingend ein Bündnis mit den ehemaligen NS-Eliten sowie ihren bürgerlichen Mitläufern zur Voraussetzung. Unter dem Banner der Verteidigung bürgerlicher Freiheiten gelang die Einbindung großer Teile der Sozialdemokratie und des Sozialkatholizismus. Die autoritäre politisch-soziale Struktur wurde dadurch im institutionellen Rahmen der parlamentarischen Demokratie weitgehend restauriert. In der Sowjetischen Besatzungszone wurde zwar die kapitalistische Sozialstruktur umgewälzt, die politische Hegemonie der KPD gegenüber der SPD konnte jedoch nur mit autoritären Mitteln und schließlich mit der Aufhebung aller substantiellen wirtschaftlichen und politischen Mitwirkungsrechte sowie offenem Terror hergestellt werden. Die Frontstellung der SU und der Westalliierten hatte somit eine Reproduktion der autoritär-obrigkeitsstaatlichen Traditionen in zwei staatlichen Varianten zur Folge, nicht deren Überwindung.
Dass sich die Bundesrepublik als das erfolgreichere bzw. siegreiche Modell erwiesen hat, sollte nicht über ihre Strukturdefizite hinwegtäuschen; denn es waren nicht etwa die kaum den faschistischen Stiefeln entschlüpften bürgerlichen Eliten, welche die demokratische Entwicklung verbürgten. Im Gegenteil: die buntscheckige Opposition war die maßgebliche Triebkraft für die Demokratisierung des restaurativen westdeutschen Obrigkeitsstaates (Kritidis 2008). Das Bewusstsein dieses Zusammenhangs mag in den letzten Jahren auch im Zuge der Versuche, die 68er-Bewegung als antidemokratisch umzudeuten, verdrängt worden sein. Die gesellschaftlichen Widersprüche, die damit verbunden sind, drängen jedoch dazu, die liegengebliebenen Fragen neu zu stellen.
Literatur:
Nicolas Berg, Der Holocaust und die westdeutschen Historiker, Göttingen 2003.
Karl-Dietrich Bracher, Die Auflösung der Weimarer Republik, Villingen 1960.
Wolfgang Buschfort, Geheime Hüter der Verfassung: von der Düsseldorfer Informationsstelle zum ersten Verfassungsschutz der Bundesrepublik (1947-1961), Paderborn 2004.
Die Nacht Hinter dem Vorhang. Interview mit dem ehemaligen Stasi-Major Ulrich Weiss, in: Freitag v. 26.1.2001.
Ossip K. Flechtheim, Dokumente zur parteipolitischen Entwicklung Bd. 2. Erster Teil. Programmatik der deutschen Parteien, Dok. 100, Berlin 1963, S. 53.
Josef Foschepoth, Rolle und Bedeutung der KPD im deutsch-deutschen Systemkonflikt, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 56/2008, S. 889-909.- Claudia Fröhlich, Restauration. Zur (Un-)Tauglichkeit eines Erklärungsansatzes westdeutscher Demokratiegeschichte im Kontext der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, in: Stephan Alexander Glienke/Volker Paulmann/Joachim Perels (Hg.), Erfolgsgeschichte Bundesrepublik? Die Nachkriegsgesellschaft im langen Schatten des Nationalsozialismus, Göttinger 2008, S. 17-51.
Andrea Gabler, Antizipierte Autonomie. Zur Theorie und Praxis der Gruppe »Socialisme ou Barbarie«, Hannover 2009.
Daniele Ganser, Nato. Geheimarmeen in Europa. Inszenierter Terror und verdeckte Kriegsführung, Zürich 2008.
Dominik Geppert/Jens Hacke, Streit um den Staat. Intellektuelle Debatten in der Bundesrepublik 1960-1980, Göttingen 2008.
Stephan Alexander Glienke, Die Ausstellung »Ungesühnte Nazijustiz« (1959–1962). Zur Geschichte der Aufarbeitung nationalsozialistischer Justizverbrechen, Baden-Baden 2008.
Marcus Hawel (2009a), Dämmerung des demokratischen Rechtsstaates? Zur Renaissance des Dezisionismus, in: Kritische Justiz 1/2009, S. 64-73.
Ders. (2009b), Rezension zu: Buckmiller, Michael; Perels, Joachim; Schöler, Uli, Wolfgang Abendroth. Gesammelte Schriften Bd. 2. 1949-1955, Hannover 2008, in: H-Soz-u-Kult, 23.04.2009,
Ulrich Herbert, Liberalisierung als Lernprozeß. Die Bundesrepublik in der deutschen Geschichte - eine Skizze, in: Ders. (Hg.), Wandlungsprozesse in Westdeutschland. Belastung, Integration, Liberalisierung 1945 - 1980, Göttingen 2002, S. 7-49.
Thomas Hofmann, Tunnelblick der Historiographie I und II, in: Freitag v. 23.3.2007 sowie v. 30.3.2007.
Diether Koch, Heinemann und die Deutschlandfrage, München 1972.
Jan Korte, Instrument Antikommunismus. Sonderfall Bundesrepublik, Berlin 2009.
Elmar Kraushaar, Unzucht vor Gericht. Die »Frankfurter Prozesse« und die Kontinuität des § 175 in den fünfziger Jahren, in: E. Kraushaar (Hg.), Hundert Jahre schwul – Eine Revue, Berlin 1997.
Gregor Kritidis, Linkssozialistische Opposition in der Ära Adenauer. Ein Beitrag zur Frühgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Hannover 2008.
Bernd Rabehl, Feindblick. Der SDS im Fadenkreuz des »Kalten Krieges«, Berlin 2000.
Benno Sarel, Arbeiter gegen den Kommunismus. Zur Geschichte des proletarischen Widerstandes in der DDR (1945-1958), München 1975 [Paris 1958].
Eberhard Schmidt, Die verhinderte Neuordnung 1945-1952, Frankfurt/M. 1970.
Uwe Schünemann, »Die Linke« ist keine normale Partei, in: FAZ v. 15.12.2008.
Jürgen Seifert, Sozialistische Demokratie als >schmaler WegSozialistische Politik< (1955-1961), in: Ders./Heinz Thörmer/Klaus Wettig (Hg.), Soziale oder sozialistische Demokratie. Beiträge zur Geschichte der Linken in der Bundesrepublik, Marburg 1989.
Jürgen Treulieb, Der Landesverratsprozeß gegen Viktor Agartz. Verlauf und Bedeutung in der innenpolitischen Situation der Bundesrepublik auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. 2 Bd., Münster 1982.
Peter Wensierski, Schläge im Namen des Herrn. Die verdrängte Geschichte der Heimkinder in der Bundesrepublik, München 2006.
Edgar Wolfrum, Die geglückte Demokratie. Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart 2006.
http://www.ifz-muenchen.de/archiv/ed_0712.pdf