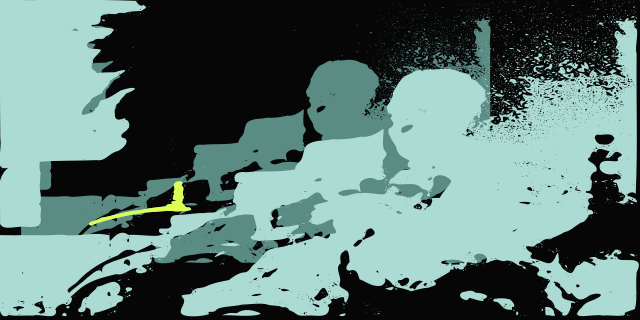von Peter Brandt
Die Zeitungen der Sozialdemokratie feierten Mitte November 1918 die Vorgänge der zurückliegenden Tage mit Worten wie, die Deutschen seien jetzt »das freieste Volk der Welt«. »Ein Volk, durch Jahrhunderte hindurch von den harten Händen des Militarismus und der Bürokratie niedergehalten, zu Knechtseligkeit und dumpfem Gehorsam erzogen, steht auf und handelt.« »Wir haben endlich die revolutionäre Tradition, um die wir andere Völker bisher beneidet haben.« Und auch der bekannte liberale Journalist Theodor Wolff sprach in Berlin von »der größten aller Revolutionen«2.
Der württembergische Abgeordnete der soeben gewählten Nationalversammlung interpretierte Mitte Februar 1919 das Geschehen seit dem Herbst 1918 als nachträgliche Vollendung der 70 Jahre zuvor – 1848/49 – versäumten bürgerlichen Revolution. »Erst die Arbeiterschaft hat der Junkerherrschaft in Deutschland…für immer ein Ende bereitet.« Das sei geschehen in einer Revolution »ohne Blutvergießen«, die übergegangen sei in die gesetzliche Arbeit der Konstituante, ihrerseits ein »Zeichen der fortdauernden Revolution«3
Monate später zog Rudolf Wissell, 1919 einige Zeit Wirtschaftsminister, auf dem ersten Nachkriegsparteitag der SPD eine ganz andere Bilanz: »Trotz der Revolution«, so meinte er, »sieht sich das Volk in seinen Erwartungen enttäuscht ... Wir haben die formale politische Demokratie weiter ausgebaut ... [Doch] wir konnten den dumpfen Groll, der in den Massen steckt, nicht befriedigen ... Wir haben im wesentlichen in den alten Formen unseres staatlichen Lebens regiert«4
»Trotz der Revolution« - dass es tatsächlich eine Revolution in Deutschland gegeben hatte, wurde in den ersten Jahren der Weimarer Republik kaum bestritten, anders als später, da man die Vorgänge der frühen Nachkriegszeit – sofern man sie nicht als »Pöbelrevolte« ohne gestaltende Kraft diffamierte – lediglich als Reflex des »Zusammenbruchs« eines überlebten und militärisch geschlagenen Systems begreifen wollte.
Doch jede Revolution ist an die Zersetzung der vorrevolutionären Ordnung geknüpft und beginnt damit. Die revolutionäre Massenbewegung von 1918/19 war nicht ein Phänomen weniger Tage zur Zeit des Staatsumsturzes, sondern hielt – in zwei deutlich voneinander zu unterscheidenden Phasen - ununterbrochen bis weit in das Frühjahr 1919 an; sie erlebte noch einmal einen Aufschwung im Generalstreik gegen den Kapp-Putsch und in den Kämpfen der sog. »Roten Ruhrarmee« im Frühjahr 1920.
Diese Revolution war alles drei zugleich: Endpunkt jahrzehntelanger Liberalisierungs- und Demokratisierungsbestrebungen, spontane Volkserhebung zur Beendigung des faktisch schon verlorenen Krieges und sozialdemokratisch geprägte Klassenbewegung mit antikapitalistischer Tendenz. Die Verschränkung liberal-demokratischer, antimilitaristischer und proletarisch-sozialistischer Komponenten in der Revolution ergab sich aus dem Charakter des Kaiserreichs von 1871 und der Doppelrolle der sozialdemokratischen Bewegung in ihr als Organisation der klassenbewussten Arbeiter wie als einzige starke Kraft, die ohne Einschränkung für die politische Demokratisierung des Deutschen Reiches eintrat.
Das wilhelminische Deutsche Reich war ein Rechts- und Verfassungsstaat mit einem regen kulturellen und politischen Leben – ökonomisch und wissenschaftlich in Europa an der Spitze –, aber gleichzeitig unterschied sich die staatliche und soziale Ordnung des Kaiserreichs durch das Übergewicht der monarchischen Exekutive, abgesichert durch die gleichsam außerkonstitutionelle Stellung des Militärs, doch nicht unerheblich von denjenigen kapitalistischen Gesellschaften, die parlamentarisch-demokratisch verfasst waren, auch wenn das auf Reichsebene geltende allgemeine, gleiche Männerwahlrecht im internationalen Vergleich ausgesprochen fortschrittlich war. Nicht zuletzt blieb die sozialdemokratische Arbeiterbewegung (schon seit 1890 war die SPD die wählerstärkste Partei) aus dem politischen Geschäft bis 1914 weitgehend ausgegrenzt und auf allen Ebenen einer teilweise sehr empfindlichen Drangsalierung ausgesetzt5
Angesichts des scheinbar kaum aufzuhaltenden Vormarschs der Arbeiterbewegung sahen die Schwerindustriellen, aber auch andere Unternehmer ihre sozialen Interessen am besten bei dem bestehenden System aufgehoben. Zumindest schien es sehr riskant, die Machtposition der ostelbisch geprägten Gutsbesitzer-, Beamten- und Militäraristokratie, also der politisch bestimmenden Schicht, zu beseitigen, auch wenn deren Beibehaltung bedeutete, dass die materielle Position der Agrarier durch Außenzölle künstlich gestützt werden musste. Aus diesem Grund und nicht nur wegen ideologischer Vorbehalte musste jeder Versuch, die bestehende politische Ordnung zu demokratisieren, von vornherein mit dem entschiedenen Widerstand nicht allein der aristokratisch-bürokratisch-militärischen Kräfte, sondern auch eines Teils des Großbürgertums sowie mit der Skepsis eines weiteren Teils rechnen. Dazu kam die antiliberale Orientierung eines Großteils der Bauern und des »alten Mittelstands«, die ihre Interessen am ehesten durch die von der konservativen Rechten verfochtene protektionistische Wirtschaftspolitik gewahrt sahen.
Immerhin: In allen Reichstagsfraktionen jenseits der Konservativen gab es in unterschiedlicher Stärke, aber in zunehmendem Maß Gruppierungen, die auf Reformen drangen. Aber keine der nichtsozialistischen Parteien trat vorbehaltlos gleichermaßen für Parlamentarisierung und Demokratisierung ein. Die Linksliberalen befürworteten die schrittweise Einführung einer parlamentarischen Monarchie und das gleiche Wahlrecht für Preußen, schreckten aber vor der Forderung nach Abschaffung des Klassenwahlrechts bei den Gemeindewahlen zurück, um nicht ihre letzten Bastionen in der SPD zu verlieren. Das katholische Zentrum und die Nationalliberalen standen dem Parlamentarismus mehrheitlich bis 1914 und darüber hinaus ängstlich und skeptisch gegenüber, wenn sie auch Schritte in diese Richtung bejahten; das preußische Dreiklassenwahlrecht wollten die meisten von ihnen nicht einfach dem Reichstagswahlrecht angleichen, sondern durch eine mildere Form ungleichen Wahlrechts ersetzen.
Für dieses Zögern spielte die Existenz der SPD eine zentrale Rolle. Deren Stimmenanteil betrug bei den Reichstagswahlen nach 1900 zwischen 29% und 35%. Die gemäßigte Mitte fürchtete – ebenso wie die Rechte – die von der SPD propagierte soziale Revolution durch den Stimmzettel. In der SPD, zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch ganz überwiegend eine Facharbeiterpartei, hatte sich zwar längst eine Politik der praktischen sozialen Verbesserungen durchgesetzt. Eine durchdachte Reformstrategie, die über den tagespolitischen Praktizismus hinausging, propagierte jedoch nur eine Minderheit von namentlich in Süddeutschland beheimateten Reformisten.
Manche Historiker haben – wie auch viele Zeitgenossen gerade aus dem liberalen Lager – die vermeintliche marxistische Orthodoxie und die Unbeweglichkeit der SPD für das Scheitern einer grundlegenden Reform des Kaiserreichs mitverantwortlich gemacht. Dabei bleibt außer Acht, dass die Diskrepanz zwischen praktischer Tagespolitik in Gewerkschaften und Kommunen und der theoretischen Unversöhnlichkeit des Klassenstandpunkts für die meisten Sozialdemokraten den Zwiespälten eigener Erfahrungen in der wilhelminischen Gesellschaft entsprach. Auf der Gegenseite stellten zwar alle bürgerlichen Parteien ihrerseits die prinzipielle Gegnerschaft zur Sozialdemokratie heraus. Gleichzeitig aber trug gerade die Bedrohung durch eine als Konkurrentin um Wählerstimmen erfolgreiche, vermeintlich revolutionäre Arbeiterbewegung maßgeblich dazu bei, bei den bürgerlichen Parteien in den unmittelbaren Vorkriegsjahren die Einsicht zu fördern, dass eine Reformpolitik nötig und der Bruch mit den Großagrariern unvermeidlich sei. Denn nur einer liberalisierenden und in Maßen demokratisierenden Politik (einschließlich der von rechts behinderten Weiterführung einer fortschrittlichen Sozialpolitik) traute man die Konsolidierung bürgerlicher Herrschaft zu. Insofern war die Wirkung der Sozialdemokratie auf die oppositionelle Energie des Bürgertums durchaus ambivalent.
Allerdings: Was sich andeutete und teilweise vollzog, war eine neue Austarierung des Gleichgewichts der Verfassungsorgane und der staatstragenden Sozialgruppen und Parteien, nicht jedoch der Durchbruch zur politischen Demokratie. Die Seniorpartner von 1871, die Konservativen und ihre Trägerschichten, waren dabei, zu Juniorpartnern zu werden. Der Agrarprotektionismus war selbst für die Schwerindustriellen in der früheren Rigorosität nicht mehr akzeptabel. Die Staatsstreich-Option wurde zwar gedanklich durchgespielt, aber – gerade angesichts der Kriegsgefahr – von den wichtigen Entscheidungsträgern verworfen.
Bei unbestreitbarer sukzessiver Konzentration politischen Einflusses im Reichstag blieb die Mitwirkung der SPD beim Zustandekommen von Gesetzen die Ausnahme, während sich auf Reichs- wie auf Landesebene die alltägliche Repression gegen die Arbeiterbewegung in den letzten Vorkriegsjahren wieder verschärfte, und das auch im relativ liberalen Süddeutschland. Eine umstandslose Integration der SPD ins politische System lehnten auch die Reformpolitiker aus den Reihen der Nationalliberalen und der Zentrumspartei eindeutig ab. Gleichzeitig war die katholische Arbeiterbewegung innerhalb des Zentrums mehr denn je an den Rand gedrängt. Das enorme Konfliktpotential der späten wilhelminischen Gesellschaft konnte von dem mancher autoritärer Elemente des Bismarckreichs entkleideten Halbparlamentarismus, wie er sich unmittelbar vor 1914 abzeichnete, keinesfalls abgebaut werden.
Der Erste Weltkrieg aktualisierte und verschärfte – nicht nur in Deutschland – dann alle in der Gesellschaft strukturell angelegten Widersprüche. Spätestens seit dem Frühjahr 1917 lässt sich von einer Massenbewegung der Arbeiterschaft sprechen, die sich gegen die unzureichende Lebensmittelversorgung, gegen politische Unterdrückung und die Kriegspolitik der Herrschenden wandte. Der soziale Protest und das Friedensverlangen wurden besonders durch den Sturz des Zarismus und die revolutionäre Entwicklung in Russland bestärkt.
Die SPD hatte sich 1914 dem sog. »Burgfrieden« angeschlossen, wobei, neben der Einschätzung des Krieges als eines Verteidigungskriegs, auch die Hoffnung auf innenpolitische Reformen eine Rolle spielte. Von der Parteimehrheit spalteten sich – endgültig Ostern 1917 – die USPD ab, eine relativ lose Föderation aller pazifistischen und antimilitaristischen Gruppen der Sozialdemokratie; zu ihr gehörte neben dem führenden Theoretiker des Parteizentrums, Karl Kautsky, z. B. auch der Protagonist des Revisionismus, Eduard Bernstein, außerdem die kleine, radikal-linke Spartakusgruppe mit Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg.
Neben der proletarisch-sozialistischen Opposition entwickelte sich eine breitere, aber weniger zielgerichtete Unzufriedenheit aller Schichten, die nicht vom Krieg profitierten. Der Protest entzündete sich ebenfalls vor allem am Problem der Lebensmittelversorgung. Noch stärker als die unzureichende Menge wirkten die ungleiche Verteilung und der »Schwarze Markt« als Provokation. Die abhängigen Mittelschichten – Angestellte und Beamte – wurden in ihrer Lebenshaltung im Verlauf des Krieges durch die Teuerung stark gedrückt und den Arbeitern angenähert, worauf Teile mit einer begrenzten (und vorübergehenden) Linkswendung reagierten. Das selbstständige Kleinbürgertum und die Bauern sahen sich angesichts der kriegswirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen als Opfer eines die Großindustrie begünstigenden staatlichen Dirigismus. Der Hass auf »den Staat«, »das große Geld« und »die Industrie«, teilweise auch »die Juden« und – in Süd- und Westdeutschland – »die Preußen« bildeten den Gegenstand kleinbürgerlich-bäuerlichen Unmuts. Auch große Teile der bürgerlichen Intelligenz waren gegen Ende des Krieges tief desillusioniert.
Nach den Entbehrungen der Kriegszeit war somit auch außerhalb der Arbeiterschaft die Vorstellung weit verbreitet, dass es zu grundlegenden Neuerungen kommen müsse, um die Sterilität des wilhelminischen Obrigkeitsstaats zu überwinden. Es war eine diffuse Aufbruchstimmung, die bei Enttäuschungen schnell wieder umschlagen konnte.
Zwar trieben die Parlamentsfraktionen der späteren Weimarer Koalition, - im Interfraktionellen Ausschuss zusammengefasst: neben den Sozialdemokraten die Linksliberalen, zeitweise sogar die Nationalliberalen, sowie die Zentrumskatholiken, die ihre früheren Vorbehalte gegen die Einführung des parlamentarischen Regierungssystems zumindest im Sinne eines »negativen Parlamentarismus«, demzufolge der Reichskanzler künftig nicht mehr gegen die Reichstagsmehrheit regieren sollte, abbauten – in der zweiten Kriegshälfte die faktische Parlamentarisierung des Kaiserreichs voran und bemühten sich um einen Verständigungsfrieden mit den Kriegsgegnern, doch vermochten sie die in zentralen Bereichen fast diktatorische Machtposition der Obersten Heeresleitung nicht zurückzudrängen, geschweige denn: zu brechen. Weil dem Kaiser und seinem Reichskanzler zwischen den Parlamentarisierungsbestrebungen und der Tendenz zur Militärdiktatur kaum noch ein eigener Entscheidungsspielraum blieb, war die Monarchie am Ende des Weltkriegs ausgehöhlt.
Mit dem Frühjahr 1917 hatte in ganz Europa ein beispielloser Aufschwung der Arbeiterbewegung eingesetzt, der drei bis vier Jahre anhielt und dann in der ersten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit und dem Wiedererstarken der bürgerlichen Ordnung (in Italien im Aufkommen des Faschismus) sein Ende fand. In Russland endete parallel dazu der Bürgerkrieg mit dem Sieg der Bolschewiki, der zugleich das endgültige Verbot der anderen sozialistischen Parteien und die Unterdrückung auch der Arbeiteropposition mit sich brachte.
Der Aufschwung der Jahre 1917-1920/21, Ausdruck einer durch den Krieg ausgelösten tiefen Krise der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, erfasste mehr oder weniger alle Länder, die am Krieg beteiligten und die neutralen, und er galt für die revolutionäre und zugleich für die reformistische Richtung. Spektakuläre Niederlagen, wie der Schweizer Landesstreik vom November 1918 und der etwa gleichzeitige Generalstreik in Portugal, können diese Aussage lediglich relativieren. Nicht nur in den Nachfolgestaaten der geschlagenen Ost- und Mittelmächte, sondern auch in einer ganzen Reihe west- und nordeuropäischer Staaten, in erster Linie in Großbritannien, traten kurz nach Kriegsende demokratisierende Wahlrechtsänderungen in Kraft. Die Gewerkschaften expandierten teilweise explosionsartig und konnten vielfach langjährige Forderungen der Arbeiterbewegung nach allgemeiner Arbeitszeitverkürzung und nach erweiterter sozialer Sicherung sowie teilweise beachtliche Reallohnerhöhungen durchsetzen. Es kam vermehrt zu sozialdemokratischen Regierungsbeteiligungen. Von noch größerer Dramatik war die radikal-revolutionäre Welle, die im März 1917 in Russland angestoßen wurde und mit den ergebnislosen Fabrikbesetzungen und Agrarunruhen in Italien im Sommer und Herbst 1920 auszulaufen begann. Diesen internationalen Zusammenhang gilt es, bei dem Blick auf die deutschen Ereignisse stets im Auge zu behalten:
Die nach dem Eingeständnis der militärischen Niederlage im Frühherbst 1918 von der Obersten Heeresleitung initiierte sog. Oktober-Reform machte Deutschland zu einer parlamentarischen Monarchie nach britischem Vorbild. Der neuen Regierung traten Vertreter der Liberalen, des Zentrums und der SPD bei. Dieser Versuch, der Revolution durch die Selbstreform des alten Systems zuvorzukommen, hat manche Beobachter veranlasst zu meinen, der Aufstand vom November sei lediglich ein Missverständnis gewesen, da bereits alles Wesentliche durchgesetzt gewesen sei, was die Massen erstrebt hätten. Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass sich die politischen Ziele der Bewegung auf die Durchsetzung des parlamentarischen Regierungssystems reduzieren lassen (was nicht zutrifft), war doch das erste unmittelbare Ziel, der Friedensschluss, noch keineswegs gesichert. Vor allem war die Machtstellung des Militärs im Reichsinnern, namentlich die diktatorische Gewalt der Kommandieren Generäle, nicht beseitigt. Die Reform hätte bei Änderung der militärischen oder politischen Konjunktur unter Umständen zurückgenommen werden können; erst der Umsturz vom November 1918 hat diese Möglichkeit definitiv ausgeschlossen.
Revolutionen werden nicht »gemacht« von bewussten Revolutionären, sondern entstehen aus spontanem Aufbegehren unzufriedener Volksmassen, dem – um es zu wiederholen – ein Erosionsprozess des herrschenden Systems vorausgeht. Obwohl die Ereignisse in Deutschland in der zweiten Jahreshälfte 1918 auf den Zusammenbruch der alten Ordnung zutrieben, erwiesen sich die Vorbereitungen der bewusst revolutionären Gruppen auf den Aufstand als meist wenig bedeutsam für den Verlauf der Umsturzbewegung, die – ausgehend von der Meuterei in der Hochseeflotte und von den Seehäfen – wie ein Lauffeuer durch das Reich ging.
In Kiel, einer Stadt mit zehntausenden vor dem Generalstreik stehender Werftarbeiter, wurde die Matrosenmeuterei zur Massenerhebung der Soldaten des Heimatheeres und der Arbeiter – zur Revolution. Bis zum Mittag des 4. November standen alle Schiffe, der Hafen und die große Marine-Garnison unter der roten Fahne. In den Folgetagen trugen die Matrosen von Kiel den Funken der Empörung gegen das verhasste Militärsystem in viele weitere Orte. Die 14 Punkte des Forderungskatalogs, den die Kieler Soldatendeputierten für verbindlich erklärten6, waren gerade in ihrer Unklarheit und in ihrer Beschränkung auf die Sphäre des Militärischen ein authentischer Ausdruck der spontanen Massenbewegung.
Die Betonung des spontanen Charakters des Umsturzes bedeutet nicht, dass existierende Gruppenbildungen („Netzwerke“, wie man heute sagt) im Moment des Umbruchs nicht doch noch relevant geworden wären. Das gilt etwa für die der USPD angehörenden »Revolutionären Obleute« in Berlin, die in den Metallbetrieben und im freigewerkschaftlichen Metallarbeiterverband stark verankert waren.
Der Aufstand breitete sich zwischen dem 4. und 9. November von den Küstenstädten ins Innere Deutschlands aus. Bereits am 7. November stürzten in München die bayerische Regierung und die Monarchie. Auch auf die Fronttruppen war jetzt kein Verlass mehr: Eine Befragung von 39 Offizieren der erreichbaren Kampfabschnitte seitens der Armeeführung über die Stimmung im Heer und die Loyalität gegenüber dem Kaiser hatte am 8. November überwiegend negative Antworten zur Folge. Kaiser Wilhelm II. ging vom Hauptquartier im belgischen Spa, wohin er am 29. Oktober ausgewichen war, am Morgen des 10. November nach Holland ins Exil.
Dass der Aufstand – meist widerstandslos – in großen Teilen des Reiches schon gesiegt hatte und im Rest des Landes in Gang gekommen war, verringerte die Chance militärischer Gegenwehr seitens der alten Gewalten in entscheidendem Maße, als die revolutionäre Welle am 9. November die Reichshauptstadt Berlin erreichte. Mit dem Umsturz in Berlin war der Erfolg des Aufstands gesichert, wenngleich der Wechsel in vielen, insbesondere kleineren Städten erst in den folgenden Tagen vollzogen wurde.
Zwischen 8 und 10 Uhr am Morgen des 9. November begann der Generalstreik in den Berliner Großbetrieben, aber auch in vielen kleineren Betrieben. Aus den Fabriken formierten sich Demonstrationszüge, die sich zu den Kasernen bewegten, um die Soldaten zur Verbrüderung aufzurufen und die Offiziere zu entwaffnen. Die Initiative lag jetzt also bei den Industriearbeitern. Abgesehen von einigen, meist kleineren Schießereien, die allerdings an einer Stelle drei zivile Todesopfer forderten, weigerten sich die Truppen überall, gegen die unbewaffneten Demonstranten vorzugehen. Als Reichskanzler Max von Baden mittags eigenmächtig die Abdankung des Kaisers bekannt gab, waren die Würfel bereits gefallen. Bevor Karl Liebknecht gegen 16 Uhr vom Schloss aus die »Freie Sozialistische Republik« proklamierte, hatte Philipp Scheidemann um 14 Uhr vom Reichstag aus die »Deutsche Republik« ausgerufen. Im letzten Moment hatte sich somit die mehrheitssozialdemokratische Führung an die Spitze der Volksbewegung gesetzt und namentlich die Soldaten auf ihre Seite gebracht. Man hatte die Revolution durch das Vorantreiben der Staatsreform zu vermeiden gesucht und ging jetzt daran, sie quasi zu adoptieren.
Reichskanzler Max von Baden hatte, jenseits seiner verfassungsmäßigen Kompetenzen, dem SPD-Vorsitzenden Friedrich Ebert in einer Besprechung mit führenden Sozialdemokraten die Geschäfte des Reichskanzlers übergeben, die Ebert im Rahmen der Reichsverfassung auszuüben versprach. Zugleich wurde schon die Idee einer verfassunggebenden Nationalversammlung erörtert. Auch wenn die sog. „Reichskanzlerschaft“ Eberts in der beabsichtigten Form nur einige Stunden dauerte, war der Kontinuität suggerierende Vorgang wichtig für die Autorität des SPD-Spitzenmanns bei den alten Amtsträgern aller Ebenen, nachdem die doppelte Ausrufung der Republik sowie die Übernahme der militärischen Gewalt seitens der Soldatenräte auch in Berlin neue Tatsachen geschaffen hatten.
Der Verlauf des Umsturzes in Berlin bedeutete eine wichtige Weichenstellung für den gesamten weiteren Gang der deutschen Revolution. In einer beachtlichen taktischen Leistung hatte die Mehrheitssozialdemokratie den Übergang vom Kaiserreich zur Republik aus der Regierungsbeteiligung (die erst am 9. November beendet wurde) über die Bündelung außerparlamentarischen Drucks, wobei die rebellierenden Massen den Forderungen der Partei nach Abdankung des Kaisers und nach Umbildung der Reichsregierung Nachdruck verleihen sollten, bis zum Bruch mit der Verfassungslegalität unter Kontrolle gehalten.
Trotzdem waren die Kräfteverhältnisse noch nicht klar einzuschätzen. Jedenfalls verlangte die Basis, soweit erkennbar, eine Verständigung der beiden sozialdemokratischen Parteien. Die SPD bot der USPD am Abend des 9. November den Eintritt in die neue Regierung an. Die Gegenforderungen der USPD, aufgestellt bei Abwesenheit des Vorsitzenden, während prominente Männer des linken Flügels mitgewirkt hatten, liefen auf die Installation einer sozialistischen Räterepublik hinaus, und selbst unter diesen Umständen wollten die Unabhängigen Sozialdemokraten ursprünglich nur wenige Tage ( bis zum Waffenstillstand) die Verantwortung für das Regierungshandeln übernehmen. Dass der SPD-Vorstand nach anfänglicher Zurückweisung der USPD-Forderungen am folgenden Nachmittag dann die reduzierten und modifizierten Bedingungen der USPD (sie waren jetzt ohne Beteiligung von Vertretern der Linksradikalen zustande gekommen) akzeptierte, war den über Nacht veränderten Machtverhältnissen geschuldet. Anstelle des improvisierten, mehrheitssozialdemokratisch ausgerichteten Arbeiter- und Soldatenrats vom 9. November hatten die Revolutionären Obleute in den Betrieben Wahlen für eine Berliner Räte-Vollversammlung in Gang gebracht, die am Abend des 10. November im Zirkus Busch zusammentreten und eine neue, revolutionäre Reichsregierung bestimmen sollte. Somit schien es der SPD-Spitze unbedingt geboten, vor der schwer kalkulierbaren Versammlung im Zirkus Busch zu einer Einigung mit der USPD zu gelangen.
Der zwischen beiden sozialdemokratischen Führungsgremien erzielte Kompromiss deutete auf substantielle Zugeständnisse der Mehrheits-SPD hin. Die Frage der Konstituierenden Versammlung wurde zurückgestellt bis zur Konsolidierung der neuen Verhältnisse. Zumindest so lange sollte die politische Gewalt in den Händen der Arbeiter- und Soldatenräte bleiben, die »alsbald« reichsweit zu einem Kongress zusammenzurufen seien. Insofern war Deutschland vorübergehend zu einer Räterepublik geworden, die von einem in paritätischer Besetzung aus beiden sozialdemokratischen Parteien gebildeten »Rat der Volksbeauftragten« regiert wurde7
Doch faktisch vermochten die Mehrheitssozialdemokraten binnen zwei bis drei Wochen die Frage: Rätedemokratie oder parlamentarische Demokratie, in ihrem Sinne zu entscheiden. Damit wurden auch alle Überlegungen, die Wahl der Nationalversammlung einige Monate zu verzögern bzw. das parlamentarische System durch Räteelemente zu ergänzen, etwa durch eine »wirtschaftliche« Räteorganisation, in den Bereich des Unwahrscheinlichen verwiesen.
Die erwähnte Vollversammlung der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte im Zirkus Busch am Abend des 10. November 1918 legitimierte die Einigung der sozialdemokratischen Parteien über die Regierungsbildung. Zugleich wählte sie als Kontrollinstanz einen »Vollzugsrat«, in dem die Revolutionären Obleute eine starke Position besaßen, aber wegen der gleichgewichtigen Beteiligung der Soldaten trotzdem in der Minderheit waren. Hauptsächlich deshalb konnte die Regierung der Volksbeauftragten den Machtanspruch des Vollzugsrats konterkarieren und binnen kurzer Zeit ausschalten. Beim Kampf um die frühest mögliche Einberufung der Nationalversammlung, an der die SPD-Volksbeauftragten unbedingt festhielten, gerieten der Vollzugsrat und in seinem Gefolge die USPD-Volksbeauftragten, denen es mehrheitlich nicht um die Installation eines Rätesystems ging, von Anfang an in die Defensive. Vor allem aus den preußischen Provinzen und, mehr noch, aus den nichtpreußischen Einzelstaaten artikulierten die Arbeiter- und Soldatenräte den Wunsch nach der Nationalversammlung. Am 26. November einigte sich der Rat der Volksbeauftragten auf den 16. Februar 1919 als Wahltermin; ein Wahlgesetz wurde kurz darauf publiziert. Die wichtigsten Neuerungen darin waren das Frauenwahlrecht und das Verhältniswahlsystem. Als dann vom 16. bis 20. Dezember 1918 in Berlin der Reichsrätekongress tagte, beschloss er mit großer Mehrheit die Abhaltung der Wahl bereits am 19. Januar.
Auch im System des »real existierenden Sozialismus« haben sich oppositionelle Massenbewegungen in Arbeiterräten organisiert: Kronstadt 1921, rudimentär Ostdeutschland 1953, deutlicher Polen und Ungarn 1956, China nach 1966, Tschechoslowakei 1968 und Polen ab 1980. Gewiss lassen sich gute Argumente dafür anführen, dass eine von Räten getragene direkte Demokratie als Regierungssystem nicht funktionieren kann, besonders in einer modernen Industriegesellschaft. Das ändert aber nichts an der Leistungsfähigkeit von Räten als Kampforganen hinsichtlich ihrer Offenheit und vereinheitlichenden Mobilisierungsfähigkeit. In den jüngsten demokratischen Umwälzungen Mittel- und Osteuropas haben Räteorgane deshalb keine wesentliche Rolle gespielt, weil die Arbeiterschaft als Klasse – im Unterschied zu den 1950er Jahren – nicht oder nicht mehr die Haupttriebkraft der Bewegung darstellte.
Was die Bewegung von 1918/19 in Deutschland betrifft, gab es aber nicht nur keine nennenswerte »bolschewistische« oder quasibolschewistische Kraft, sondern die bestehenden linksradikalen Gruppen – linkssozialistischen oder anarcho-kommunistischen Zuschnitts – waren auch viel zu schwach, um der realen Rätebewegung ihren Stempel aufzudrücken. Insofern ist die Frage nach dem Charakter und der prinzipiellen Durchführbarkeit eines »reinen Rätesystems«, wie es dann konzeptionell entwickelt wurde, im Zusammenhang unseres Themas allenfalls von untergeordneter Bedeutung.
Wie muss man sich die »Räte« in Deutschland 1918/19 vorstellen? Ohne damit zunächst eine längerfristige politische Perspektive zu verbinden, schufen sich die aufständischen Massen seit Anfang November nach russischem Vorbild und in Erinnerung an die großen Januarstreiks des Jahres eigene Vertretungsorgane. Die Soldaten wählten – entsprechend den vorgegebenen militärischen Einheiten – »Soldatenräte«. Die Soldatenräte traten nicht an die Stelle, sondern neben die alte militärische Struktur. Die jeweiligen militärischen Führungsinstanzen erkannten sie durchweg an und sagten Zusammenarbeit zu. In den Soldatenräten waren vielfach auch Offiziere vertreten, vor allem aber mittlere Ränge. Von der sozialen Zusammensetzung her war das kleinbürgerliche Element mindestens so stark vertreten wie das proletarische. Es kann daher nicht verwundern, dass die Soldatenräte innerhalb der revolutionären Bewegung eher auf dem rechten Flügel standen.
Die „Arbeiterräte“, deren Bildung im allgemeinen von einem Generalstreik begleitet war, wurden teilweise, wie in einer Reihe großer Städte, in den Betrieben gewählt, häufiger aber gingen sie aus einer Absprache der örtlichen Parteiführungen von SPD und USPD hervor, teils unter Einschluss von Freien Gewerkschaften, manchmal auch nichtsozialistischer Arbeitnehmer-Organisationen. Verschiedentlich wurden Arbeiterräte auch auf »Volksversammlungen« gebildet bzw. bestätigt. Normalerweise schlossen sich Soldatenrat und Arbeiterrat am jeweiligen Ort zum »Arbeiter- und Soldatenrat« zusammen, der als oberste Machtinstanz fungierte. Faktisch hatte er vor allem die Polizeigewalt inne. Die alte Verwaltung wurde in der Regel mit der Weiterarbeit beauftragt; der Arbeiter- und Soldatenrat beschränkte sich meist auf die (in ihrem Ausmaß allerdings sehr unterschiedliche) Kontrolle ihrer Tätigkeit Das gilt cum grano salis selbst für die wenigen von der radikalen Linken dominierten Räte.
Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass sich auch die nichtproletarischen – bürgerlichen, kleinbürgerlichen und bäuerlichen – Bevölkerungsgruppen der Räteform bedienten, um sich gegenüber der jetzt vorherrschenden Arbeiterbewegung zu artikulieren und zu behaupten. Ende des Jahres 1918 gab es immerhin rund 300 sog. »Bürgerräte«, die nicht offen gegenrevolutionär, aber doch deutlich revolutionsbremsend auftraten.
Die große Mehrheit der deutschen Arbeiter vertraute im November und Dezember 1918 zweifellos der SPD-Führung, eine beträchtliche Minderheit folgte dem gemäßigten Flügel der USPD. Die radikale Linke dominierte lediglich in wenigen Großstädten und industriellen Zentren, und auch hier stellten der Spartakusbund, die norddeutschen Linksradikalen und ähnliche Gruppen innerhalb der Linken in der Regel eine Minorität dar. Das Übergewicht der SPD verstärkte sich durch die massive Unterstützung von Seiten der Soldatenbewegung und von Teilen der Mittelschichten. Auf dem erwähnten ersten nationalen Rätekongress Mitte Dezember kamen drei Mehrheitssozialdemokraten auf einen Unabhängigen. Nur wenige Prozente der Delegierten gehörten kommunistischen Gruppierungen an. Das entsprach zu diesem Zeitpunkt in etwa den tatsächlichen Mehrheitsverhältnissen in der Arbeiterschaft Deutschlands.
Die historische Forschung seit den frühen sechziger Jahren neigt überwiegend zu der Auffassung, die SPD-Führung habe den kurz nach dem Umsturz vorhandenen Spielraum nicht genutzt, um durch tiefgreifende Staats- und Gesellschaftsreformen kraft revolutionären Rechts die Demokratie in Deutschland zu sichern8 Die mehrheitssozialdemokratische Politik war auf die raschestmögliche Überführung der Revolution in ein legales, d. h. parlamentarisches Stadium gerichtet. Den Entscheidungen einer nach allgemeinem gleichem Wahlrecht zu wählenden Nationalversammlung sollte keinesfalls vorgegriffen werden. Der Rat der Volksbeauftragten sollte – außer auf dem Gebiet wichtiger sozialpolitischer Reformen – praktisch als bloße Interimsregierung fungieren. Die Arbeiter- und Soldatenräte sollten ausschließlich Hilfsfunktionen für die Verwaltung wahrnehmen und so schnell wie möglich überflüssig gemacht werden.
Obwohl die große Zahl der lokalen und regionalen Räteorganisationen von Mehrheitssozialdemokraten und gemäßigten Unabhängigen dominiert wurden, neigten die SPD-Führer dazu, in ihnen Instrumente einer radikalen Sozialrevolution nach russischem Vorbild (an dem sich tatsächlich jedoch allenfalls die minoritären Gruppen der radikalen Linken orientierten) zu sehen. Jedenfalls spielte die jeweilige Wahrnehmung der inneren Entwicklung Russlands seit dem März 1917 eine wichtige Rolle für die jeweilige Wahrnehmung der deutschen Vorgänge. Noch stärker als für die Mehrheitssozialdemokraten gilt das für bürgerliche Liberale, auch solche des linken Flügels, für die Rechte ohnehin.
Bei ihrer Politik der Nicht-Revolution hatten die Mehrheitssozialdemokraten, neben ihrer prinzipiellen parlamentarisch-demokratischen Orientierung, die gravierenden situationsbedingten Probleme Deutschlands im Auge, die von der Regierung angesichts der Kriegsniederlage gelöst werden mussten, wie den Abschluss des Waffenstillstands (11.11.1918) mit der Rückführung und Demobilisierung des Heeres und – so hoffte man – eines erträglichen Friedens, die Sicherung der Ernährung, die Umstellung der Produktion auf die Friedenswirtschaft und die Bewahrung der Reichseinheit. Für die Bewältigung dieser Aufgaben meinte man die traditionellen Eliten: das Offizierskorps, die Beamtenschaft und die Unternehmer (einschließlich der Großgrundbesitzer), nicht entbehren zu können. Bei der Zurückdrängung des Einflusses der Arbeiter- und Soldatenräte verbanden sich also insofern sachliche, verfassungspolitische und machtpolitische Motive. Energische Unterstützung gegen die links von ihr stehenden Kräfte fanden die drei mehrheitssozialdemokratischen Volksbeauftragten: der Parteivorsitzende Friedrich Ebert, der Vorsitzende der SPD-Reichstagsfraktion Philipp Scheidemann und der Reichstagsabgeordnete Otto Landsberg, bei den sich unter neuen Namen, aber ansonsten in weitgehender Kontinuität formierenden bürgerlichen Parteien und nahezu der gesamten Presse.
Die Gleichberechtigung der USPD-Volksbeauftragten blieb auf dem Papier stehen. In die Regierung entsandt waren seitens der Unabhängigen Barth, Dittmann und Haase. Emil Barth gehörte zu den Revolutionären Obleuten und somit zum linken Parteiflügel, Wilhelm Dittmann war einer der prominenten Parteigründer und fungierte als Sekretär des USPD-Zentralkomitees, Hugo Haase hatte ab 1913 mit Ebert der SPD vorgestanden, bevor er Vorsitzender der neu gegründeten USPD geworden war. Er sollte verabredungsgemäß neben Ebert dem Rat der Volksbeauftragten präsidieren. De facto übernahm Ebert allein die Leitung des Gremiums.
Die Unterscheidung zwischen ordentlichen Volksbeauftragten und bürgerlichen Fachministern unter dem tradierten Namen »Staatssekretäre« entsprach einer bereits vorrevolutionären Neuerung, als 1917 aus den Reichstagsparteien erstmals Regierungsmitglieder ohne Ressort ernannt worden waren. Zwar waren auch die Zuständigkeiten der Volksbeauftragten sachlich aufgeteilt. Daneben arbeiteten aber die Leiter der obersten Reichsämter – nach den generellen Anweisungen der neuen Regierung – weiter. Sie waren keineswegs nur »technische Gehilfen« des Rats der Volksbeauftragten und stärkten mit einer selektiven Loyalität, ebenso wie der gesamte Regierungs- und Verwaltungsapparat, einseitig die mehrheitssozialdemokratischen Volksbeauftragten, namentlich Ebert. Die jeweils zwei Beigeordneten aus den sozialdemokratischen Parteien vermochten keine wirksame Kontrolle der Fachressorts auszuüben, ließen sich teilweise sogar von den Ressortchefs instrumentalisieren. – Dass es hinter den Kulissen schon am 10. November zu einer, zunächst eher technisch gemeinten, Kooperationsabsprache Eberts mit General Groener, dem Nachfolger Ludendorffs in der Obersten Heeresleitung als Generalquartiermeister, kam, sicherte dessen Machtposition zusätzlich.
Die USPD war von ihrer Gründung im Frühjahr 1917 bis zu ihrer Spaltung im Herbst 1920 eher ein Ausdruck der sich radikalisierenden Massenbewegung, als dass sie als Partei geschlossen auf diese eingewirkt hätte. Der in der Parteiführung zunächst vorherrschende, relativ gemäßigte Flügel formulierte Auffassungen, die vielfach die Bestrebungen der revolutionär-demokratischen Massenbewegung ausdrückten. Die Wahl der Nationalversammlung wurde grundsätzlich akzeptiert, doch sollte sie mehrere Monate hinausgeschoben werden, in denen irreversible Tatsachen geschaffen werden sollten. Die Stellung der USPD-Führung wurde indessen dadurch erschwert, dass ein zunehmender Teil der Parteibasis ihre Politik der Zusammenarbeit mit der SPD von links kritisierte. Die USPD-Linke suchte nach Möglichkeiten, die Revolution – auch gegen die Mehrheitssozialdemokratie – in Richtung eines Rätesystems weiterzutreiben.
Die Massenbewegung vom November-Dezember 1918 zeichnete sich – wenn man die Verhältnisse in ganz Deutschland und nicht allein in Berlin und wenigen urbanen bzw. industriellen Zentren zugrunde legt – dennoch durch eine weitgehende politische Einheitlichkeit aus. Sie stützte sich auf die Arbeiter, reichte aber über diese hinaus, indem sie nichtproletarische Soldaten, Angehörige der Intelligenz, der abhängigen Mittelschichten, seltener auch Bauern einschloss. Die Bewegung war ganz in der sozialdemokratischen Tradition verankert; die institutionelle Demokratisierung des Staates im Sinne der parlamentarischen Republik galt als Voraussetzung und Grundlage für die spätere schrittweise sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft. Daher wurden die ganz überwiegende Zustimmung zur Wahl der Nationalversammlung und die vielerorts erfolgte Proklamation der »sozialistischen« bzw. »sozialen« Republik seitens der Arbeiter- und Soldatenräte nicht als Widerspruch empfunden.
In diesem Sinne sah auch der mehrheitssozialdemokratische Abgeordnete Hans Vogel, ein Gegner aller linksradikalen Bestrebungen, das Ziel der Revolution, wie er im März 1919 in der Nationalversammlung ausführte, in der »Errichtung einer sozialistischen Republik auf demokratischem Wege« und in »organischer Entwicklung«9.
Mit dem aus der Fraktionierung in der Berliner Arbeiterschaft entstandenen sog. »Spartakusaufstand« und der Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts zerbrach im Januar 1919 die Einheit der revolutionären Bewegung endgültig. Die USPD gehörte der Regierung seit dem Jahreswechsel nicht mehr an. In der zweiten Phase der Revolution – dem Versuch, die Revolution zu sichern und weiterzutreiben – kam es zu einer Reihe lokaler Aufstände der radikalen Linken, in deren Verlauf auch »Räterepubliken« gegründet wurden, in erster Linie in Bremen (Januar/Februar 1919) und München (April 1919). Die lokalen Aufstände und Räterepubliken verfügten trotz teilweise beträchtlicher Massenmobilisierung über kein ausreichendes Gewicht, um auch nur vorübergehend die Machtfrage wirklich zu lösen. Das Lager der Aufständischen zerfiel durchweg an inneren Widersprüchen, noch bevor die gegenrevolutionären Freiwilligen-Einheiten, die »Freikorps«, im Auftrag der Reichsregierung in Aktion traten und mehrfach Zustände herbeiführten, für die der Ausdruck »weißer Terror« keine polemische Übertreibung ist.
Parallel zu diesen Kämpfen entstand jedoch, anknüpfend an die schon seit Ende November 1918 sich ausbreitenden ökonomischen Streiks, eine neue Massenbewegung, die einen anderen Charakter hatte als die Bewegung vom November/Dezember 1918. In den industriellen Zentren Deutschlands verlagerte sich das Schwergewicht des Kampfes von der staatlichen Ebene auf die Ebene der direkten Konfrontation von Arbeit und Kapital in den Betrieben. Die Bergarbeiter des Ruhrgebiets traten im Februar und im April 1919 in den Generalstreik, die mitteldeutschen Arbeiter im Februar, die Berliner Arbeiter Ende Februar/Anfang März. Auch in Oberschlesien, in Württemberg und an anderen Orten kam es zu General- oder Massenstreiks. Die Parole der »Sozialisierung« beschränkte sich hier keineswegs auf Verstaatlichung, sondern drückte – verbunden mit konkreten Forderungen nach besseren Lebens- und Arbeitsverhältnissen und insbesondere nach einem inner- und überbetrieblichen sog. »wirtschaftlichen« Rätesystem – das Verlangen der Arbeiter nach Selbstbestimmung und Selbstverwaltung aus.
Die Bewegung umfasste Arbeiter verschiedener politischen Richtungen. In erster Linie ging es hier aber nicht um ein Bündnis von politischen Parteien, sondern um neuartige Formen rätesozialistischer und quasi syndikalistischer Massenaktionen, die sich mit keiner Gruppierung ohne weiteres identifizieren lassen. Mit den Räten aus der ersten Phase der Revolution – soweit sie noch bestanden – hatte die spontane Streik- und Sozialisierungsbewegung, abgesehen von Ausnahmefällen, nicht direkt zu tun. Was die Bewegung an antikapitalistischer Radikalität gewann, büßte sie indessen an Breite ein. Der Novemberumsturz hatte gewiss die große Mehrheit des Volkes hinter sich, die Sozialisierungsbewegung vermutlich die Mehrheit der Arbeiter der Großbetriebe, aber wohl nur eine beträchtliche Minderheit der Bevölkerung insgesamt.
Die Staats- und Gesellschaftsordnung der ersten deutschen Republik war somit eine Resultante aus dem Sieg der demokratischen Arbeiter- und Volksbewegung im November 1918 und der, teilweise gewaltsamen, Eindämmung der weiterreichenden, durchaus unterschiedlichen Bestrebungen großer Teile der Arbeiterschaft im Winter und Frühjahr 1919. Die parlamentarische Demokratie in der Form der Republik trat an die Stelle der konstitutionellen Monarchie. Dem Reichstag, jetzt auch von den Frauen mitgewählt, stand nun das volle Sortiment zeitüblicher parlamentarischer Rechte zur Verfügung, auch wenn in der Verfassungswirklichkeit die Entscheidungsgewalt auf die präsidiale Staatsspitze und die parlamentsabhängige Regierung verteilt war. Gegenüber der Verfassung des Kaiserreichs von 1871 begründete die Weimarer Verfassung eine deutlich stärker unitarische Struktur; sie enthielt einen eigenen Grundrechtkatalog und ging vom Prinzip der Volkssouveränität aus.
Neu und wegweisend war aber nicht nur die repräsentativ-demokratische Staatsform, sondern auch die Idee des »sozialen Rechtsstaats«. Diese Idee negierte nicht den traditionellen liberalen Rechtsstaat, der jedoch durch neue soziale Inhalte erweitert werden sollte. Der fünfte Abschnitt (»Das Wirtschaftsleben«) in der neuen Reichsverfassung formulierte sozialstaatliche Grundsätze, gab dem Staat das Recht zur Vergesellschaftung von Unternehmen sowie zum Aufbau eines Systems der Gemeinwirtschaft und enthielt in Art. 165 Restelemente des Rätegedankens. In ihm war die Wahl von Betriebs-, Bezirks- und Reichsarbeiterräten festgelegt, die gemeinsam mit Unternehmern und anderen »beteiligten Volkskreisen« »Wirtschaftsräte« bilden sollten. Bei entsprechenden Parlamentsmehrheiten schien die Weimarer Reichsverfassung offen zu sein auch für den Aufbau einer sozialistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Jedenfalls waren die sozialdemokratischen Staats- und Verfassungsrechtler dieser Auffassung. Somit konnte man in der Weimarer Verfassung vom 11. August 1919 einen Basiskompromiss zwischen den sozialen Klassen und politischen Parteien sehen, genauer: zwischen der reformistischen Arbeiterbewegung und dem republikanisch orientierten bzw. der Republik aufgeschlossenen Teil des Bürgertums.
Zu diesem Basiskompromiss gehörte die am 15. November 1918 besiegelte Zentral-Arbeitsgemeinschaft (ZAG) der Spitzenverbände von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, durch die die Gewerkschaften von der Gegenseite erstmals generell als Tarifpartner anerkannt wurden. Für die Industriellen bedeutete das Abkommen vor allem eine Versicherung gegen drohende Entmachtung und Enteignung. Dennoch: mit den neuen Verhältnissen ging ein gewaltiger Aufschwung der Gewerkschaftsbewegung einher. Die Tarifvertragsverordnung der Regierung der Volksbeauftragten vom 23. Dezember 1918 leitete die Epoche des kollektiven Arbeitsrechts in Deutschland ein. Auch wenn die staatliche Gesetzgebung, vor allem mit der Einführung des Achtstundentags und der Erwerbslosenfürsorge, in der Umbruchsphase unmittelbar wirksame soziale Errungenschaften beinhaltete, trat der gesetzliche Schutz der Arbeitnehmer in seiner Bedeutung hinter die Ordnung der Arbeitsverhältnisse durch tarifvertragliche Vereinbarungen zweifellos zurück.
In diesen Zusammenhang gehörten auch die obligatorische Einrichtung von gewählten Vertretungskörperschaften der Arbeitnehmer in den Betrieben – anknüpfend an das Kriegs-Hilfsdienstgesetz vom Dezember 1916 – und die Regelung von deren Zuständigkeiten, insbesondere im Hinblick auf die innerbetrieblichen Mitbestimmungsrechte. Auch hier war der infolge der staatlichen Neuordnung erzielte Rechtsfortschritt erheblich. Doch zugleich beleuchtete das zähe Ringen um das Betriebsrätegesetz, wie weit die innenpolitische Polarisierung um die Jahreswende 1919/20 schon vorangeschritten war, die den Weimarer Basiskompromiss bereits nach wenigen Monaten bedrohte: Neben den Parteien der Rechten stimmte auch die USPD gegen das Gesetz, da ihr die vorgesehenen Betriebsräte lediglich als Kümmerform der revolutionären Betriebsräte von 1918/19 erschienen. Eine linke Massenkundgebung vor dem Reichstag am 13. Januar 1920 wurde von Sicherheitskräften beschossen; 42 Tote blieben zurück. Den daraufhin zum wiederholten Mal verhängten Ausnahmezustand empfanden weite Kreise der Arbeiterschaft, über die radikale Linke hinaus, als gegen sich gerichtet – man sprach von der »Noske-Politik« unter Bezugnahme auf den mehrheitssozialdemokratischen Reichswehrminister Gustav Noske, den Hauptverfechter der Zusammenarbeit mit dem alten Offizierkorps, er hatte schon in Kiel als Abgesandter der Berliner Regierung Anfang November 1918 eine wichtige Rolle gespielt – und die Arbeiter wandten sich, wie schon seit einem Jahr erkennbar, mehr und mehr der USPD zu.
Es spricht manches für die Annahme, mit der breiten und erfolgreichen Abwehr des Kapp-Lüttwitz-Putsches im März 1920 habe sich den Sozialisten und entschiedenen Republikanern noch einmal eine Chance aufgetan, Versäumnisse der ersten Nachkriegsmonate aufzuholen und die Demokratie durch eine deutliche Entmachtung der alten aristokratisch-großbürgerlichen Eliten zu fundieren. Eine nachhaltig Wende in der innenpolitischen Entwicklung Deutschlands, die seit Anfang 1919 in Richtung Gegenrevolution verlaufen war, wurde indessen unmöglich durch den Einsatz der Reichswehr gegen die aufständischen Ruhrarbeiter, die ihrem Selbstverständnis nach den Abwehrkampf der gesamten Arbeiterbewegung gegen den Putschversuch fortsetzen.
In Preußen, dem mit Abstand größten Gliedstaat des Deutschen Reiches, begann im Gefolge der Märzereignisse von 1920 unter einer neuen Führung von SPD und Regierung immerhin eine Auswechslung demokratiefeindlicher oder unzuverlässiger Beamter im Staatsapparat einschließlich der Polizei. Preußen wurde zum republikanischen »Bollwerk«, während in Bayern der Kapp-Putsch zu einer staatsstreichähnlichen Verschiebung der politischen Achse nach rechts genutzt wurde, die die Position des süddeutschen Freistaates als antirepublikanische »Ordnungszelle« befestigte.
Bei den Wahlen zur Nationalversammlung im Januar 1919 hatten die Parteien der Weimarer Koalition – die Mehrheitssozialdemokratie, die katholische Zentrumspartei und die liberale DDP – über drei Viertel der Stimmen erhalten, während SPD (37,9%) und USPD (7,6%) zusammen unterhalb der absoluten Mehrheit blieben. Doch entsprachen die parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse schon bald nicht mehr den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen: Nicht nur waren, von den politischen Amtsträgern abgesehen, im großen Ganzen die Männer der alten Eliten in Industrie, Finanzwesen und Landwirtschaft, Militär, Verwaltung und Justiz in ihren Positionen verblieben. Auch lehnte ein beträchtlicher Teil des bürgerlichen Spektrums die demokratische Republik ab. Die Reichstagswahlen im Juni 1920 ergaben denn auch nicht einmal mehr 50 % der Stimmen für die Weimarer Koalition.
Bei der Ablehnung der Republik, nicht zuletzt unter jungen Akademikern, spielten die Kriegsniederlage und der Versailler Frieden eine heute häufig unterschätzte bzw. fehlgedeutete Rolle. »Versailles« wurde auch in der Mitte und auf der Linken – nicht ohne Berechtigung – als Gewaltfrieden angesehen und nur unter äußerstem Widerstreben in der parlamentarischen Abstimmung angenommen. Das bewahrte die Republikaner, namentlich die Sozialdemokraten, nicht davor, mit einer hasserfüllten Kampagne gegen die »November-Verbrecher« konfrontiert zu werden. Die Unterstützung des Krieges von 1914-18 durch Burgfrieden und Kreditbewilligung machte es ihnen psychologisch sehr schwer, sozusagen den Spieß umzudrehen und die früheren Machthaber mit ihrer maximalistischen Kriegspolitik ihrerseits offensiv als »Reichsverderber« anzugreifen.
Man hat verschiedentlich die These aufgestellt, ein Fortbestehen der Monarchie nach dem Ersten Weltkrieg hätte die konservativen Kräfte eher mit der parlamentarischen Demokratie versöhnt10. Diese Annahme scheint mir in jeder Hinsicht fragwürdig. Erstens war die Monarchie am Ende des Krieges für breite Massen, nicht nur der Arbeiterschaft, das Symbol für Krieg, Militarismus, Hunger und Unterdrückung, und ein Festhalten der Mitte-Links-Parteien an der monarchischen Staatsform hätte von Anfang an viele auf die Seite der radikalen Linken getrieben. Zweitens ist bereits die Oktober-Reform von einem erheblichen Teil der alten Führungsschicht abgelehnt worden. Die Entscheidung zum Auslaufen der Hochseeflotte, die die Revolution Ende Oktober 1918 auslöste, war faktisch so etwas wie ein Staatsstreichversuch der Admiralität gegen den Verfassungswandel. Drittens war die europäische Demokratisierungsbewegung um und nach 1900 nicht nur in Deutschland von schweren innenpolitischen Auseinandersetzungen begleitet. Um erfolgreich zu sein, benötigte sie in der Regel die Schubkraft einer außerparlamentarischen Volksbewegung, häufig verbunden mit Massenstreiks oder sogar einem Generalstreik (wie in Belgien). Eine solche Massenbewegung hätte vermutlich gerade angesichts der Kriegsniederlage auch ohne Sturz der Monarchie eine längerfristige innenpolitische Polarisierung hervorgerufen. Um es zu wiederholen: die parlamentarische Demokratie war durch die Regierungsneubildung und durch die Verfassungsänderungen vom Oktober 1918 noch keineswegs gesichert.
Gewiss: Die revolutionäre Ablösung der Hohenzollernmonarchie und der übrigen Dynastien war dem Deutschen Reich nicht zwangsläufig vorherbestimmt. Es waren immer wieder andere Weichenstellungen möglich, und der internationale Vergleich macht deutlich, wie unstet die Entwicklung zur bzw. der parlamentarischen Demokratie auch in den westeuropäischen Ländern vor den 1950er Jahren verlief. Und ebenso wenig lässt sich der Untergang der Weimarer Republik 1933 aus den Entscheidungen und Unterlassungen von 1918/19 geradlinig ableiten. Es kann aber auch nicht bestritten werden, dass zu den Voraussetzungen des Aufstiegs der NSDAP neben dem Versailler Vertrag und der Weltwirtschaftskrise auch die innere Schwäche der Republik gehörte, die hauptsächlich aus ihrer revolutionär-gegenrevolutionären Entstehungsgeschichte resultierte. Es war das Spannungsverhältnis zwischen der demokratischen Verfassung und einer stark durch antidemokratische Kräfte geprägten gesellschaftlichen Wirklichkeit, das die Weimarer Republik in so hohem Maße krisenanfällig machte.
Durch revolutionäre Aktion der Soldaten und Arbeiter zustande gekommen, blieb die Demokratie von Weimar hinter den Erwartungen auch der gemäßigteren Teile der Volksbewegung zurück. Für eine von Anfang an große und später noch wachsende Fraktion des Bürgertums ging der Verfassungskompromiss indessen schon viel zu weit, indem er der reformistischen Arbeiterbewegung eine unerwünscht starke Machtposition beließ. Man identifizierte die neue, parlamentarisch-demokratische Ordnung nicht nur mit dem Versailler Frieden, sondern auch mit dem Sozial- oder (wie man rechts der Mitte meinte) »Gewerkschaftsstaat«. Einen Bruch mit der republikanischen Legalität und eine autoritäre Umbildung der Verfassung ließ in der Frühphase der Weimarer Republik die außenpolitische Abhängigkeit in Verbindung mit der wirtschaftlichen Instabilität nicht zu: weder im Frühjahr 1920 noch im Herbst 1923, als die vorübergehende Übertragung der vollziehenden Gewalt an General von Seeckt, jetzt Chef der Heeresleitung, manchen Beobachtern wie der Begin einer Militärdiktatur erschien.
In den Jahren 1924-28, einer Phase relativer Stabilisierung im politischen wie im wirtschaftlichen Bereich, schien sich dann die Mehrheit selbst des konservativen Bürgertums mehr und mehr mit der Republik abzufinden, symbolisiert durch den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, den legendären Feldherrn des Weltkriegs. Die mit dem gemäßigten Flügel der USPD wiedervereinigte Sozialdemokratie (die USPD-Linke hatte sich Ende 1920 mit der KPD zusammengeschlossen) befand sich in der Opposition, bildete aber – gerade auch für die auf Verständigung mit den Sieger gerichtete Außenpolitik Gustav Stresemanns – zusammen mit den Freien Gewerkschaften einen Faktor, der berücksichtigt werden musste. Doch angesichts der erwähnten Strukturmängel und der Unterlassungen in den ersten Monaten und Jahren nach dem Novembersturz von 1918 wurde das Sich-Einlassen der gemäßigten Rechten auf die parlamentarische Regierungsform nach 1923 konterkariert von einer Art schleichender Gegenrevolution mit dem Ziel einer autoritär-bürokratischen Veränderung des „Systems“. Die der Hitler-Diktatur vorausgehenden und ihr de facto in mancher Hinsicht vorarbeitenden präsidialen Notverordnungsregierungen der Jahre 1930-1932/33 – ermöglicht durch die Weltwirtschaftskrise – setzten das dann schrittweise in die Tat um. Arthur Rosenberg, der – aus der doppelten Perspektive des Fachhistorikers und Zeitzeugen – 1935 im Exil eine der ersten wissenschaftlichen Darstellungen der deutschen Geschichte nach 1918 veröffentlichte, ließ die Weimarer Republik im eigentlichen Sinn deshalb auch schon im Frühjahr 1930 enden, ohne dass er die neue Qualität des Einschnitts Anfang 1933 übersah11.
Auswahlbibliographie
I. Quellen
Allgemeiner Kongreß der Arbeiter und Soldatenräte Deutschlands vom 16.-21. Dezember 1918. Stenographische Berichte, Berlin (1919).
Brandt, P. u. Rürup, R., Bearb., Arbeiter-, Soldaten- und Volksräte in Baden 1918/19, Düsseldorf 1980.
Engel, G., Holtz, B. u. Materna, I., Bearb., Groß-Berliner Arbeiter- und Sodatenräte in der Revolution 1918/19, 2 Bde., Berlin 1933/97.
Hürten, H., Bearb., Zwischen Revolution und Kapp-Putsch. Militär und Innenpolitik 1918-1920, Düsseldorf 1977.
Kolb, E. u. Rürup, R., Bearb., Der Zentralrat der deutschen sozialistischen Republik, 19.12.1918 bis 4.8.1919. Vom ersten zum zweiten Rätekongreß, Leiden 1968.
Kolb, E. u. Schönhoven, K., Bearb., Regionale u. lokale Räteorganisationen in Württemberg 1918/19, Düsseldorf 1976.
Matthias, E. u. Morsey, R., Bearb., Die Regierung des Prinzen Max von Baden, Düsseldorf 1962.
Miller, S. u. Potthoff, H., Bearb., Die Regierung der Volksbeauftragten 1918/19, Düsseldorf 1966.
Miller, S. u. Ritter, G. A., Hg., Die deutsche Revolution 1918/19, Hamburg 19752
II. Literatur
Albertin, L., Liberalismus und Demokratie am Anfang der Weimarer Republik. Eine vergleichende Analyse der Deutschen Demokratischen Partei und der Deutschen Volkspartei, Düsseldorf 1972.
Arnold, V., Rätebewegung und Rätetheorien in der Novemberrevolution, Hamburg 19852
Bermbach, U., Vorformen parlamentarischer Kabinettsbildung in Deutschland, Köln/Opladen 1967.
Bieber, H.-J., Bürgertum in der Revolution. Bürgerräte und Bürgerstreiks in Deutschland 1918-1920, Hamburg 1992.
Bieber, H.-J., Gewerkschaften, Krieg und Revolution. Arbeiterbewegung, Industrie, Staat und Militär in Deutschland 1914-1920, 2. Bde, Hamburg 1981.
Brand, P. u. Rürup, R., Volksbewegung und demokratische Neuordnung in Baden 1918/19, Sigmaringen 1991.
Braunthal, J., Geschichte der Internationale, Bd. 2, Hannover 1963.
Carsten, F. L., Revolution in Mitteleuropa 1918-1919, Köln 1973.
Dähnhardt, D., Revolution in Kiel, Neumünster 1978.
Elben, W., Das Problem der Kontinuität in der deutschen Revolution. Die Politik der Staatssekretäre und der militärischen Führung vom November 1918 bis Februar 1919, Düsseldorf 1965.
Feldmann, G. D., Army, Industry and Labor in Germany, 1914-1918, Princeton N. J. 1966.
Grebing, H., Hg., Die deutsche Revolution 1918/19, Berlin 2008.
Huber, E. R., Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. V, Stuttgart 1978.
Kluge, U., Soldatenräte und Revolution. Studien zur Militärpolitik 1918/19, Göttingen 1975.
Kluge, U., Die deutsche Revolution 1918/19, Frankfurt 1985.
Kocka, J., Klassengesellschaft im Krieg. Deutsche Sozialgeschichte 1914 bis 1918, Göttingen 1973.
Kolb, E., Arbeiterräte in der deutschen Innenpolitik 1918-1919, Düsseldorf 1962.
Kolb, E., Hg., Vom Kaiserreich zur Weimarer Republik, Köln 1972.
Kolb, E., Die Weimarer Republik, München 1984 u. ö.
Kuckuk, P., Bremer Linksradikale bzw. Kommunisten von der Militärrevolte im November 1918 bis zum Kapp-Putsch im März 1920, Diss. phil., Hamburg 1970.
Lehnert, D., Sozialdemokratie und Novemberrevolution. Die Neuordnungsdebatte 1918/19 in der politischen Publizistik von SPD und USPD, Frankfurt 1983.
Lösche, P., Der Bolschewismus im Urteil der deutschen Sozialdemokratie 1903-1920, Berlin 1967.
Lukas, E., Zwei Formen von Radikalismus der deutschen Arbeiterbewegung, Frankfurt 1976.
Maier, C., Recasting Bourgeois Europe. Stabilization in France, Germany and Italy in the Decade after World War I, Princeton N. J. 1975.
Matthias, E., Zwischen Räten und Geheimräten. Die deutsche Revolutionsregierung 1918/1919, Düsseldorf 1970.
Miller, S., Burgfrieden und Klassenkampf. Die deutsche Sozialdemokratie im Ersten Weltkrieg, Düsseldorf 1974.
Miller, S., Die Bürde der Macht. Die deutsche Sozialdemokratie 1918-1920, Düsseldorf 1979.
Mitchell, A., Revolution in Bayern 1918/19, München 1967.
Morgan, D. W., Socialist Left and the German Revolution: A History of the Independent Social Democratic Party, 1917-1922, Ithaca N. Y. 1975.
Nipperdey, T., Deutsche Geschichte 1866-1918, München, 2 Bde., 1990/92.
v. Oertzen, P., Betriebsräte in der Novemberrevolution, Düsseldorf 1963.
Potthoff, H., Gewerkschaften und Politik zwischen Revolution und Inflation, Düsseldorf 1979.
Rürup, R., Hg., Arbeiter- und Soldatenräte im rheinisch-westfälischen Industriegebiet. Studien zur Geschichte der Revolution 1918/19, Wuppertal 1975.
Schwabe, K., Deutsche Revolution und Wilson-Friede, Düsseldorf 1971.
Wehler, H.-U., Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bde.3 u. 4, München 1995, 2003.
Winkler, H. A., Von der Revolution zur Stabilisierung. Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1918 bis 1924, Berlin 1984.
Winkler, H. A., Weimar 1918-1933, München 1993.
1 Erweiterte und für den Druck überarbeitete Fassung eines in zwei Versionen am 07.11.2008 in Kiel und am 01.12.2008 in Bremen gehaltenen Vortrags. – Im Hinblick auf den Charakter des Textes werden im Folgenden lediglich wörtliche und indirekte Zitate extra belegt. Siehe ansonsten die Auswahlbibliographie im Anschluss.
2 Zitate nach D. Lehnert, Sozialdemokratie und Novemberrevolution, Frankfurt 1983, S. 73, 92, 100; E. Kolb, Revolutionsbilder: 1918/19 im zeitgenössischen Bewußtsein und in der historischen Forschung, Heidelberg 1993, S. 7.
3 Verhandlungen der verfassunggebenden Deutschen Nationalversammlung, Bd. 328, Berlin 1920
Der historische Ort der deutschen Revolution von 1918/191
Peter BrandtDie Zeitungen der Sozialdemokratie feierten Mitte November 1918 die Vorgänge der zurückliegenden Tage mit Worten wie, die Deutschen seien jetzt »das freieste Volk der Welt«. »Ein Volk, durch Jahrhunderte hindurch von den harten Händen des Militarismus und der Bürokratie niedergehalten, zu Knechtseligkeit und dumpfem Gehorsam erzogen, steht auf und handelt.« »Wir haben endlich die revolutionäre Tradition, um die wir andere Völker bisher beneidet haben.« Und auch der bekannte liberale Journalist Theodor Wolff sprach in Berlin von »der größten aller Revolutionen«2.
Der württembergische Abgeordnete der soeben gewählten Nationalversammlung interpretierte Mitte Februar 1919 das Geschehen seit dem Herbst 1918 als nachträgliche Vollendung der 70 Jahre zuvor – 1848/49 – versäumten bürgerlichen Revolution. »Erst die Arbeiterschaft hat der Junkerherrschaft in Deutschland…für immer ein Ende bereitet.« Das sei geschehen in einer Revolution »ohne Blutvergießen«, die übergegangen sei in die gesetzliche Arbeit der Konstituante, ihrerseits ein »Zeichen der fortdauernden Revolution«3
Monate später zog Rudolf Wissell, 1919 einige Zeit Wirtschaftsminister, auf dem ersten Nachkriegsparteitag der SPD eine ganz andere Bilanz: »Trotz der Revolution«, so meinte er, »sieht sich das Volk in seinen Erwartungen enttäuscht ... Wir haben die formale politische Demokratie weiter ausgebaut ... [Doch] wir konnten den dumpfen Groll, der in den Massen steckt, nicht befriedigen ... Wir haben im wesentlichen in den alten Formen unseres staatlichen Lebens regiert«4
»Trotz der Revolution« - dass es tatsächlich eine Revolution in Deutschland gegeben hatte, wurde in den ersten Jahren der Weimarer Republik kaum bestritten, anders als später, da man die Vorgänge der frühen Nachkriegszeit – sofern man sie nicht als »Pöbelrevolte« ohne gestaltende Kraft diffamierte – lediglich als Reflex des »Zusammenbruchs« eines überlebten und militärisch geschlagenen Systems begreifen wollte.
Doch jede Revolution ist an die Zersetzung der vorrevolutionären Ordnung geknüpft und beginnt damit. Die revolutionäre Massenbewegung von 1918/19 war nicht ein Phänomen weniger Tage zur Zeit des Staatsumsturzes, sondern hielt – in zwei deutlich voneinander zu unterscheidenden Phasen - ununterbrochen bis weit in das Frühjahr 1919 an; sie erlebte noch einmal einen Aufschwung im Generalstreik gegen den Kapp-Putsch und in den Kämpfen der sog. »Roten Ruhrarmee« im Frühjahr 1920.
Diese Revolution war alles drei zugleich: Endpunkt jahrzehntelanger Liberalisierungs- und Demokratisierungsbestrebungen, spontane Volkserhebung zur Beendigung des faktisch schon verlorenen Krieges und sozialdemokratisch geprägte Klassenbewegung mit antikapitalistischer Tendenz. Die Verschränkung liberal-demokratischer, antimilitaristischer und proletarisch-sozialistischer Komponenten in der Revolution ergab sich aus dem Charakter des Kaiserreichs von 1871 und der Doppelrolle der sozialdemokratischen Bewegung in ihr als Organisation der klassenbewussten Arbeiter wie als einzige starke Kraft, die ohne Einschränkung für die politische Demokratisierung des Deutschen Reiches eintrat.
Das wilhelminische Deutsche Reich war ein Rechts- und Verfassungsstaat mit einem regen kulturellen und politischen Leben – ökonomisch und wissenschaftlich in Europa an der Spitze –, aber gleichzeitig unterschied sich die staatliche und soziale Ordnung des Kaiserreichs durch das Übergewicht der monarchischen Exekutive, abgesichert durch die gleichsam außerkonstitutionelle Stellung des Militärs, doch nicht unerheblich von denjenigen kapitalistischen Gesellschaften, die parlamentarisch-demokratisch verfasst waren, auch wenn das auf Reichsebene geltende allgemeine, gleiche Männerwahlrecht im internationalen Vergleich ausgesprochen fortschrittlich war. Nicht zuletzt blieb die sozialdemokratische Arbeiterbewegung (schon seit 1890 war die SPD die wählerstärkste Partei) aus dem politischen Geschäft bis 1914 weitgehend ausgegrenzt und auf allen Ebenen einer teilweise sehr empfindlichen Drangsalierung ausgesetzt5
Angesichts des scheinbar kaum aufzuhaltenden Vormarschs der Arbeiterbewegung sahen die Schwerindustriellen, aber auch andere Unternehmer ihre sozialen Interessen am besten bei dem bestehenden System aufgehoben. Zumindest schien es sehr riskant, die Machtposition der ostelbisch geprägten Gutsbesitzer-, Beamten- und Militäraristokratie, also der politisch bestimmenden Schicht, zu beseitigen, auch wenn deren Beibehaltung bedeutete, dass die materielle Position der Agrarier durch Außenzölle künstlich gestützt werden musste. Aus diesem Grund und nicht nur wegen ideologischer Vorbehalte musste jeder Versuch, die bestehende politische Ordnung zu demokratisieren, von vornherein mit dem entschiedenen Widerstand nicht allein der aristokratisch-bürokratisch-militärischen Kräfte, sondern auch eines Teils des Großbürgertums sowie mit der Skepsis eines weiteren Teils rechnen. Dazu kam die antiliberale Orientierung eines Großteils der Bauern und des »alten Mittelstands«, die ihre Interessen am ehesten durch die von der konservativen Rechten verfochtene protektionistische Wirtschaftspolitik gewahrt sahen.
Immerhin: In allen Reichstagsfraktionen jenseits der Konservativen gab es in unterschiedlicher Stärke, aber in zunehmendem Maß Gruppierungen, die auf Reformen drangen. Aber keine der nichtsozialistischen Parteien trat vorbehaltlos gleichermaßen für Parlamentarisierung und Demokratisierung ein. Die Linksliberalen befürworteten die schrittweise Einführung einer parlamentarischen Monarchie und das gleiche Wahlrecht für Preußen, schreckten aber vor der Forderung nach Abschaffung des Klassenwahlrechts bei den Gemeindewahlen zurück, um nicht ihre letzten Bastionen in der SPD zu verlieren. Das katholische Zentrum und die Nationalliberalen standen dem Parlamentarismus mehrheitlich bis 1914 und darüber hinaus ängstlich und skeptisch gegenüber, wenn sie auch Schritte in diese Richtung bejahten; das preußische Dreiklassenwahlrecht wollten die meisten von ihnen nicht einfach dem Reichstagswahlrecht angleichen, sondern durch eine mildere Form ungleichen Wahlrechts ersetzen.
Für dieses Zögern spielte die Existenz der SPD eine zentrale Rolle. Deren Stimmenanteil betrug bei den Reichstagswahlen nach 1900 zwischen 29% und 35%. Die gemäßigte Mitte fürchtete – ebenso wie die Rechte – die von der SPD propagierte soziale Revolution durch den Stimmzettel. In der SPD, zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch ganz überwiegend eine Facharbeiterpartei, hatte sich zwar längst eine Politik der praktischen sozialen Verbesserungen durchgesetzt. Eine durchdachte Reformstrategie, die über den tagespolitischen Praktizismus hinausging, propagierte jedoch nur eine Minderheit von namentlich in Süddeutschland beheimateten Reformisten.
Manche Historiker haben – wie auch viele Zeitgenossen gerade aus dem liberalen Lager – die vermeintliche marxistische Orthodoxie und die Unbeweglichkeit der SPD für das Scheitern einer grundlegenden Reform des Kaiserreichs mitverantwortlich gemacht. Dabei bleibt außer Acht, dass die Diskrepanz zwischen praktischer Tagespolitik in Gewerkschaften und Kommunen und der theoretischen Unversöhnlichkeit des Klassenstandpunkts für die meisten Sozialdemokraten den Zwiespälten eigener Erfahrungen in der wilhelminischen Gesellschaft entsprach. Auf der Gegenseite stellten zwar alle bürgerlichen Parteien ihrerseits die prinzipielle Gegnerschaft zur Sozialdemokratie heraus. Gleichzeitig aber trug gerade die Bedrohung durch eine als Konkurrentin um Wählerstimmen erfolgreiche, vermeintlich revolutionäre Arbeiterbewegung maßgeblich dazu bei, bei den bürgerlichen Parteien in den unmittelbaren Vorkriegsjahren die Einsicht zu fördern, dass eine Reformpolitik nötig und der Bruch mit den Großagrariern unvermeidlich sei. Denn nur einer liberalisierenden und in Maßen demokratisierenden Politik (einschließlich der von rechts behinderten Weiterführung einer fortschrittlichen Sozialpolitik) traute man die Konsolidierung bürgerlicher Herrschaft zu. Insofern war die Wirkung der Sozialdemokratie auf die oppositionelle Energie des Bürgertums durchaus ambivalent.
Allerdings: Was sich andeutete und teilweise vollzog, war eine neue Austarierung des Gleichgewichts der Verfassungsorgane und der staatstragenden Sozialgruppen und Parteien, nicht jedoch der Durchbruch zur politischen Demokratie. Die Seniorpartner von 1871, die Konservativen und ihre Trägerschichten, waren dabei, zu Juniorpartnern zu werden. Der Agrarprotektionismus war selbst für die Schwerindustriellen in der früheren Rigorosität nicht mehr akzeptabel. Die Staatsstreich-Option wurde zwar gedanklich durchgespielt, aber – gerade angesichts der Kriegsgefahr – von den wichtigen Entscheidungsträgern verworfen.
Bei unbestreitbarer sukzessiver Konzentration politischen Einflusses im Reichstag blieb die Mitwirkung der SPD beim Zustandekommen von Gesetzen die Ausnahme, während sich auf Reichs- wie auf Landesebene die alltägliche Repression gegen die Arbeiterbewegung in den letzten Vorkriegsjahren wieder verschärfte, und das auch im relativ liberalen Süddeutschland. Eine umstandslose Integration der SPD ins politische System lehnten auch die Reformpolitiker aus den Reihen der Nationalliberalen und der Zentrumspartei eindeutig ab. Gleichzeitig war die katholische Arbeiterbewegung innerhalb des Zentrums mehr denn je an den Rand gedrängt. Das enorme Konfliktpotential der späten wilhelminischen Gesellschaft konnte von dem mancher autoritärer Elemente des Bismarckreichs entkleideten Halbparlamentarismus, wie er sich unmittelbar vor 1914 abzeichnete, keinesfalls abgebaut werden.
Der Erste Weltkrieg aktualisierte und verschärfte – nicht nur in Deutschland – dann alle in der Gesellschaft strukturell angelegten Widersprüche. Spätestens seit dem Frühjahr 1917 lässt sich von einer Massenbewegung der Arbeiterschaft sprechen, die sich gegen die unzureichende Lebensmittelversorgung, gegen politische Unterdrückung und die Kriegspolitik der Herrschenden wandte. Der soziale Protest und das Friedensverlangen wurden besonders durch den Sturz des Zarismus und die revolutionäre Entwicklung in Russland bestärkt.
Die SPD hatte sich 1914 dem sog. »Burgfrieden« angeschlossen, wobei, neben der Einschätzung des Krieges als eines Verteidigungskriegs, auch die Hoffnung auf innenpolitische Reformen eine Rolle spielte. Von der Parteimehrheit spalteten sich – endgültig Ostern 1917 – die USPD ab, eine relativ lose Föderation aller pazifistischen und antimilitaristischen Gruppen der Sozialdemokratie; zu ihr gehörte neben dem führenden Theoretiker des Parteizentrums, Karl Kautsky, z. B. auch der Protagonist des Revisionismus, Eduard Bernstein, außerdem die kleine, radikal-linke Spartakusgruppe mit Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg.
Neben der proletarisch-sozialistischen Opposition entwickelte sich eine breitere, aber weniger zielgerichtete Unzufriedenheit aller Schichten, die nicht vom Krieg profitierten. Der Protest entzündete sich ebenfalls vor allem am Problem der Lebensmittelversorgung. Noch stärker als die unzureichende Menge wirkten die ungleiche Verteilung und der »Schwarze Markt« als Provokation. Die abhängigen Mittelschichten – Angestellte und Beamte – wurden in ihrer Lebenshaltung im Verlauf des Krieges durch die Teuerung stark gedrückt und den Arbeitern angenähert, worauf Teile mit einer begrenzten (und vorübergehenden) Linkswendung reagierten. Das selbstständige Kleinbürgertum und die Bauern sahen sich angesichts der kriegswirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen als Opfer eines die Großindustrie begünstigenden staatlichen Dirigismus. Der Hass auf »den Staat«, »das große Geld« und »die Industrie«, teilweise auch »die Juden« und – in Süd- und Westdeutschland – »die Preußen« bildeten den Gegenstand kleinbürgerlich-bäuerlichen Unmuts. Auch große Teile der bürgerlichen Intelligenz waren gegen Ende des Krieges tief desillusioniert.
Nach den Entbehrungen der Kriegszeit war somit auch außerhalb der Arbeiterschaft die Vorstellung weit verbreitet, dass es zu grundlegenden Neuerungen kommen müsse, um die Sterilität des wilhelminischen Obrigkeitsstaats zu überwinden. Es war eine diffuse Aufbruchstimmung, die bei Enttäuschungen schnell wieder umschlagen konnte.
Zwar trieben die Parlamentsfraktionen der späteren Weimarer Koalition, - im Interfraktionellen Ausschuss zusammengefasst: neben den Sozialdemokraten die Linksliberalen, zeitweise sogar die Nationalliberalen, sowie die Zentrumskatholiken, die ihre früheren Vorbehalte gegen die Einführung des parlamentarischen Regierungssystems zumindest im Sinne eines »negativen Parlamentarismus«, demzufolge der Reichskanzler künftig nicht mehr gegen die Reichstagsmehrheit regieren sollte, abbauten – in der zweiten Kriegshälfte die faktische Parlamentarisierung des Kaiserreichs voran und bemühten sich um einen Verständigungsfrieden mit den Kriegsgegnern, doch vermochten sie die in zentralen Bereichen fast diktatorische Machtposition der Obersten Heeresleitung nicht zurückzudrängen, geschweige denn: zu brechen. Weil dem Kaiser und seinem Reichskanzler zwischen den Parlamentarisierungsbestrebungen und der Tendenz zur Militärdiktatur kaum noch ein eigener Entscheidungsspielraum blieb, war die Monarchie am Ende des Weltkriegs ausgehöhlt.
Mit dem Frühjahr 1917 hatte in ganz Europa ein beispielloser Aufschwung der Arbeiterbewegung eingesetzt, der drei bis vier Jahre anhielt und dann in der ersten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit und dem Wiedererstarken der bürgerlichen Ordnung (in Italien im Aufkommen des Faschismus) sein Ende fand. In Russland endete parallel dazu der Bürgerkrieg mit dem Sieg der Bolschewiki, der zugleich das endgültige Verbot der anderen sozialistischen Parteien und die Unterdrückung auch der Arbeiteropposition mit sich brachte.
Der Aufschwung der Jahre 1917-1920/21, Ausdruck einer durch den Krieg ausgelösten tiefen Krise der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, erfasste mehr oder weniger alle Länder, die am Krieg beteiligten und die neutralen, und er galt für die revolutionäre und zugleich für die reformistische Richtung. Spektakuläre Niederlagen, wie der Schweizer Landesstreik vom November 1918 und der etwa gleichzeitige Generalstreik in Portugal, können diese Aussage lediglich relativieren. Nicht nur in den Nachfolgestaaten der geschlagenen Ost- und Mittelmächte, sondern auch in einer ganzen Reihe west- und nordeuropäischer Staaten, in erster Linie in Großbritannien, traten kurz nach Kriegsende demokratisierende Wahlrechtsänderungen in Kraft. Die Gewerkschaften expandierten teilweise explosionsartig und konnten vielfach langjährige Forderungen der Arbeiterbewegung nach allgemeiner Arbeitszeitverkürzung und nach erweiterter sozialer Sicherung sowie teilweise beachtliche Reallohnerhöhungen durchsetzen. Es kam vermehrt zu sozialdemokratischen Regierungsbeteiligungen. Von noch größerer Dramatik war die radikal-revolutionäre Welle, die im März 1917 in Russland angestoßen wurde und mit den ergebnislosen Fabrikbesetzungen und Agrarunruhen in Italien im Sommer und Herbst 1920 auszulaufen begann. Diesen internationalen Zusammenhang gilt es, bei dem Blick auf die deutschen Ereignisse stets im Auge zu behalten:
Die nach dem Eingeständnis der militärischen Niederlage im Frühherbst 1918 von der Obersten Heeresleitung initiierte sog. Oktober-Reform machte Deutschland zu einer parlamentarischen Monarchie nach britischem Vorbild. Der neuen Regierung traten Vertreter der Liberalen, des Zentrums und der SPD bei. Dieser Versuch, der Revolution durch die Selbstreform des alten Systems zuvorzukommen, hat manche Beobachter veranlasst zu meinen, der Aufstand vom November sei lediglich ein Missverständnis gewesen, da bereits alles Wesentliche durchgesetzt gewesen sei, was die Massen erstrebt hätten. Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass sich die politischen Ziele der Bewegung auf die Durchsetzung des parlamentarischen Regierungssystems reduzieren lassen (was nicht zutrifft), war doch das erste unmittelbare Ziel, der Friedensschluss, noch keineswegs gesichert. Vor allem war die Machtstellung des Militärs im Reichsinnern, namentlich die diktatorische Gewalt der Kommandieren Generäle, nicht beseitigt. Die Reform hätte bei Änderung der militärischen oder politischen Konjunktur unter Umständen zurückgenommen werden können; erst der Umsturz vom November 1918 hat diese Möglichkeit definitiv ausgeschlossen.
Revolutionen werden nicht »gemacht« von bewussten Revolutionären, sondern entstehen aus spontanem Aufbegehren unzufriedener Volksmassen, dem – um es zu wiederholen – ein Erosionsprozess des herrschenden Systems vorausgeht. Obwohl die Ereignisse in Deutschland in der zweiten Jahreshälfte 1918 auf den Zusammenbruch der alten Ordnung zutrieben, erwiesen sich die Vorbereitungen der bewusst revolutionären Gruppen auf den Aufstand als meist wenig bedeutsam für den Verlauf der Umsturzbewegung, die – ausgehend von der Meuterei in der Hochseeflotte und von den Seehäfen – wie ein Lauffeuer durch das Reich ging.
In Kiel, einer Stadt mit zehntausenden vor dem Generalstreik stehender Werftarbeiter, wurde die Matrosenmeuterei zur Massenerhebung der Soldaten des Heimatheeres und der Arbeiter – zur Revolution. Bis zum Mittag des 4. November standen alle Schiffe, der Hafen und die große Marine-Garnison unter der roten Fahne. In den Folgetagen trugen die Matrosen von Kiel den Funken der Empörung gegen das verhasste Militärsystem in viele weitere Orte. Die 14 Punkte des Forderungskatalogs, den die Kieler Soldatendeputierten für verbindlich erklärten6, waren gerade in ihrer Unklarheit und in ihrer Beschränkung auf die Sphäre des Militärischen ein authentischer Ausdruck der spontanen Massenbewegung.
Die Betonung des spontanen Charakters des Umsturzes bedeutet nicht, dass existierende Gruppenbildungen („Netzwerke“, wie man heute sagt) im Moment des Umbruchs nicht doch noch relevant geworden wären. Das gilt etwa für die der USPD angehörenden »Revolutionären Obleute« in Berlin, die in den Metallbetrieben und im freigewerkschaftlichen Metallarbeiterverband stark verankert waren.
Der Aufstand breitete sich zwischen dem 4. und 9. November von den Küstenstädten ins Innere Deutschlands aus. Bereits am 7. November stürzten in München die bayerische Regierung und die Monarchie. Auch auf die Fronttruppen war jetzt kein Verlass mehr: Eine Befragung von 39 Offizieren der erreichbaren Kampfabschnitte seitens der Armeeführung über die Stimmung im Heer und die Loyalität gegenüber dem Kaiser hatte am 8. November überwiegend negative Antworten zur Folge. Kaiser Wilhelm II. ging vom Hauptquartier im belgischen Spa, wohin er am 29. Oktober ausgewichen war, am Morgen des 10. November nach Holland ins Exil.
Dass der Aufstand – meist widerstandslos – in großen Teilen des Reiches schon gesiegt hatte und im Rest des Landes in Gang gekommen war, verringerte die Chance militärischer Gegenwehr seitens der alten Gewalten in entscheidendem Maße, als die revolutionäre Welle am 9. November die Reichshauptstadt Berlin erreichte. Mit dem Umsturz in Berlin war der Erfolg des Aufstands gesichert, wenngleich der Wechsel in vielen, insbesondere kleineren Städten erst in den folgenden Tagen vollzogen wurde.
Zwischen 8 und 10 Uhr am Morgen des 9. November begann der Generalstreik in den Berliner Großbetrieben, aber auch in vielen kleineren Betrieben. Aus den Fabriken formierten sich Demonstrationszüge, die sich zu den Kasernen bewegten, um die Soldaten zur Verbrüderung aufzurufen und die Offiziere zu entwaffnen. Die Initiative lag jetzt also bei den Industriearbeitern. Abgesehen von einigen, meist kleineren Schießereien, die allerdings an einer Stelle drei zivile Todesopfer forderten, weigerten sich die Truppen überall, gegen die unbewaffneten Demonstranten vorzugehen. Als Reichskanzler Max von Baden mittags eigenmächtig die Abdankung des Kaisers bekannt gab, waren die Würfel bereits gefallen. Bevor Karl Liebknecht gegen 16 Uhr vom Schloss aus die »Freie Sozialistische Republik« proklamierte, hatte Philipp Scheidemann um 14 Uhr vom Reichstag aus die »Deutsche Republik« ausgerufen. Im letzten Moment hatte sich somit die mehrheitssozialdemokratische Führung an die Spitze der Volksbewegung gesetzt und namentlich die Soldaten auf ihre Seite gebracht. Man hatte die Revolution durch das Vorantreiben der Staatsreform zu vermeiden gesucht und ging jetzt daran, sie quasi zu adoptieren.
Reichskanzler Max von Baden hatte, jenseits seiner verfassungsmäßigen Kompetenzen, dem SPD-Vorsitzenden Friedrich Ebert in einer Besprechung mit führenden Sozialdemokraten die Geschäfte des Reichskanzlers übergeben, die Ebert im Rahmen der Reichsverfassung auszuüben versprach. Zugleich wurde schon die Idee einer verfassunggebenden Nationalversammlung erörtert. Auch wenn die sog. „Reichskanzlerschaft“ Eberts in der beabsichtigten Form nur einige Stunden dauerte, war der Kontinuität suggerierende Vorgang wichtig für die Autorität des SPD-Spitzenmanns bei den alten Amtsträgern aller Ebenen, nachdem die doppelte Ausrufung der Republik sowie die Übernahme der militärischen Gewalt seitens der Soldatenräte auch in Berlin neue Tatsachen geschaffen hatten.
Der Verlauf des Umsturzes in Berlin bedeutete eine wichtige Weichenstellung für den gesamten weiteren Gang der deutschen Revolution. In einer beachtlichen taktischen Leistung hatte die Mehrheitssozialdemokratie den Übergang vom Kaiserreich zur Republik aus der Regierungsbeteiligung (die erst am 9. November beendet wurde) über die Bündelung außerparlamentarischen Drucks, wobei die rebellierenden Massen den Forderungen der Partei nach Abdankung des Kaisers und nach Umbildung der Reichsregierung Nachdruck verleihen sollten, bis zum Bruch mit der Verfassungslegalität unter Kontrolle gehalten.
Trotzdem waren die Kräfteverhältnisse noch nicht klar einzuschätzen. Jedenfalls verlangte die Basis, soweit erkennbar, eine Verständigung der beiden sozialdemokratischen Parteien. Die SPD bot der USPD am Abend des 9. November den Eintritt in die neue Regierung an. Die Gegenforderungen der USPD, aufgestellt bei Abwesenheit des Vorsitzenden, während prominente Männer des linken Flügels mitgewirkt hatten, liefen auf die Installation einer sozialistischen Räterepublik hinaus, und selbst unter diesen Umständen wollten die Unabhängigen Sozialdemokraten ursprünglich nur wenige Tage ( bis zum Waffenstillstand) die Verantwortung für das Regierungshandeln übernehmen. Dass der SPD-Vorstand nach anfänglicher Zurückweisung der USPD-Forderungen am folgenden Nachmittag dann die reduzierten und modifizierten Bedingungen der USPD (sie waren jetzt ohne Beteiligung von Vertretern der Linksradikalen zustande gekommen) akzeptierte, war den über Nacht veränderten Machtverhältnissen geschuldet. Anstelle des improvisierten, mehrheitssozialdemokratisch ausgerichteten Arbeiter- und Soldatenrats vom 9. November hatten die Revolutionären Obleute in den Betrieben Wahlen für eine Berliner Räte-Vollversammlung in Gang gebracht, die am Abend des 10. November im Zirkus Busch zusammentreten und eine neue, revolutionäre Reichsregierung bestimmen sollte. Somit schien es der SPD-Spitze unbedingt geboten, vor der schwer kalkulierbaren Versammlung im Zirkus Busch zu einer Einigung mit der USPD zu gelangen.
Der zwischen beiden sozialdemokratischen Führungsgremien erzielte Kompromiss deutete auf substantielle Zugeständnisse der Mehrheits-SPD hin. Die Frage der Konstituierenden Versammlung wurde zurückgestellt bis zur Konsolidierung der neuen Verhältnisse. Zumindest so lange sollte die politische Gewalt in den Händen der Arbeiter- und Soldatenräte bleiben, die »alsbald« reichsweit zu einem Kongress zusammenzurufen seien. Insofern war Deutschland vorübergehend zu einer Räterepublik geworden, die von einem in paritätischer Besetzung aus beiden sozialdemokratischen Parteien gebildeten »Rat der Volksbeauftragten« regiert wurde7
Doch faktisch vermochten die Mehrheitssozialdemokraten binnen zwei bis drei Wochen die Frage: Rätedemokratie oder parlamentarische Demokratie, in ihrem Sinne zu entscheiden. Damit wurden auch alle Überlegungen, die Wahl der Nationalversammlung einige Monate zu verzögern bzw. das parlamentarische System durch Räteelemente zu ergänzen, etwa durch eine »wirtschaftliche« Räteorganisation, in den Bereich des Unwahrscheinlichen verwiesen.
Die erwähnte Vollversammlung der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte im Zirkus Busch am Abend des 10. November 1918 legitimierte die Einigung der sozialdemokratischen Parteien über die Regierungsbildung. Zugleich wählte sie als Kontrollinstanz einen »Vollzugsrat«, in dem die Revolutionären Obleute eine starke Position besaßen, aber wegen der gleichgewichtigen Beteiligung der Soldaten trotzdem in der Minderheit waren. Hauptsächlich deshalb konnte die Regierung der Volksbeauftragten den Machtanspruch des Vollzugsrats konterkarieren und binnen kurzer Zeit ausschalten. Beim Kampf um die frühest mögliche Einberufung der Nationalversammlung, an der die SPD-Volksbeauftragten unbedingt festhielten, gerieten der Vollzugsrat und in seinem Gefolge die USPD-Volksbeauftragten, denen es mehrheitlich nicht um die Installation eines Rätesystems ging, von Anfang an in die Defensive. Vor allem aus den preußischen Provinzen und, mehr noch, aus den nichtpreußischen Einzelstaaten artikulierten die Arbeiter- und Soldatenräte den Wunsch nach der Nationalversammlung. Am 26. November einigte sich der Rat der Volksbeauftragten auf den 16. Februar 1919 als Wahltermin; ein Wahlgesetz wurde kurz darauf publiziert. Die wichtigsten Neuerungen darin waren das Frauenwahlrecht und das Verhältniswahlsystem. Als dann vom 16. bis 20. Dezember 1918 in Berlin der Reichsrätekongress tagte, beschloss er mit großer Mehrheit die Abhaltung der Wahl bereits am 19. Januar.
Auch im System des »real existierenden Sozialismus« haben sich oppositionelle Massenbewegungen in Arbeiterräten organisiert: Kronstadt 1921, rudimentär Ostdeutschland 1953, deutlicher Polen und Ungarn 1956, China nach 1966, Tschechoslowakei 1968 und Polen ab 1980. Gewiss lassen sich gute Argumente dafür anführen, dass eine von Räten getragene direkte Demokratie als Regierungssystem nicht funktionieren kann, besonders in einer modernen Industriegesellschaft. Das ändert aber nichts an der Leistungsfähigkeit von Räten als Kampforganen hinsichtlich ihrer Offenheit und vereinheitlichenden Mobilisierungsfähigkeit. In den jüngsten demokratischen Umwälzungen Mittel- und Osteuropas haben Räteorgane deshalb keine wesentliche Rolle gespielt, weil die Arbeiterschaft als Klasse – im Unterschied zu den 1950er Jahren – nicht oder nicht mehr die Haupttriebkraft der Bewegung darstellte.
Was die Bewegung von 1918/19 in Deutschland betrifft, gab es aber nicht nur keine nennenswerte »bolschewistische« oder quasibolschewistische Kraft, sondern die bestehenden linksradikalen Gruppen – linkssozialistischen oder anarcho-kommunistischen Zuschnitts – waren auch viel zu schwach, um der realen Rätebewegung ihren Stempel aufzudrücken. Insofern ist die Frage nach dem Charakter und der prinzipiellen Durchführbarkeit eines »reinen Rätesystems«, wie es dann konzeptionell entwickelt wurde, im Zusammenhang unseres Themas allenfalls von untergeordneter Bedeutung.
Wie muss man sich die »Räte« in Deutschland 1918/19 vorstellen? Ohne damit zunächst eine längerfristige politische Perspektive zu verbinden, schufen sich die aufständischen Massen seit Anfang November nach russischem Vorbild und in Erinnerung an die großen Januarstreiks des Jahres eigene Vertretungsorgane. Die Soldaten wählten – entsprechend den vorgegebenen militärischen Einheiten – »Soldatenräte«. Die Soldatenräte traten nicht an die Stelle, sondern neben die alte militärische Struktur. Die jeweiligen militärischen Führungsinstanzen erkannten sie durchweg an und sagten Zusammenarbeit zu. In den Soldatenräten waren vielfach auch Offiziere vertreten, vor allem aber mittlere Ränge. Von der sozialen Zusammensetzung her war das kleinbürgerliche Element mindestens so stark vertreten wie das proletarische. Es kann daher nicht verwundern, dass die Soldatenräte innerhalb der revolutionären Bewegung eher auf dem rechten Flügel standen.
Die „Arbeiterräte“, deren Bildung im allgemeinen von einem Generalstreik begleitet war, wurden teilweise, wie in einer Reihe großer Städte, in den Betrieben gewählt, häufiger aber gingen sie aus einer Absprache der örtlichen Parteiführungen von SPD und USPD hervor, teils unter Einschluss von Freien Gewerkschaften, manchmal auch nichtsozialistischer Arbeitnehmer-Organisationen. Verschiedentlich wurden Arbeiterräte auch auf »Volksversammlungen« gebildet bzw. bestätigt. Normalerweise schlossen sich Soldatenrat und Arbeiterrat am jeweiligen Ort zum »Arbeiter- und Soldatenrat« zusammen, der als oberste Machtinstanz fungierte. Faktisch hatte er vor allem die Polizeigewalt inne. Die alte Verwaltung wurde in der Regel mit der Weiterarbeit beauftragt; der Arbeiter- und Soldatenrat beschränkte sich meist auf die (in ihrem Ausmaß allerdings sehr unterschiedliche) Kontrolle ihrer Tätigkeit Das gilt cum grano salis selbst für die wenigen von der radikalen Linken dominierten Räte.
Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass sich auch die nichtproletarischen – bürgerlichen, kleinbürgerlichen und bäuerlichen – Bevölkerungsgruppen der Räteform bedienten, um sich gegenüber der jetzt vorherrschenden Arbeiterbewegung zu artikulieren und zu behaupten. Ende des Jahres 1918 gab es immerhin rund 300 sog. »Bürgerräte«, die nicht offen gegenrevolutionär, aber doch deutlich revolutionsbremsend auftraten.
Die große Mehrheit der deutschen Arbeiter vertraute im November und Dezember 1918 zweifellos der SPD-Führung, eine beträchtliche Minderheit folgte dem gemäßigten Flügel der USPD. Die radikale Linke dominierte lediglich in wenigen Großstädten und industriellen Zentren, und auch hier stellten der Spartakusbund, die norddeutschen Linksradikalen und ähnliche Gruppen innerhalb der Linken in der Regel eine Minorität dar. Das Übergewicht der SPD verstärkte sich durch die massive Unterstützung von Seiten der Soldatenbewegung und von Teilen der Mittelschichten. Auf dem erwähnten ersten nationalen Rätekongress Mitte Dezember kamen drei Mehrheitssozialdemokraten auf einen Unabhängigen. Nur wenige Prozente der Delegierten gehörten kommunistischen Gruppierungen an. Das entsprach zu diesem Zeitpunkt in etwa den tatsächlichen Mehrheitsverhältnissen in der Arbeiterschaft Deutschlands.
Die historische Forschung seit den frühen sechziger Jahren neigt überwiegend zu der Auffassung, die SPD-Führung habe den kurz nach dem Umsturz vorhandenen Spielraum nicht genutzt, um durch tiefgreifende Staats- und Gesellschaftsreformen kraft revolutionären Rechts die Demokratie in Deutschland zu sichern8 Die mehrheitssozialdemokratische Politik war auf die raschestmögliche Überführung der Revolution in ein legales, d. h. parlamentarisches Stadium gerichtet. Den Entscheidungen einer nach allgemeinem gleichem Wahlrecht zu wählenden Nationalversammlung sollte keinesfalls vorgegriffen werden. Der Rat der Volksbeauftragten sollte – außer auf dem Gebiet wichtiger sozialpolitischer Reformen – praktisch als bloße Interimsregierung fungieren. Die Arbeiter- und Soldatenräte sollten ausschließlich Hilfsfunktionen für die Verwaltung wahrnehmen und so schnell wie möglich überflüssig gemacht werden.
Obwohl die große Zahl der lokalen und regionalen Räteorganisationen von Mehrheitssozialdemokraten und gemäßigten Unabhängigen dominiert wurden, neigten die SPD-Führer dazu, in ihnen Instrumente einer radikalen Sozialrevolution nach russischem Vorbild (an dem sich tatsächlich jedoch allenfalls die minoritären Gruppen der radikalen Linken orientierten) zu sehen. Jedenfalls spielte die jeweilige Wahrnehmung der inneren Entwicklung Russlands seit dem März 1917 eine wichtige Rolle für die jeweilige Wahrnehmung der deutschen Vorgänge. Noch stärker als für die Mehrheitssozialdemokraten gilt das für bürgerliche Liberale, auch solche des linken Flügels, für die Rechte ohnehin.
Bei ihrer Politik der Nicht-Revolution hatten die Mehrheitssozialdemokraten, neben ihrer prinzipiellen parlamentarisch-demokratischen Orientierung, die gravierenden situationsbedingten Probleme Deutschlands im Auge, die von der Regierung angesichts der Kriegsniederlage gelöst werden mussten, wie den Abschluss des Waffenstillstands (11.11.1918) mit der Rückführung und Demobilisierung des Heeres und – so hoffte man – eines erträglichen Friedens, die Sicherung der Ernährung, die Umstellung der Produktion auf die Friedenswirtschaft und die Bewahrung der Reichseinheit. Für die Bewältigung dieser Aufgaben meinte man die traditionellen Eliten: das Offizierskorps, die Beamtenschaft und die Unternehmer (einschließlich der Großgrundbesitzer), nicht entbehren zu können. Bei der Zurückdrängung des Einflusses der Arbeiter- und Soldatenräte verbanden sich also insofern sachliche, verfassungspolitische und machtpolitische Motive. Energische Unterstützung gegen die links von ihr stehenden Kräfte fanden die drei mehrheitssozialdemokratischen Volksbeauftragten: der Parteivorsitzende Friedrich Ebert, der Vorsitzende der SPD-Reichstagsfraktion Philipp Scheidemann und der Reichstagsabgeordnete Otto Landsberg, bei den sich unter neuen Namen, aber ansonsten in weitgehender Kontinuität formierenden bürgerlichen Parteien und nahezu der gesamten Presse.
Die Gleichberechtigung der USPD-Volksbeauftragten blieb auf dem Papier stehen. In die Regierung entsandt waren seitens der Unabhängigen Barth, Dittmann und Haase. Emil Barth gehörte zu den Revolutionären Obleuten und somit zum linken Parteiflügel, Wilhelm Dittmann war einer der prominenten Parteigründer und fungierte als Sekretär des USPD-Zentralkomitees, Hugo Haase hatte ab 1913 mit Ebert der SPD vorgestanden, bevor er Vorsitzender der neu gegründeten USPD geworden war. Er sollte verabredungsgemäß neben Ebert dem Rat der Volksbeauftragten präsidieren. De facto übernahm Ebert allein die Leitung des Gremiums.
Die Unterscheidung zwischen ordentlichen Volksbeauftragten und bürgerlichen Fachministern unter dem tradierten Namen »Staatssekretäre« entsprach einer bereits vorrevolutionären Neuerung, als 1917 aus den Reichstagsparteien erstmals Regierungsmitglieder ohne Ressort ernannt worden waren. Zwar waren auch die Zuständigkeiten der Volksbeauftragten sachlich aufgeteilt. Daneben arbeiteten aber die Leiter der obersten Reichsämter – nach den generellen Anweisungen der neuen Regierung – weiter. Sie waren keineswegs nur »technische Gehilfen« des Rats der Volksbeauftragten und stärkten mit einer selektiven Loyalität, ebenso wie der gesamte Regierungs- und Verwaltungsapparat, einseitig die mehrheitssozialdemokratischen Volksbeauftragten, namentlich Ebert. Die jeweils zwei Beigeordneten aus den sozialdemokratischen Parteien vermochten keine wirksame Kontrolle der Fachressorts auszuüben, ließen sich teilweise sogar von den Ressortchefs instrumentalisieren. – Dass es hinter den Kulissen schon am 10. November zu einer, zunächst eher technisch gemeinten, Kooperationsabsprache Eberts mit General Groener, dem Nachfolger Ludendorffs in der Obersten Heeresleitung als Generalquartiermeister, kam, sicherte dessen Machtposition zusätzlich.
Die USPD war von ihrer Gründung im Frühjahr 1917 bis zu ihrer Spaltung im Herbst 1920 eher ein Ausdruck der sich radikalisierenden Massenbewegung, als dass sie als Partei geschlossen auf diese eingewirkt hätte. Der in der Parteiführung zunächst vorherrschende, relativ gemäßigte Flügel formulierte Auffassungen, die vielfach die Bestrebungen der revolutionär-demokratischen Massenbewegung ausdrückten. Die Wahl der Nationalversammlung wurde grundsätzlich akzeptiert, doch sollte sie mehrere Monate hinausgeschoben werden, in denen irreversible Tatsachen geschaffen werden sollten. Die Stellung der USPD-Führung wurde indessen dadurch erschwert, dass ein zunehmender Teil der Parteibasis ihre Politik der Zusammenarbeit mit der SPD von links kritisierte. Die USPD-Linke suchte nach Möglichkeiten, die Revolution – auch gegen die Mehrheitssozialdemokratie – in Richtung eines Rätesystems weiterzutreiben.
Die Massenbewegung vom November-Dezember 1918 zeichnete sich – wenn man die Verhältnisse in ganz Deutschland und nicht allein in Berlin und wenigen urbanen bzw. industriellen Zentren zugrunde legt – dennoch durch eine weitgehende politische Einheitlichkeit aus. Sie stützte sich auf die Arbeiter, reichte aber über diese hinaus, indem sie nichtproletarische Soldaten, Angehörige der Intelligenz, der abhängigen Mittelschichten, seltener auch Bauern einschloss. Die Bewegung war ganz in der sozialdemokratischen Tradition verankert; die institutionelle Demokratisierung des Staates im Sinne der parlamentarischen Republik galt als Voraussetzung und Grundlage für die spätere schrittweise sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft. Daher wurden die ganz überwiegende Zustimmung zur Wahl der Nationalversammlung und die vielerorts erfolgte Proklamation der »sozialistischen« bzw. »sozialen« Republik seitens der Arbeiter- und Soldatenräte nicht als Widerspruch empfunden.
In diesem Sinne sah auch der mehrheitssozialdemokratische Abgeordnete Hans Vogel, ein Gegner aller linksradikalen Bestrebungen, das Ziel der Revolution, wie er im März 1919 in der Nationalversammlung ausführte, in der »Errichtung einer sozialistischen Republik auf demokratischem Wege« und in »organischer Entwicklung«9.
Mit dem aus der Fraktionierung in der Berliner Arbeiterschaft entstandenen sog. »Spartakusaufstand« und der Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts zerbrach im Januar 1919 die Einheit der revolutionären Bewegung endgültig. Die USPD gehörte der Regierung seit dem Jahreswechsel nicht mehr an. In der zweiten Phase der Revolution – dem Versuch, die Revolution zu sichern und weiterzutreiben – kam es zu einer Reihe lokaler Aufstände der radikalen Linken, in deren Verlauf auch »Räterepubliken« gegründet wurden, in erster Linie in Bremen (Januar/Februar 1919) und München (April 1919). Die lokalen Aufstände und Räterepubliken verfügten trotz teilweise beträchtlicher Massenmobilisierung über kein ausreichendes Gewicht, um auch nur vorübergehend die Machtfrage wirklich zu lösen. Das Lager der Aufständischen zerfiel durchweg an inneren Widersprüchen, noch bevor die gegenrevolutionären Freiwilligen-Einheiten, die »Freikorps«, im Auftrag der Reichsregierung in Aktion traten und mehrfach Zustände herbeiführten, für die der Ausdruck »weißer Terror« keine polemische Übertreibung ist.
Parallel zu diesen Kämpfen entstand jedoch, anknüpfend an die schon seit Ende November 1918 sich ausbreitenden ökonomischen Streiks, eine neue Massenbewegung, die einen anderen Charakter hatte als die Bewegung vom November/Dezember 1918. In den industriellen Zentren Deutschlands verlagerte sich das Schwergewicht des Kampfes von der staatlichen Ebene auf die Ebene der direkten Konfrontation von Arbeit und Kapital in den Betrieben. Die Bergarbeiter des Ruhrgebiets traten im Februar und im April 1919 in den Generalstreik, die mitteldeutschen Arbeiter im Februar, die Berliner Arbeiter Ende Februar/Anfang März. Auch in Oberschlesien, in Württemberg und an anderen Orten kam es zu General- oder Massenstreiks. Die Parole der »Sozialisierung« beschränkte sich hier keineswegs auf Verstaatlichung, sondern drückte – verbunden mit konkreten Forderungen nach besseren Lebens- und Arbeitsverhältnissen und insbesondere nach einem inner- und überbetrieblichen sog. »wirtschaftlichen« Rätesystem – das Verlangen der Arbeiter nach Selbstbestimmung und Selbstverwaltung aus.
Die Bewegung umfasste Arbeiter verschiedener politischen Richtungen. In erster Linie ging es hier aber nicht um ein Bündnis von politischen Parteien, sondern um neuartige Formen rätesozialistischer und quasi syndikalistischer Massenaktionen, die sich mit keiner Gruppierung ohne weiteres identifizieren lassen. Mit den Räten aus der ersten Phase der Revolution – soweit sie noch bestanden – hatte die spontane Streik- und Sozialisierungsbewegung, abgesehen von Ausnahmefällen, nicht direkt zu tun. Was die Bewegung an antikapitalistischer Radikalität gewann, büßte sie indessen an Breite ein. Der Novemberumsturz hatte gewiss die große Mehrheit des Volkes hinter sich, die Sozialisierungsbewegung vermutlich die Mehrheit der Arbeiter der Großbetriebe, aber wohl nur eine beträchtliche Minderheit der Bevölkerung insgesamt.
Die Staats- und Gesellschaftsordnung der ersten deutschen Republik war somit eine Resultante aus dem Sieg der demokratischen Arbeiter- und Volksbewegung im November 1918 und der, teilweise gewaltsamen, Eindämmung der weiterreichenden, durchaus unterschiedlichen Bestrebungen großer Teile der Arbeiterschaft im Winter und Frühjahr 1919. Die parlamentarische Demokratie in der Form der Republik trat an die Stelle der konstitutionellen Monarchie. Dem Reichstag, jetzt auch von den Frauen mitgewählt, stand nun das volle Sortiment zeitüblicher parlamentarischer Rechte zur Verfügung, auch wenn in der Verfassungswirklichkeit die Entscheidungsgewalt auf die präsidiale Staatsspitze und die parlamentsabhängige Regierung verteilt war. Gegenüber der Verfassung des Kaiserreichs von 1871 begründete die Weimarer Verfassung eine deutlich stärker unitarische Struktur; sie enthielt einen eigenen Grundrechtkatalog und ging vom Prinzip der Volkssouveränität aus.
Neu und wegweisend war aber nicht nur die repräsentativ-demokratische Staatsform, sondern auch die Idee des »sozialen Rechtsstaats«. Diese Idee negierte nicht den traditionellen liberalen Rechtsstaat, der jedoch durch neue soziale Inhalte erweitert werden sollte. Der fünfte Abschnitt (»Das Wirtschaftsleben«) in der neuen Reichsverfassung formulierte sozialstaatliche Grundsätze, gab dem Staat das Recht zur Vergesellschaftung von Unternehmen sowie zum Aufbau eines Systems der Gemeinwirtschaft und enthielt in Art. 165 Restelemente des Rätegedankens. In ihm war die Wahl von Betriebs-, Bezirks- und Reichsarbeiterräten festgelegt, die gemeinsam mit Unternehmern und anderen »beteiligten Volkskreisen« »Wirtschaftsräte« bilden sollten. Bei entsprechenden Parlamentsmehrheiten schien die Weimarer Reichsverfassung offen zu sein auch für den Aufbau einer sozialistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Jedenfalls waren die sozialdemokratischen Staats- und Verfassungsrechtler dieser Auffassung. Somit konnte man in der Weimarer Verfassung vom 11. August 1919 einen Basiskompromiss zwischen den sozialen Klassen und politischen Parteien sehen, genauer: zwischen der reformistischen Arbeiterbewegung und dem republikanisch orientierten bzw. der Republik aufgeschlossenen Teil des Bürgertums.
Zu diesem Basiskompromiss gehörte die am 15. November 1918 besiegelte Zentral-Arbeitsgemeinschaft (ZAG) der Spitzenverbände von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, durch die die Gewerkschaften von der Gegenseite erstmals generell als Tarifpartner anerkannt wurden. Für die Industriellen bedeutete das Abkommen vor allem eine Versicherung gegen drohende Entmachtung und Enteignung. Dennoch: mit den neuen Verhältnissen ging ein gewaltiger Aufschwung der Gewerkschaftsbewegung einher. Die Tarifvertragsverordnung der Regierung der Volksbeauftragten vom 23. Dezember 1918 leitete die Epoche des kollektiven Arbeitsrechts in Deutschland ein. Auch wenn die staatliche Gesetzgebung, vor allem mit der Einführung des Achtstundentags und der Erwerbslosenfürsorge, in der Umbruchsphase unmittelbar wirksame soziale Errungenschaften beinhaltete, trat der gesetzliche Schutz der Arbeitnehmer in seiner Bedeutung hinter die Ordnung der Arbeitsverhältnisse durch tarifvertragliche Vereinbarungen zweifellos zurück.
In diesen Zusammenhang gehörten auch die obligatorische Einrichtung von gewählten Vertretungskörperschaften der Arbeitnehmer in den Betrieben – anknüpfend an das Kriegs-Hilfsdienstgesetz vom Dezember 1916 – und die Regelung von deren Zuständigkeiten, insbesondere im Hinblick auf die innerbetrieblichen Mitbestimmungsrechte. Auch hier war der infolge der staatlichen Neuordnung erzielte Rechtsfortschritt erheblich. Doch zugleich beleuchtete das zähe Ringen um das Betriebsrätegesetz, wie weit die innenpolitische Polarisierung um die Jahreswende 1919/20 schon vorangeschritten war, die den Weimarer Basiskompromiss bereits nach wenigen Monaten bedrohte: Neben den Parteien der Rechten stimmte auch die USPD gegen das Gesetz, da ihr die vorgesehenen Betriebsräte lediglich als Kümmerform der revolutionären Betriebsräte von 1918/19 erschienen. Eine linke Massenkundgebung vor dem Reichstag am 13. Januar 1920 wurde von Sicherheitskräften beschossen; 42 Tote blieben zurück. Den daraufhin zum wiederholten Mal verhängten Ausnahmezustand empfanden weite Kreise der Arbeiterschaft, über die radikale Linke hinaus, als gegen sich gerichtet – man sprach von der »Noske-Politik« unter Bezugnahme auf den mehrheitssozialdemokratischen Reichswehrminister Gustav Noske, den Hauptverfechter der Zusammenarbeit mit dem alten Offizierkorps, er hatte schon in Kiel als Abgesandter der Berliner Regierung Anfang November 1918 eine wichtige Rolle gespielt – und die Arbeiter wandten sich, wie schon seit einem Jahr erkennbar, mehr und mehr der USPD zu.
Es spricht manches für die Annahme, mit der breiten und erfolgreichen Abwehr des Kapp-Lüttwitz-Putsches im März 1920 habe sich den Sozialisten und entschiedenen Republikanern noch einmal eine Chance aufgetan, Versäumnisse der ersten Nachkriegsmonate aufzuholen und die Demokratie durch eine deutliche Entmachtung der alten aristokratisch-großbürgerlichen Eliten zu fundieren. Eine nachhaltig Wende in der innenpolitischen Entwicklung Deutschlands, die seit Anfang 1919 in Richtung Gegenrevolution verlaufen war, wurde indessen unmöglich durch den Einsatz der Reichswehr gegen die aufständischen Ruhrarbeiter, die ihrem Selbstverständnis nach den Abwehrkampf der gesamten Arbeiterbewegung gegen den Putschversuch fortsetzen.
In Preußen, dem mit Abstand größten Gliedstaat des Deutschen Reiches, begann im Gefolge der Märzereignisse von 1920 unter einer neuen Führung von SPD und Regierung immerhin eine Auswechslung demokratiefeindlicher oder unzuverlässiger Beamter im Staatsapparat einschließlich der Polizei. Preußen wurde zum republikanischen »Bollwerk«, während in Bayern der Kapp-Putsch zu einer staatsstreichähnlichen Verschiebung der politischen Achse nach rechts genutzt wurde, die die Position des süddeutschen Freistaates als antirepublikanische »Ordnungszelle« befestigte.
Bei den Wahlen zur Nationalversammlung im Januar 1919 hatten die Parteien der Weimarer Koalition – die Mehrheitssozialdemokratie, die katholische Zentrumspartei und die liberale DDP – über drei Viertel der Stimmen erhalten, während SPD (37,9%) und USPD (7,6%) zusammen unterhalb der absoluten Mehrheit blieben. Doch entsprachen die parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse schon bald nicht mehr den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen: Nicht nur waren, von den politischen Amtsträgern abgesehen, im großen Ganzen die Männer der alten Eliten in Industrie, Finanzwesen und Landwirtschaft, Militär, Verwaltung und Justiz in ihren Positionen verblieben. Auch lehnte ein beträchtlicher Teil des bürgerlichen Spektrums die demokratische Republik ab. Die Reichstagswahlen im Juni 1920 ergaben denn auch nicht einmal mehr 50 % der Stimmen für die Weimarer Koalition.
Bei der Ablehnung der Republik, nicht zuletzt unter jungen Akademikern, spielten die Kriegsniederlage und der Versailler Frieden eine heute häufig unterschätzte bzw. fehlgedeutete Rolle. »Versailles« wurde auch in der Mitte und auf der Linken – nicht ohne Berechtigung – als Gewaltfrieden angesehen und nur unter äußerstem Widerstreben in der parlamentarischen Abstimmung angenommen. Das bewahrte die Republikaner, namentlich die Sozialdemokraten, nicht davor, mit einer hasserfüllten Kampagne gegen die »November-Verbrecher« konfrontiert zu werden. Die Unterstützung des Krieges von 1914-18 durch Burgfrieden und Kreditbewilligung machte es ihnen psychologisch sehr schwer, sozusagen den Spieß umzudrehen und die früheren Machthaber mit ihrer maximalistischen Kriegspolitik ihrerseits offensiv als »Reichsverderber« anzugreifen.
Man hat verschiedentlich die These aufgestellt, ein Fortbestehen der Monarchie nach dem Ersten Weltkrieg hätte die konservativen Kräfte eher mit der parlamentarischen Demokratie versöhnt10. Diese Annahme scheint mir in jeder Hinsicht fragwürdig. Erstens war die Monarchie am Ende des Krieges für breite Massen, nicht nur der Arbeiterschaft, das Symbol für Krieg, Militarismus, Hunger und Unterdrückung, und ein Festhalten der Mitte-Links-Parteien an der monarchischen Staatsform hätte von Anfang an viele auf die Seite der radikalen Linken getrieben. Zweitens ist bereits die Oktober-Reform von einem erheblichen Teil der alten Führungsschicht abgelehnt worden. Die Entscheidung zum Auslaufen der Hochseeflotte, die die Revolution Ende Oktober 1918 auslöste, war faktisch so etwas wie ein Staatsstreichversuch der Admiralität gegen den Verfassungswandel. Drittens war die europäische Demokratisierungsbewegung um und nach 1900 nicht nur in Deutschland von schweren innenpolitischen Auseinandersetzungen begleitet. Um erfolgreich zu sein, benötigte sie in der Regel die Schubkraft einer außerparlamentarischen Volksbewegung, häufig verbunden mit Massenstreiks oder sogar einem Generalstreik (wie in Belgien). Eine solche Massenbewegung hätte vermutlich gerade angesichts der Kriegsniederlage auch ohne Sturz der Monarchie eine längerfristige innenpolitische Polarisierung hervorgerufen. Um es zu wiederholen: die parlamentarische Demokratie war durch die Regierungsneubildung und durch die Verfassungsänderungen vom Oktober 1918 noch keineswegs gesichert.
Gewiss: Die revolutionäre Ablösung der Hohenzollernmonarchie und der übrigen Dynastien war dem Deutschen Reich nicht zwangsläufig vorherbestimmt. Es waren immer wieder andere Weichenstellungen möglich, und der internationale Vergleich macht deutlich, wie unstet die Entwicklung zur bzw. der parlamentarischen Demokratie auch in den westeuropäischen Ländern vor den 1950er Jahren verlief. Und ebenso wenig lässt sich der Untergang der Weimarer Republik 1933 aus den Entscheidungen und Unterlassungen von 1918/19 geradlinig ableiten. Es kann aber auch nicht bestritten werden, dass zu den Voraussetzungen des Aufstiegs der NSDAP neben dem Versailler Vertrag und der Weltwirtschaftskrise auch die innere Schwäche der Republik gehörte, die hauptsächlich aus ihrer revolutionär-gegenrevolutionären Entstehungsgeschichte resultierte. Es war das Spannungsverhältnis zwischen der demokratischen Verfassung und einer stark durch antidemokratische Kräfte geprägten gesellschaftlichen Wirklichkeit, das die Weimarer Republik in so hohem Maße krisenanfällig machte.
Durch revolutionäre Aktion der Soldaten und Arbeiter zustande gekommen, blieb die Demokratie von Weimar hinter den Erwartungen auch der gemäßigteren Teile der Volksbewegung zurück. Für eine von Anfang an große und später noch wachsende Fraktion des Bürgertums ging der Verfassungskompromiss indessen schon viel zu weit, indem er der reformistischen Arbeiterbewegung eine unerwünscht starke Machtposition beließ. Man identifizierte die neue, parlamentarisch-demokratische Ordnung nicht nur mit dem Versailler Frieden, sondern auch mit dem Sozial- oder (wie man rechts der Mitte meinte) »Gewerkschaftsstaat«. Einen Bruch mit der republikanischen Legalität und eine autoritäre Umbildung der Verfassung ließ in der Frühphase der Weimarer Republik die außenpolitische Abhängigkeit in Verbindung mit der wirtschaftlichen Instabilität nicht zu: weder im Frühjahr 1920 noch im Herbst 1923, als die vorübergehende Übertragung der vollziehenden Gewalt an General von Seeckt, jetzt Chef der Heeresleitung, manchen Beobachtern wie der Begin einer Militärdiktatur erschien.
In den Jahren 1924-28, einer Phase relativer Stabilisierung im politischen wie im wirtschaftlichen Bereich, schien sich dann die Mehrheit selbst des konservativen Bürgertums mehr und mehr mit der Republik abzufinden, symbolisiert durch den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, den legendären Feldherrn des Weltkriegs. Die mit dem gemäßigten Flügel der USPD wiedervereinigte Sozialdemokratie (die USPD-Linke hatte sich Ende 1920 mit der KPD zusammengeschlossen) befand sich in der Opposition, bildete aber – gerade auch für die auf Verständigung mit den Sieger gerichtete Außenpolitik Gustav Stresemanns – zusammen mit den Freien Gewerkschaften einen Faktor, der berücksichtigt werden musste. Doch angesichts der erwähnten Strukturmängel und der Unterlassungen in den ersten Monaten und Jahren nach dem Novembersturz von 1918 wurde das Sich-Einlassen der gemäßigten Rechten auf die parlamentarische Regierungsform nach 1923 konterkariert von einer Art schleichender Gegenrevolution mit dem Ziel einer autoritär-bürokratischen Veränderung des „Systems“. Die der Hitler-Diktatur vorausgehenden und ihr de facto in mancher Hinsicht vorarbeitenden präsidialen Notverordnungsregierungen der Jahre 1930-1932/33 – ermöglicht durch die Weltwirtschaftskrise – setzten das dann schrittweise in die Tat um. Arthur Rosenberg, der – aus der doppelten Perspektive des Fachhistorikers und Zeitzeugen – 1935 im Exil eine der ersten wissenschaftlichen Darstellungen der deutschen Geschichte nach 1918 veröffentlichte, ließ die Weimarer Republik im eigentlichen Sinn deshalb auch schon im Frühjahr 1930 enden, ohne dass er die neue Qualität des Einschnitts Anfang 1933 übersah11.
Auswahlbibliographie
I. Quellen
Allgemeiner Kongreß der Arbeiter und Soldatenräte Deutschlands vom 16.-21. Dezember 1918. Stenographische Berichte, Berlin (1919).
Brandt, P. u. Rürup, R., Bearb., Arbeiter-, Soldaten- und Volksräte in Baden 1918/19, Düsseldorf 1980.
Engel, G., Holtz, B. u. Materna, I., Bearb., Groß-Berliner Arbeiter- und Sodatenräte in der Revolution 1918/19, 2 Bde., Berlin 1933/97.
Hürten, H., Bearb., Zwischen Revolution und Kapp-Putsch. Militär und Innenpolitik 1918-1920, Düsseldorf 1977.
Kolb, E. u. Rürup, R., Bearb., Der Zentralrat der deutschen sozialistischen Republik, 19.12.1918 bis 4.8.1919. Vom ersten zum zweiten Rätekongreß, Leiden 1968.
Kolb, E. u. Schönhoven, K., Bearb., Regionale u. lokale Räteorganisationen in Württemberg 1918/19, Düsseldorf 1976.
Matthias, E. u. Morsey, R., Bearb., Die Regierung des Prinzen Max von Baden, Düsseldorf 1962.
Miller, S. u. Potthoff, H., Bearb., Die Regierung der Volksbeauftragten 1918/19, Düsseldorf 1966.
Miller, S. u. Ritter, G. A., Hg., Die deutsche Revolution 1918/19, Hamburg 19752
II. Literatur
Albertin, L., Liberalismus und Demokratie am Anfang der Weimarer Republik. Eine vergleichende Analyse der Deutschen Demokratischen Partei und der Deutschen Volkspartei, Düsseldorf 1972.
Arnold, V., Rätebewegung und Rätetheorien in der Novemberrevolution, Hamburg 19852
Bermbach, U., Vorformen parlamentarischer Kabinettsbildung in Deutschland, Köln/Opladen 1967.
Bieber, H.-J., Bürgertum in der Revolution. Bürgerräte und Bürgerstreiks in Deutschland 1918-1920, Hamburg 1992.
Bieber, H.-J., Gewerkschaften, Krieg und Revolution. Arbeiterbewegung, Industrie, Staat und Militär in Deutschland 1914-1920, 2. Bde, Hamburg 1981.
Brand, P. u. Rürup, R., Volksbewegung und demokratische Neuordnung in Baden 1918/19, Sigmaringen 1991.
Braunthal, J., Geschichte der Internationale, Bd. 2, Hannover 1963.
Carsten, F. L., Revolution in Mitteleuropa 1918-1919, Köln 1973.
Dähnhardt, D., Revolution in Kiel, Neumünster 1978.
Elben, W., Das Problem der Kontinuität in der deutschen Revolution. Die Politik der Staatssekretäre und der militärischen Führung vom November 1918 bis Februar 1919, Düsseldorf 1965.
Feldmann, G. D., Army, Industry and Labor in Germany, 1914-1918, Princeton N. J. 1966.
Grebing, H., Hg., Die deutsche Revolution 1918/19, Berlin 2008.
Huber, E. R., Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. V, Stuttgart 1978.
Kluge, U., Soldatenräte und Revolution. Studien zur Militärpolitik 1918/19, Göttingen 1975.
Kluge, U., Die deutsche Revolution 1918/19, Frankfurt 1985.
Kocka, J., Klassengesellschaft im Krieg. Deutsche Sozialgeschichte 1914 bis 1918, Göttingen 1973.
Kolb, E., Arbeiterräte in der deutschen Innenpolitik 1918-1919, Düsseldorf 1962.
Kolb, E., Hg., Vom Kaiserreich zur Weimarer Republik, Köln 1972.
Kolb, E., Die Weimarer Republik, München 1984 u. ö.
Kuckuk, P., Bremer Linksradikale bzw. Kommunisten von der Militärrevolte im November 1918 bis zum Kapp-Putsch im März 1920, Diss. phil., Hamburg 1970.
Lehnert, D., Sozialdemokratie und Novemberrevolution. Die Neuordnungsdebatte 1918/19 in der politischen Publizistik von SPD und USPD, Frankfurt 1983.
Lösche, P., Der Bolschewismus im Urteil der deutschen Sozialdemokratie 1903-1920, Berlin 1967.
Lukas, E., Zwei Formen von Radikalismus der deutschen Arbeiterbewegung, Frankfurt 1976.
Maier, C., Recasting Bourgeois Europe. Stabilization in France, Germany and Italy in the Decade after World War I, Princeton N. J. 1975.
Matthias, E., Zwischen Räten und Geheimräten. Die deutsche Revolutionsregierung 1918/1919, Düsseldorf 1970.
Miller, S., Burgfrieden und Klassenkampf. Die deutsche Sozialdemokratie im Ersten Weltkrieg, Düsseldorf 1974.
Miller, S., Die Bürde der Macht. Die deutsche Sozialdemokratie 1918-1920, Düsseldorf 1979.
Mitchell, A., Revolution in Bayern 1918/19, München 1967.
Morgan, D. W., Socialist Left and the German Revolution: A History of the Independent Social Democratic Party, 1917-1922, Ithaca N. Y. 1975.
Nipperdey, T., Deutsche Geschichte 1866-1918, München, 2 Bde., 1990/92.
v. Oertzen, P., Betriebsräte in der Novemberrevolution, Düsseldorf 1963.
Potthoff, H., Gewerkschaften und Politik zwischen Revolution und Inflation, Düsseldorf 1979.
Rürup, R., Hg., Arbeiter- und Soldatenräte im rheinisch-westfälischen Industriegebiet. Studien zur Geschichte der Revolution 1918/19, Wuppertal 1975.
Schwabe, K., Deutsche Revolution und Wilson-Friede, Düsseldorf 1971.
Wehler, H.-U., Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bde.3 u. 4, München 1995, 2003.
Winkler, H. A., Von der Revolution zur Stabilisierung. Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1918 bis 1924, Berlin 1984.
Winkler, H. A., Weimar 1918-1933, München 1993.
1 Erweiterte und für den Druck überarbeitete Fassung eines in zwei Versionen am 07.11.2008 in Kiel und am 01.12.2008 in Bremen gehaltenen Vortrags. – Im Hinblick auf den Charakter des Textes werden im Folgenden lediglich wörtliche und indirekte Zitate extra belegt. Siehe ansonsten die Auswahlbibliographie im Anschluss.
2 Zitate nach D. Lehnert, Sozialdemokratie und Novemberrevolution, Frankfurt 1983, S. 73, 92, 100; E. Kolb, Revolutionsbilder: 1918/19 im zeitgenössischen Bewußtsein und in der historischen Forschung, Heidelberg 1993, S. 7.
3 Verhandlungen der verfassunggebenden Deutschen Nationalversammlung, Bd. 328, Berlin 1920, S. 72ff.
4 Protokoll der Verhandlungen des Parteitags der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, abgehalten in Weimar vom 10. bis 15. Juni 1919 (ND Bonn 1973), S. 363f.
5 Für die folgende Argumentation siehe P. Brandt, War das Deutsche Kaiserreich reformierbar? Parteien, politisches System und Gesellschaftsordnung vor 1914, in: K. Rudolph u. C. Wickert, Hg., Geschichte als Möglichkeit. FS H. Grebing, Essen 1995, S. 190-210.
6 Abgedruckt z. B. in G. A. Ritter/S. Miller, Hg., Die deutsche Revolution 1918/19, Hamburg 1975, S. 47.
7 Briefwechsel SPD/USPD und weitere einschlägige Dokumente ebd., S. 85ff.
8 Siehe vor allem die in der Auswahlbibliographie genannten Titel von U. Kluge, E. Kolb, E. Matthias, P. v. Oertzen und H. A. Winkler, ungeachtet der zwischen diesen Autoren vorhandenen Differenzierungen in manchen Sach- und Werturteilen. Als argumentativ im Wesentlichen weiterhin gültige Zwischenbilanz siehe R. Rürup, Demokratische Revolution und „dritter Weg“, in: GuG 9 (1983), S. 278-301.
9 Verhandlungen der verfassunggebenden Deutschen Nationalversammlung, Bd. 328, Berlin 1920, S. 458f.
10 Etwa K. D. Erdmann, Rätestaat oder parlamentarische Demokratie. Neuere Forschungen zur Novemberrevolution 1918 in Deutschland, Kopenhagen 1979, bes. S. 3.
11 A. Rosenberg, Geschichte der Weimarer Republik, Frankfurt 1975 17 (zuerst 1935)
4 Protokoll der Verhandlungen des Parteitags der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, abgehalten in Weimar vom 10. bis 15. Juni 1919 (ND Bonn 1973), S. 363f.
5 Für die folgende Argumentation siehe P. Brandt, War das Deutsche Kaiserreich reformierbar? Parteien, politisches System und Gesellschaftsordnung vor 1914, in: K. Rudolph u. C. Wickert, Hg., Geschichte als Möglichkeit. FS H. Grebing, Essen 1995, S. 190-210.
6 Abgedruckt z. B. in G. A. Ritter/S. Miller, Hg., Die deutsche Revolution 1918/19, Hamburg 1975, S. 47.
7 Briefwechsel SPD/USPD und weitere einschlägige Dokumente ebd., S. 85ff.
8 Siehe vor allem die in der Auswahlbibliographie genannten Titel von U. Kluge, E. Kolb, E. Matthias, P. v. Oertzen und H. A. Winkler, ungeachtet der zwischen diesen Autoren vorhandenen Differenzierungen in manchen Sach- und Werturteilen. Als argumentativ im Wesentlichen weiterhin gültige Zwischenbilanz siehe R. Rürup, Demokratische Revolution und „dritter Weg“, in: GuG 9 (1983), S. 278-301.
9 Verhandlungen der verfassunggebenden Deutschen Nationalversammlung, Bd. 328, Berlin 1920, S. 458f.
10 Etwa K. D. Erdmann, Rätestaat oder parlamentarische Demokratie. Neuere Forschungen zur Novemberrevolution 1918 in Deutschland, Kopenhagen 1979, bes. S. 3.
11 A. Rosenberg, Geschichte der Weimarer Republik, Frankfurt 1975 17 (zuerst 1935)