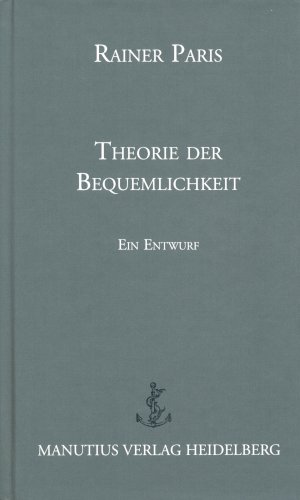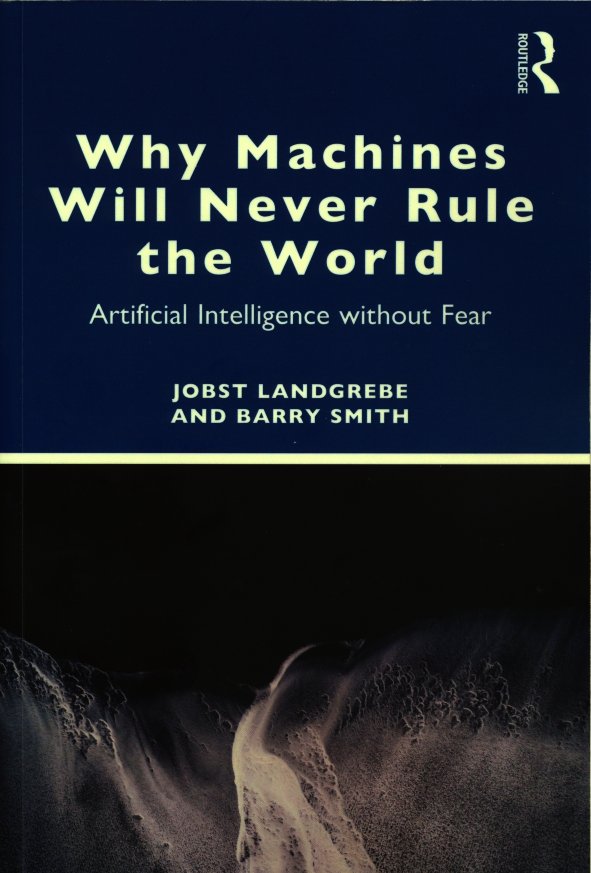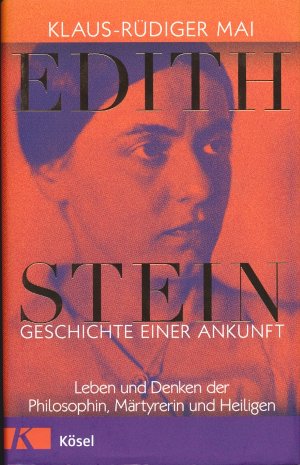von Jörg Büsching
I. Europa dankt ab – wovon?
Europe does not have a sense for the future anymore.
Martin Jacques
1. Von der Euphorie zur Dysphorie
Bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion war unstrittig, dass die Legitimität einer Gesellschaftsordnung sich vor allem an deren Fortschrittlichkeit, d. h. dem Grad der technisch-wissenschaftlichen Entwicklung sowie der darauf basierenden Verbesserung der allgemeinen materiellen Lebensbedingungen der Menschen ablesen lasse. Der nach dem Start des ersten von Menschen hergestellten Himmelskörpers, Sputnik 1, so genannte »Wettlauf der Systeme« bezog seine Attraktivität auf beiden Seiten des ideologischen Grabens zwischen West und Ost aus einer materialistischen Weltanschauung. Dieser Umstand wird von heutigen Marktromantikern, die den Zusammenbruch des Ostblocks allzu selbstherrlich als »Sieg des Westens«
interpretieren, gerne unterschlagen. Die weithin akzeptierte Erklärung, das sozialistische Modell der »Kommandowirtschaft« habe schlichtweg nicht funktionieren können, weil (a) das Anreizsystem fehlerhaft, (b) die Ressourcenallokation ineffizient und (c) langfristige Planbarkeit der menschlichen Bedürfnisse ohnehin eine – totalitäre – Illusion sei, scheint vordergründig in den historischen Erfahrungen eine Bestätigung zu finden. Nicht wenige Angehörige der heutigen politischen und wirtschaftlichen Eliten westlicher Länder finden sie deshalb so immens befriedigend, weil sie das Lebensmodell des Homo Oeconomicus mit seinem auf Konsumtion und Produktion reduzierten Repertoire gesellschaftlich relevanter Handlungen zu bestätigen scheint. Dass dieser Topos sich mittlerweile zu einer quasi-anthropologischen Konstante verfestigt hat, erkennt man nicht zuletzt an dem stupenden Unverständnis, mit dem besagte Eliten auf die kulturellen und sozialen Herausforderungen, die sich den bislang dominierenden Mächten seit dem Fall des Eisernen Vorhangs stellen, reagieren: 1. die Konfrontation mit Kulturen, welche die Prävalenz des westlichen Modells in Frage stellen, indem sie selbstbewusst (und manchmal auch trotzig) das Recht auf einen eigenen Weg für sich in Anspruch nehmen, auch wenn dieser mit den ›westlichen Werten‹ nicht vereinbar ist; 2. die wieder zunehmende soziale Segregation gerade innerhalb der ›fortschrittlichsten‹ Ökonomien und 3. die in der jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrise zutage getretenen institutionellen Fehlentwicklungen in den Marktgesellschaften des Westens.
Auf den ersten Blick haben diese drei Punkte nichts miteinander zu tun – zumindest werden sie im politischen Tagesgeschäft in der Regel separat behandelt. Dies geschieht aber weniger um einer genaueren politischen Analyse willen, als vielmehr wegen der eingängigen Symbolik der im jeweiligen Kontext diskutierten Fälle: Mit (1.) verbinden sich Diskurse über vermeintliche Gefahren, die von muslimischen Kulturen ausgehen (von der Sarrazin- über die Kopftuch- und Moscheendebatte bis hin zum »Krieg gegen den Terror«); (2.) wird vor allem mit der Hartz-IV-Problematik und damit zusammenhängenden Themen verknüpft (Mindestlohn, prekäre Beschäftigung, Abstiegsängste des Mittelstandes usw.) und (3.) macht sich vornehmlich an Staatshilfen für marode Banken mitsamt den Nachrichten über ausufernde Boni und Managergehälter fest sowie am in jüngster Zeit immer unverblümter zutage tretenden Lobbyismus von Großkonzernen, die in ihrem Bemühen, im internationalen Wettbewerb Vorteile zu erlangen, bedenkenlos auf den Staat und seine finanziellen Ressourcen übergreifen, sich umgekehrt aber jegliche regulative Eingriffe verbitten. Wird von den verantwortlichen Akteuren zwischen mehreren dieser Themenkomplexe doch einmal ein Zusammenhang konstruiert, dann dient dies in der Regel polemischen Zwecken, so etwa bei den Auseinandersetzungen um die Integrationsunwilligkeit (bzw. -fähigkeit) bestimmter Gesellschaftsgruppen, in der die Komplexe (1.) und (2.) zu einem gefährlichen Ressentiment kurzgeschlossen werden (vermutlich auch, um von der unter (3.) aufgeführten Problematik abzulenken). Abgesehen davon, dass diese provokative Zuspitzung für die Suche nach einer Lösung der zu Grunde liegenden realen Probleme eher kontraproduktiv sein dürfte, offenbart sie auch ein hohes Maß an – mit überbordendem ideologischem Eifer gerechtfertigter – Unredlichkeit, so dass sich unweigerlich der Verdacht aufdrängt, die Protagonisten seien angesichts der krisenhaften Entwicklung nicht einfach nur überfordert, sondern betätigten sich insgeheim sogar als deren Agenten. Ein solcher Verdacht aber, ob nun begründet oder nicht, erweist sich langfristig für demokratisch verfasste Gesellschaften als schleichendes Gift. Der Vertrauensverlust lässt sich auf Dauer durch kein noch so heftiges rhetorisches Gefuchtel wieder wettmachen, sondern beschleunigt letztendlich den Auflösungsprozess. Auch die Präsentation neuer äußerer Feinde hilft, anders als in den zurückliegenden Jahrhunderten, schließlich kaum mehr über die inneren Widersprüche hinweg.
2. Kampf der Kulturen – oder der Emotionen?
Neun Jahre nach den Terroranschlägen auf das New Yorker World Trade Center und das Pentagon werden diese Ereignisse von einigen immer noch als überzeugender Beleg für den von Samuel P. Huntington kurz vor der Jahrhundertwende in seinem gleichnamigen Buch heraufbeschworenen Kampf der Kulturen (New York 1996, Übers.: München 1998) angeführt. Korrekter – wenngleich weniger marktgängig – müsste die Übersetzung des Originaltitels »Zusammenprall der Zivilisationen« lauten, worauf bereits Wolfgang Schluchter in seinem Vortrag Kampf der Kulturen? hinweist; vgl. Schluchter (Hg.): Fundamentalismus, Terrorismus, Krieg, Weilerswist 2003, S. 25. Der Vorbehalt gegen die griffigere Formel nährt sich weniger aus dem Umstand, dass bei der Übersetzung der – vermeintlich – präzisere Begriff der »Zivilisation« durch den unklarer definierten der »Kultur« ersetzt wurde, sondern gibt eher dem Unbehagen über die polemische Verwendung des Begriffs »Kampf« Ausdruck, die im Deutschen in erster Linie eine gewaltsame Auseinandersetzung bezeichnet: Gewiss kommt es vor, dass Menschen gegeneinander kämpfen, und zwar nicht nur in persönlichen Auseinandersetzungen, sondern auch in institutionellen Zusammenhängen, als Ausführende einer Staatsgewalt, die gegen innere oder äußere Feinde vorgeht. Da ein solcher Kampf aber immer mit dem Risiko der Niederlage verbunden ist, geht ihm eine Entscheidung dafür oder dagegen voraus. Die Abwägung kann selbstverständlich durch ein erhebliches Maß an Verblendung, – Hybris aber auch übertriebene Angst – verfälscht sein, aber sie findet nichtsdestotrotz immer statt, sofern ein Mensch sich nicht blindwütig in einen Kampf stürzt, was aber eine psychische Ausnahmesituation darstellt. Demgegenüber naturalisiert der Topos »Kampf der Kulturen« die stets mögliche (aber eben nicht allgegenwärtige) gewaltsame Eskalation menschlicher Verhältnisse; nicht umsonst wird in diesem Zusammenhang häufig auf die Hobbessche Phantasmagorie des »Krieges aller gegen alle« verwiesen. – Die realen Verhältnisse mit ihren global immer stärker vernetzten Ökonomien sprechen indes einegrundlegend andere Sprache, daran ändert auch der sogenannte »Krieg gegen den Terror« nichts. Was sich hingegen geändert hat, sind die globalen Machtverhältnisse und mit ihnen die Perspektive unter denen Differenzen kultureller, sozialer oder politischer Art betrachtet werden.
Huntington kann zwar bei seinem Versuch einer Prognose über die nach dem Ende des Kalten Krieges zu erwartende »Weltordnung« vage auf die seit den sechziger Jahren etablierten kulturalistischen Diskurse in den Geistes- und Sozialwissenschaften bauen, in denen nach und nach auch Angehörige ehemals kolonialisierter Völker ihre Stimme einbrachten (paradigmatisch, wenngleich nicht unumstritten: Edward Said). Allerdings bleibt sein Kulturbegriff, wie Schluchter zeigt, sehr oberflächlich, und sein tektonisches Modell miteinander in Widerstreit stehender, monolithischer Zivilisationsblöcke spiegelt weder die Realität unserer Welt wider noch vermag es Anhaltspunkte über die künftige Entwicklung der einzelnen Zivilisationen im Kontext einer fortschreitenden Gobalisierung zu geben. Auch der von ihm konstatierte zivilisationsübergreifende Trend weg von der rein säkularen, aufklärerischen Sicht hin zu einer Restauration der Religion als identitätsstiftender Instanz stellt sich für den Heidelberger Soziologen etwas differenzierter dar: »Der religiöse Fundamentalismus ist eine moderne Bewegung gegen die Moderne. Er ist also unzureichend beschrieben, wenn man darin nur den unverstellten Rückgang auf die religiösen Fundamente […] sieht.« (Schluchter 2003, S. 40, Hervorhebungen im Original.) Es gehe ihm vielmehr darum, »die Ausdifferenzierung von Politik und Religion, die ›Entstaatlichung‹ der Religion rückgängig [zu] machen.« (Ebd.) Im Zusammenhang mit der Entstehung des westlichen Modells des »säkularen Verfassungsstaates« ist diese Charakterisierung in erster Linie auf den christlichen Fundamentalismus gemünzt, wie er heute vor allem in den USA anzutreffen ist. Beim Islamismus tritt noch ein weiteres Element hinzu: die Befreiung vom kolonialistischen Erbe des 19. Jahrhunderts. Die politische Weltbühne betrat der islamische Fundamentalismus bereits lange vor dem Ende des kalten Krieges, nämlich mit der »islamischen Revolution« im Iran, in deren Verlauf 1979 das von den USA unterstützte Regime Schah Mohammed Reza Pahlavis gestürzt wurde. Ihren Anfang nahm diese Bewegung bereits in den frühen sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, als der Schah Reformen einleitete, mit denen der iranische Staat stärker am Modell des Westens ausgerichtet – sprich: modernisiert – werden sollte (u. a. Landreform und Frauenwahlrecht). Schluchters oben zitierter Aussage zufolge wäre es allerdings irreführend, den islamischen Fundamentalismus aufgrund dieser Oppositionshaltung schlichtweg mit rückwärtsgewandter Orthodoxie (oder schlimmer noch: mit prinzipieller Rückständigkeit, wie dies aus der in der deutschen Journaille verbreiteten pejorativen Bezeichnung »Steinzeitislamisten« für die afghanischen Taliban herausklingt) gleichzusetzen. Diese Kurzschlüssigkeit hat weniger mit politischer oder sozio-kultureller Analyse zu tun als mit dem Selbstverständnis der liberalen Demokratien des Westens, die Inkarnation alles dessen zu sein, was üblicherweise mit »Modernität« in Verbindung gebracht wird: technisch-wissenschaftlicher Fortschritt und ökonomische Prosperität, die beide nach der westlichen Lesart ohne individuelle Freiheit nicht denkbar seien. Abgesehen davon, dass diese Auffassung, historisch betrachtet, zumindest fragwürdig ist, werden dabei unreflektiert Mittel zu Zwecken umgewidmet. Dass auch Islamisten moderne technische Mittel keineswegs rundweg verachten, sollte nicht erst seit dem Erscheinen global vernetzter islamistischer Terrororganisationen wie der Al Kaida bekannt sein: Der relativ lange Zeitraum zwischen dem Ausbruch der fundamentalistischen Opposition im Iran, 1963, und dem letztendlichen Sturz des Schah-Regimes im Jahre 1979 erklärt sich auch daraus, dass erst die herausgehobene Position des Ayatollah Chomeini im französischen Exil (seit 1978) ihm den Zugang zu modernen Massenmedien verschaffte, mit denen er seine Botschaften wirksam verbreiten konnte.
Die holzschnittartige Verkürzung der islamistischen Herausforderung des Westens auf einen ominösen »Kampf der Kulturen« dient im Grunde der Selbstvergewisserung eines Teils des letzteren (mit der Auflösung des Ostblocks hat bekanntermaßen auch dessen auf den Namen »freie Welt« getauftes Gegenstück ein Gutteil seiner Einheitlichkeit verloren); nicht ohne Grund hat Samuel P. Huntington im Jahre 2004 seinem Clash of Civilizations ein Buch mit dem Selbstzweifel und Verunsicherung ausdrückenden Titel Who are We? folgen lassen.
Die Auffassung, dass die Welt nach dem »Zeitalter der Ideologie« (dem 20. Jahrhundert) nun in das »Zeitalter der Identität« eingetreten sei, wird von vielen Autoren, auch solchen, die Huntingtons Ansatz widerprechen, geteilt. Der französische Politikwissenschaftler Dominique Moïsi etwa beschreibt die gegenwärtigen weltpolitischen Auseinandersetzungen als Kampf der Emotionen (München 2009). In seinem explizit als Antwort auf Huntingtons These konzipierten, auf Buchlänge ausgearbeiteten Essay konstatiert er drei vorherrschende Grundbefindlichkeiten, die er den unterschiedlichen Weltregionen zuordnet, und zwar je nachdem, wie sich ihre Situation unter den Bedingungen der forcierten Globalisierung darstellt. Die alten Mächte Europa und die USA sieht er gegenwärtig im Bann einer »Kultur der Angst« (vor ›den Muslimen‹ wie vor dem eigenen Bedeutungsverlust), während er in Asien eine vom wirtschaftlichen Aufstieg Chinas getragene »Kultur der Hoffnung« wahrnimmt, die nach und nach auch in die umliegenden Länder Süd- und Südostasiens und sogar bis nach Afrika ausstrahle, da das Reich der Mitte, anders als die USA, nicht als imperiale Macht wahrgenommen werde. Die islamische Welt schließlich werde in weiten Teilen von einer »Kultur der Demütigung« beherrscht, weil sie sich von den ehemaligen Kolonialmächten um ihre einstmalige Weltgeltung betrogen sehe, wofür die Gründung des Staates Israel nach dem Zweiten Weltkrieg das einschneidendste einer langen Reihe von Symbolen sei. Die Militärpräsenz westlicher Truppen im nahen und mittleren Osten hält die Erinnerung an die Demütigung bis zum heutigen Tag wach.
Moïsis Betrachtung hat, wie er selbst einräumt, den Nachteil, dass es schwer zu begründen ist, ganzen Bevölkerungsgruppen, Nationen oder gar Bewohnern bestimmter Weltregionen eine vorherrschende (d. h. das kollektive Handeln bestimmende) Emotion zuzuschreiben. Auf der anderen Seite stellt er aber die Frage, ob das tradierte Konzept der Geopolitik in unserer heutigen Zeit noch trägt; hier kann er durchaus fundierte Zweifel vorbringen. Der entscheidende Vorteil seines Ansatzes gegenüber dem von Huntington ist, dass der Versuch, kollektiv geteilte Emotionen nachzuvollziehen, den Diskurs wieder auf eine menschlich verständliche Ebene zurückbringt, während die Behandlung kultureller Differenzen, als seien es fundamentale anthropologische Unterschiede, Konflikte nicht nur von vornherein unlösbar erscheinen lässt, sondern sie schlimmstenfalls sogar noch anheizt, indem sie den Antagonismus als Teil der Identität substanzialisiert und so der jeweiligen Seite ein polemisches Argument liefert, an der eigenen Haltung unverrückbar festzuhalten und die der Anderen ebenso unnachgiebig zu verurteilen. Fundamentalismus ist eben kein spezifisches Merkmal des Islam.
3. Exkurs: Identität
Jemand, der dieser Tage von einem längeren Aufenthalt an einem der abgelegeneren Flecken unseres Planeten nach Deutschland zurückkehrte, würde sich nach einem Blick in die Massenmedien zweifellos schockiert fragen, was eigentlich Schlimmes vorgefallen ist, dass eine Bevölkerungsgruppe, die teilweise seit Jahrzehnten friedlich im Lande lebt, sich plötzlich kollektiv unter Verdacht gestellt sieht. In meiner Heimatstadt leben seit eh und je Menschen aus allen Teilen der Welt. Kopftuch tragende türkische Matronen, sommers wie winters in lange Mäntel gehüllt, sind mir seit frühester Jugend ein vertrauter Anblick in unserer Fußgängerzone. Ich könnte nicht sagen, dass es heute mehr sind als früher, eher im Gegenteil: Ihre Töchter geben sich lässiger und modischer, manche mit Kopftuch, manche ohne. Niemand erregt Aufsehen, niemand nimmt Anstoß. Wenn der Heimkehrer mich um Aufklärung über den Grund für die hitzigen Debatten ersuchen würde, müsste ich ihm die Bitte mit bedauerndem Kopfschütteln abschlagen: Ich weiß es nicht.
Lebe ich in einem Multikulti-Idyll? Verweigere ich mich der Realität (wie Herbert Ammon in seinem jüngst in Globkult erschienenen Artikel behauptet)? Gehöre ich gar zu jener »moral minority« (ein vornehmes Synonym für das in den diversen Publikumsforen der großen Tageszeitungen und Medienanstalten grassierende Schimpfwort »Gutmensch«) die in der Verwendung politisch korrekter Sprache einen adäquaten Ersatz für gelebte Tugenden sieht? – Die Antwort auf alle diese Fragen lautet: Ganz sicher nicht. Allerdings bin ich mir meiner Identität so gewiss, dass ich es nicht nötig habe, dem im Alltag mir begegnenden Fremden die Anerkennung zu verweigern, bloß um mich des Eigenen zu versichern.
Als ich in meinem Artikel Die Rückkehr der Brandstifter die Substanzialität Deutschlands bestritt, habe ich damit keineswegs zum Ausdruck gebracht, dass ich den »Begriff Deutschland« für eine »Schimäre« halte. Allerdings macht sich meine Identität nicht an einzelnen Begriffen oder sonstwelchen abstrakten Größen (wie internationalen Vereinbarungen, Verträgen oder theoretischen bzw. ideologischen Gebilden) fest. Meine Identität beginnt ganz konkret: mit meinem Namen. Mein Zuname verweist auf meine Familie, die seit Generationen in der Region um meine Heimatstadt verwurzelt ist. Diese Stadt, die übrigens unter dem preußischen Festungsregime länger und schwerer gelitten hat als unter jeder der zahlreichen Fremdherrschaften, die sie im Laufe ihrer langen Geschichte hat erdulden müssen (Heinrich Heines »Denk ich an Deutschland in der Nacht …« ist direkter Ausfluss einer deprimierenden Erfahrung dieser Drangsal), ist Teil einer unter vielen verschiedenartigen Regionen des föderalistischen Staates namens Bundesrepublik Deutschland, welcher sich, so jedenfalls habe ich es in der Schule und danach noch einmal während meines fünfzehnmonatigen Wehrdienstes im Rahmen des Staatsbürgerkundeunterrrichts gelernt, als freiheitliche, rechtsstaatliche und pluralistische Demokratie versteht und nicht als zentralistischer Einheitsstaat mit Gesinnungspolizei und politischer Justiz.
Dies alles ist Bestandteil meiner Identität. Man sieht, mein Deutschlandbegriff ist nichts weniger als eine Schimäre; er ist, im Gegenteil, sehr konkret – ohne deshalb substanzialistisch zu sein. Einst habe ich gelobt, dieses Land und seine Verfassung gegen äußere Feinde zu verteidigen. Zu diesen zähle ich allerdings nicht Menschen, denen nichts anderes anzulasten wäre, als dass sie nicht meinen Glauben, meine politischen Überzeugungen oder meine Volkszugehörigkeit teilen. Feinde geben sich durch gewaltsame Handlungen zu erkennen, die das Ziel haben, mein Land zu vernichten oder seine demokratische und rechtsstaatliche Ordnung umzustürzen. Handelt es sich dabei nicht um andere Staaten, sondern um Individuen oder Gruppierungen, die aus dem Inneren heraus agieren, dann bin ich als Staatsbürger aufgerufen, mitzuhelfen, diese in die Hände von Polizei und Justiz zu überführen, um sie an ihrem Tun zu hindern oder, falls es dazu zu spät sein sollte, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Die Justiz – und nicht ich, noch sonst irgendein Bürger – hat dann darüber zu befinden, ob sie schuldig sind oder nicht. Es versteht sich von selbst, dass feindselige Handlungen nicht Gegenstand einer sinnvollen politischen Diskussion sein können. Es versteht sich aber auch von selbst (oder sollte es wenigstens), dass der Bau eines Bahnhofs oder einer Moschee nicht zu dieser Sorte Handlungen gehört.
Ich empfinde es als Segen, in einem Land mit so weitgehenden Freiheiten zu leben, doch ich verstehe auch, dass es Menschen gibt, denen es Schwierigkeiten bereitet, den damit verbundenen Mangel an Zusammengehörigkeitsgefühl auszuhalten. Sie sehnen sich nach einer metaphysischen Instanz, an die nur appelliert zu werden braucht, um kollektives Handeln auszulösen, mit dem eine wirkliche oder vermeintliche Gefahr abgewendet und zugleich die eigene Identität gestärkt werden kann. Die Konfrontation mit Menschen, die noch über eine solche Instanz verfügen (oder dies zumindest glauben) macht es nicht einfacher, mit diesem Mangel umzugehen – aber es bleibt dennoch das Problem derer, die ihn verspüren. Man kann es nicht dadurch lösen, dass man es jenen Anderen aufbürdet, die, womöglich ohne es zu wissen, durch ihre bloße Anwesenheit zum Auslöser für dieses Gefühl werden.
Vielleicht der größte Vorzug der Freiheit, ohne eine solche metaphysische Instanz zu leben, ist, dass mir nicht alles, was meine Mitbürger tun oder sagen, gefallen muss. Ich kann eine Äußerung, eine Handlung zutiefst missbilligen, ohne dass dadurch meine Identität in Frage gestellt wird. Ich wünschte mir, dass viel mehr Menschen in meinem Land (und anderswo) diese Fähigkeit besäßen, dann hätte die »Kultur der Angst« vielleicht keine Chance zu verfangen.
4. Kontinent der Ängste
Dominique Moïsi unterscheidet zwei Typen von Angst, eine positive, die Menschen dazu bewegt, sich anzustrengen, einer Gefahr zu begegnen oder die Herausforderung zu einem Wettbewerb anzunehmen, aus dem schließlich etwas Neues hervorgeht, und eine negative, die lähmt und damit die Gefahr, von der sie ausgelöst wurde, noch vergrößert. Das Europa der Gründerjahre bis hin zur deutschen Wiedervereinigung gilt ihm als Beispiel für erstere. Es entstand aus der Angst heraus, eine mörderische Epoche wie die der Weltkriege könne irgendwann zurückkehren. Der Angst vor abermals überbordenden »patriotischen« Gefühlen verdanke sich das eher unterkühlte Erscheinungsbild der Europäischen Union mit ihrem Übermaß an Bürokratie (das auch Moïsi beklagt) und ihrem Mangel an symbolischer Strahlkraft. Der Angst vor einem erneuten Erstarken einer eigensüchtigen, die Nachbarn terrorisierenden deutschen Nation verdanke sich die Einführung des Euro. Den Moment der Wiedervereinigung beschreibt der Autor als verpasste Chance:
»Ich erinnere mich noch immer an die Reaktionen meiner Freunde im Élyseé-Palast, […], als ich mich ein paar Tage nach dem Fall der Berliner Mauer für eine symbolische Geste der französischen Diplomatie aussprach. Könnten sich der französische Präsident Mitterrand und Bundeskanzler Kohl nicht am Brandenburger Tor in Berlin die Hand reichen, wie sie es auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges in Verdun getan hatten? In Verdun hatten sie die Pforten der Vergangenheit geschlossen, in Berlin könnten sie symbolisch die Pforten der Zukunft öffnen. Mein Vorschlag wurde sofort als ›romantische Träumerei‹ abgetan. Stattdessen hielt der französische Präsident auf seiner Deutschlandreise an dem bereits in den letzten Zuckungen liegenden Regime in Ostdeutschland fest. Der alternde und kränkelnde Mitterand, dessen historisches Bewusstsein noch ganz der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg verhaftet war, konnte sich nicht mit der Tatsache abfinden, dass das vereinigte Deutschland in dem Mächtegleichgewicht des neuen Europas eine entscheidende Rolle spielen würde.« (Moïsi 2009, S. 145 f.)
Der Höhepunkt des europäischen Einigungsprozesses war somit zugleich ein Umschlagspunkt. Von da an begann die Angst vor der Zukunft das weitere politische Handeln zu bestimmen. Zugleich begann bei den Menschen fast überall in Europa die Angst vor dem wirtschaftlichen und sozialen Abstieg zu überwiegen, die heute, nach der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise von 2007/08, beinahe alles beherrscht.
Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 erhielten diese Ängste lediglich eine neue, hysterische Tonart. Statt differenziert und angemessen auf die Herausforderung durch den islamischen Fundamentalismus zu reagieren, wird das Gespenst einer Überfremdung durch gebärfreudige, kopftuchtragende Frauen und finstere, bärtige Männer heraufbeschworen. Der Islam wird zur Projektionsfläche all der Ängste, mit denen ein kraftloses, alterndes Europa sich in der neuen, globalisierten Welt konfrontiert sieht. Wie das sprichwörtliche Kaninchen auf die Schlange, starrt es auf seine Statistiken und Schemata und sinnt verzweifelt darüber nach, wie das scheinbar Unentrinnbare vielleicht doch noch aufgehalten werden kann.
Währendessen kehrt man auf der anderen Seite der Welt die Scherben der Krise zusammen und nimmt mit einem Lächeln auf den Lippen die Zukunft in Angriff.